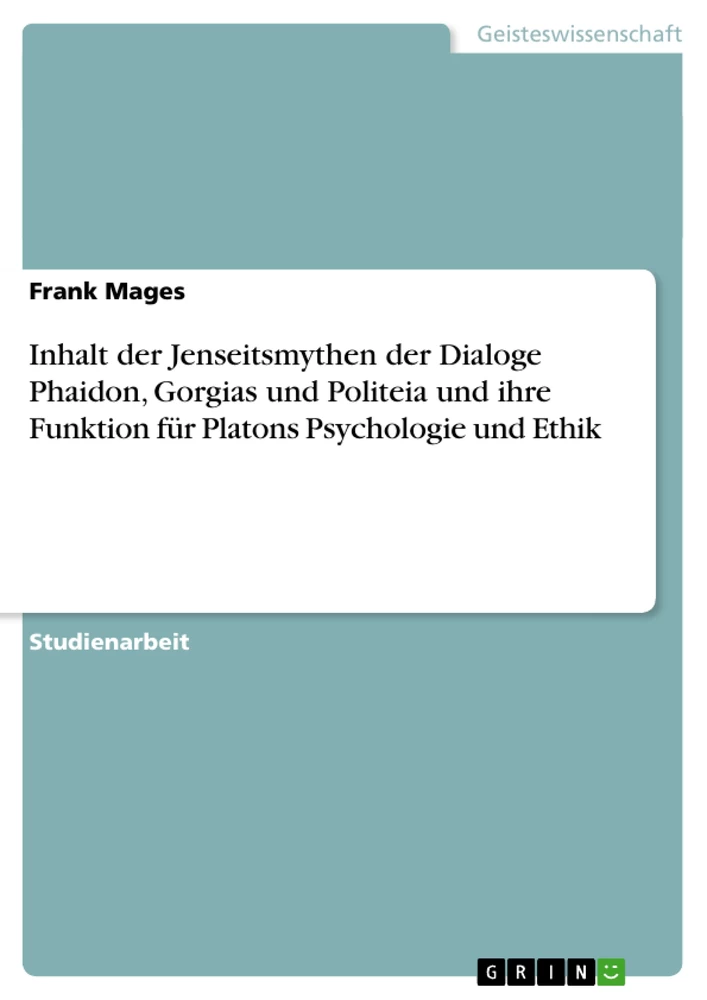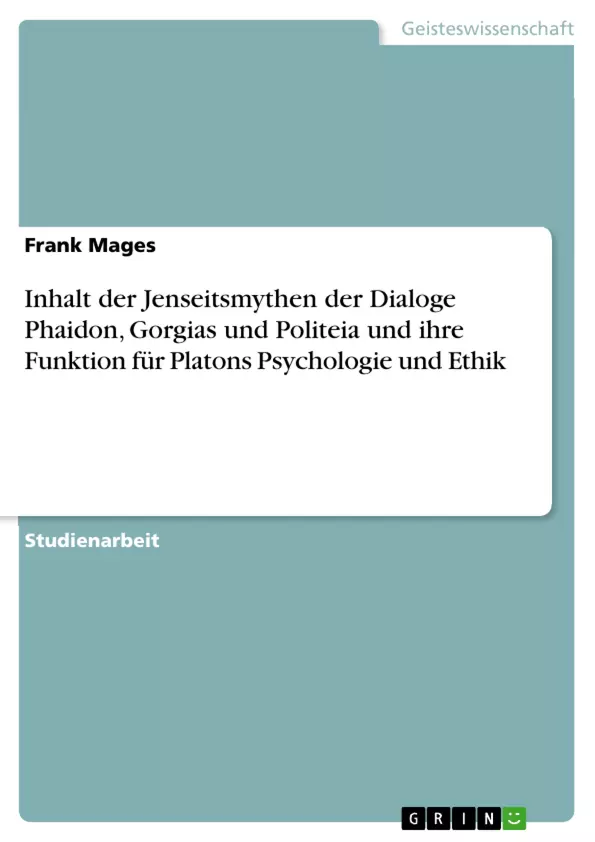Der Begriff der Seele (yuxhß) wie ihn Platon bestimmt und verwendet, existiert vor ihm in
dieser Form noch nicht. Ihre Abhängigkeit vom Körper ist bisweilen stark ausgeprägt. Sie
steht für die Lebendigkeit des Menschen, die im Atem oder im Blut dinglich festgehalten ist.
In Homers Odyssee werden die Seelen in der Unterwelt teilweise nur als Schatten und als eine
jämmerliche, dahinvegetierende Erscheinung ohne Bewusstsein dargestellt. Odysseus wird
zuerst von der Seele seiner eigenen Mutter gar nicht erkannt. Die Erinnerung an das Diesseits
scheint zumindest bei einigen verloren zu sein, ihr Selbstbewusstsein und ein Teil ihrer
Persönlichkeit zusammen mit dem Körper gestorben. Andere wiederum haben nichts
vergessen, agieren genauso wie zu Lebzeiten und interessieren sich sogar weiterhin für die
Welt der Lebenden. Das Bild der Seele, ihre Eigenschaften und ihr Schicksal nach dem Tod
und ihre dortige Gestalt besitzen sogar innerhalb einer Darstellung keine Kontinuität. Die
Seele als Träger moralischer Qualitäten findet in den Erzählungen keinen rechten Platz.1
Die Seelenlehre Platons ändert dies. Er zeichnet ein weitgehend einheitliches Bild der
Seele, ihrer Gestalt, ihrer Unsterblichkeit und ihrer Pflege und rechten Ordnung. Sie wird zum
Hauptakteur seiner Ethik, in ihr spiegelt sich die Lebensführung wieder. Um das Schicksal der
Seele nach dem Tod zu beschreiben, lässt Platon Sokrates Mythen vom Jenseits erzählen. Die
Jenseitsmythen, die am stärksten mit der platonischen Ethik und Seelenlehre verbunden sind,
finden sich in den Dialogen Phaidon, Gorgias und Politeia, die hier Gegenstand der
Untersuchung sind.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Inhalt der Jenseitsmythen im Kontext der jeweiligen Dialoge
- 2.1 Phaidon
- 2.1.1 Die Unsterblichkeit und Beschaffenheit der Seele
- 2.1.2 Schicksal der Seelen nach dem Tod und Aufbau der Erde
- 2.2 Gorgias
- 2.2.1 Die richtige Lebensweise
- 2.2.2 Der Mythos vom Totengericht
- 2.3 Politeia
- 2.3.1 Die drei Teile der Seele, die Gerechtigkeit und die Unsterblichkeit
- 2.3.2 Der Mythos von Er
- 2.1 Phaidon
- 3. Funktion der Mythen in der Platonischen Philosophie
- 3.1 Psychologie
- 3.2 Ethik
- 4. Schlussbetrachtung - Mythos oder Logos?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Jenseitsmythen in Platons Dialogen Phaidon, Gorgias und Politeia. Ziel ist es, den Inhalt dieser Mythen zu erörtern und ihre Funktion in Platons Psychologie und Ethik aufzuzeigen. Die Untersuchung konzentriert sich auf die Aspekte, die Platons Verständnis von Seele und Moral verdeutlichen.
- Die Unsterblichkeit der Seele
- Die Beschaffenheit der Seele und ihre Beziehung zum Körper
- Das Schicksal der Seele nach dem Tod
- Die Rolle der Mythen in Platons Philosophie
- Das Verhältnis von Mythos und Logos in Platons Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt Platons neuartiges Verständnis der Seele im Vergleich zu früheren Vorstellungen. Kapitel 2 analysiert die Jenseitsmythen in den drei Dialogen. In Phaidon wird die Unsterblichkeit der Seele anhand verschiedener Argumente, wie dem Kreislaufargument und dem Argument der Wiedererinnerung, begründet. Der Mythos beschreibt den Weg der Seele in die Unterwelt und ihre weitere Bestimmung nach dem Tod. Der Text aus dem Phaidon wird hier bis zum Abschnitt über den Aufbau der Erde zusammengefasst. Weitere Kapitel werden im Zuge der weiteren Ausarbeitung hinzugefügt.
Schlüsselwörter
Platon, Seelenlehre, Jenseitsmythen, Phaidon, Gorgias, Politeia, Unsterblichkeit, Psychologie, Ethik, Mythos, Logos, Wiedererinnerung, Hades, Gerechtigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet Platons Seelenlehre von früheren Vorstellungen?
Vor Platon wurde die Seele oft nur als Schatten ohne Bewusstsein dargestellt; Platon hingegen macht sie zum unsterblichen Träger moralischer Qualitäten und zum Hauptakteur der Ethik.
Welche Funktion haben die Jenseitsmythen bei Platon?
Sie dienen dazu, die Konsequenzen der Lebensführung im Diesseits für das Schicksal der Seele nach dem Tod zu veranschaulichen und ethisches Handeln zu motivieren.
Was beschreibt der Mythos von Er in der Politeia?
Er beschreibt die Wiedergeburt und die Wahl des neuen Lebensloses, wobei die Gerechtigkeit der Seele über ihre zukünftige Bestimmung entscheidet.
Welche drei Teile der Seele definiert Platon?
In der Politeia unterscheidet Platon zwischen dem vernünftigen, dem muthaften und dem begehrenden Seelenteil, deren richtige Ordnung die Gerechtigkeit ausmacht.
Wie hängen Mythos und Logos bei Platon zusammen?
Platon nutzt den Mythos dort, wo der rationale Logos (die logische Beweisführung) an seine Grenzen stößt, um tiefere Wahrheiten über das Schicksal der Seele zu vermitteln.
- Citation du texte
- Frank Mages (Auteur), 2008, Inhalt der Jenseitsmythen der Dialoge Phaidon, Gorgias und Politeia und ihre Funktion für Platons Psychologie und Ethik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124213