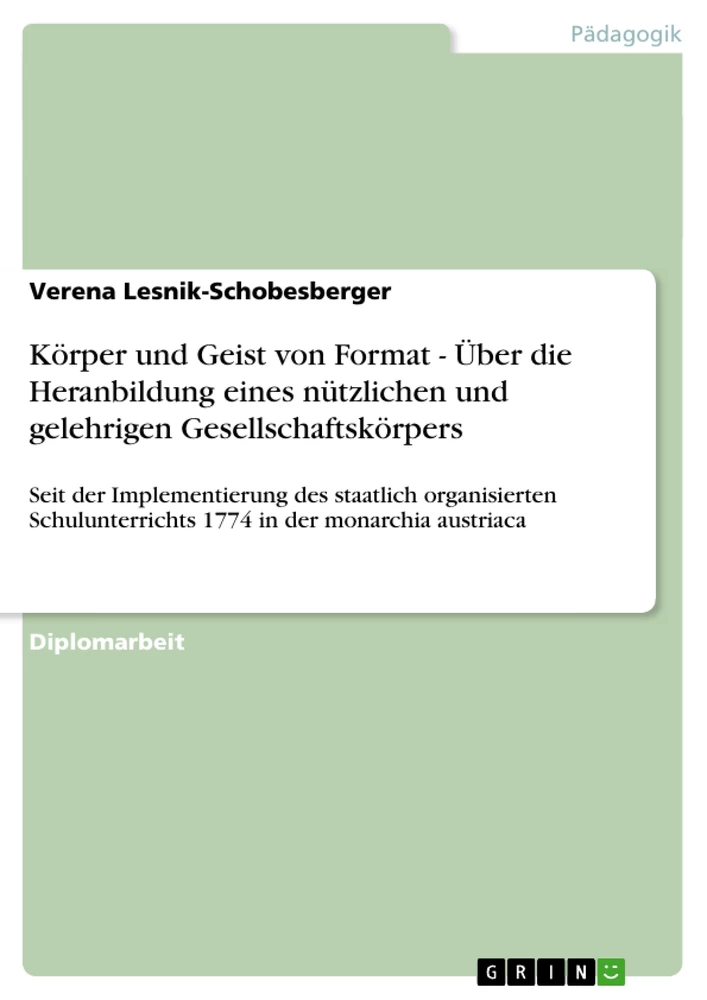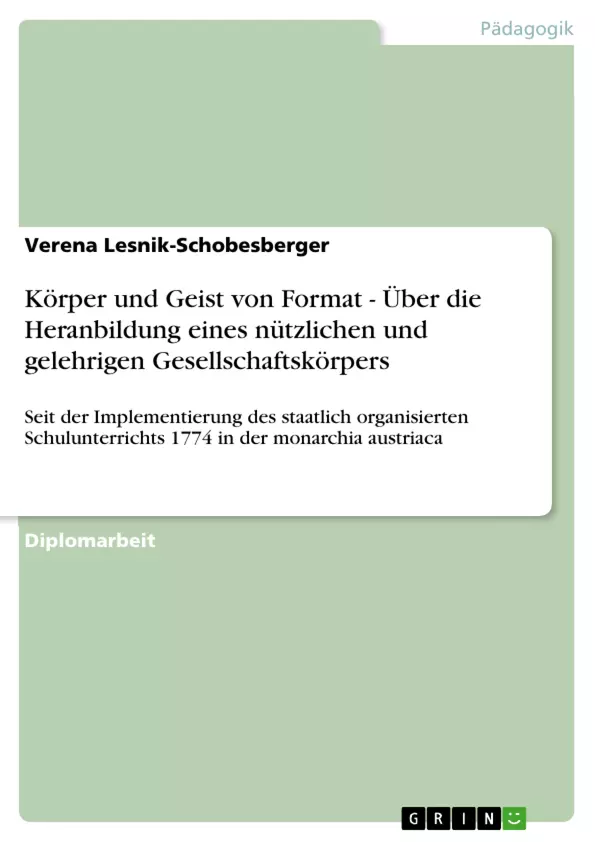Die vorliegende Diplomarbeit thematisiert zum einen das Phänomen der Instandsetzung der allgemeinen Schulpflicht in Österreich im Jahre 1774 durch Kaiserin Maria Theresia. Zum anderen wird unter Einbeziehung der machtanalytischen Begriffe Michel Foucaults eine Analyse der Schulreformschriften I. J. Felbigers unternommen. Aus methodischen Gründen wurde die Arbeit in zwei Teile gegliedert: Der Makroteil ist vergleichbar mit einer historischen Studie, die sich der Beschreibung von vier bedeutenden Prozessen widmet: Aufklärung, Reformabsolutismus, Kameralistik und Pädagogik. Die Argumentationsgrundlage des aufgeklärten Ideals von der Glückseligkeit des Menschen stellt das verbindende Glied zwischen den Prozessen dar. Die allgemeine Schulbildung des Volkes ist das Resultat dieser Beziehung, die in der Implementierung der Allgemeinen Schulordnung 1774 mündet und gleichsam den historischen Höhepunkt markiert. Im Anschluss daran beschäftigt sich der Mikroteil mit der Analyse der damals neu eingeführten Schulunterrichtsmethoden: die „Saganschen Lehrart“ durch J. I. Felbiger. Gegenstand dieser kritischen Relektüre sind die Foucault’schen Begriffe Macht, Disziplin und Norm und deren direkte Bezugsetzung zu den damaligen Schulreformschriften. Das Aufzeigen einer produktiven Macht-Wirkung und die Existenz einer Disziplinartechnologie, die unter anderem das alltägliche Schulgeschehen prägt, sind Teile der Ordnung, die rund um den individuellen Körper geschaffen wurde und noch geschaffen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Makroteil: Historischer Kontext
- Aufklärung
- Reformabsolutismus
- Kameralistik
- Pädagogik
- Mikroteil: Analyse der Schulreformschriften Felbigers
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Einführung der allgemeinen Schulpflicht in Österreich 1774 unter Kaiserin Maria Theresia und analysiert die damit verbundenen Schulreformschriften von I. J. Felbiger unter Einbezug der machtanalytischen Konzepte Michel Foucaults. Die Arbeit beleuchtet den historischen Kontext der Reform und untersucht die Auswirkungen der neuen Unterrichtsmethoden auf die Heranbildung eines "nützlichen und gelehrigen Gesellschaftskörpers".
- Einführung der allgemeinen Schulpflicht in Österreich (1774)
- Analyse der Schulreformschriften I.J. Felbigers
- Macht, Disziplin und Norm im Kontext der Schulreform
- Der aufgeklärte Ideal des glücklichen Menschen und seine Bedeutung für die Schulreform
- Verbindung zwischen Aufklärung, Reformabsolutismus, Kameralistik und Pädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Gegenstand der Arbeit: die Analyse der Einführung der allgemeinen Schulpflicht in Österreich 1774 und die kritische Auseinandersetzung mit den Schulreformschriften von I. J. Felbiger unter Verwendung der Theorien Michel Foucaults. Die Arbeit ist zweigeteilt: ein Makroteil, der den historischen Kontext beleuchtet, und ein Mikroteil, der sich mit den neuen Unterrichtsmethoden auseinandersetzt. Die Verbindung zwischen beiden Teilen bildet das aufgeklärte Ideal vom glücklichen Menschen.
Makroteil: Historischer Kontext: Dieser Teil der Arbeit untersucht den historischen Kontext der Schulreform von 1774. Er beleuchtet vier bedeutende Prozesse: die Aufklärung, den Reformabsolutismus, die Kameralistik und die Pädagogik. Die Argumentation basiert auf dem aufgeklärten Ideal der Glückseligkeit des Menschen als verbindendes Element zwischen diesen Prozessen. Die allgemeine Schulpflicht wird als Ergebnis dieser Verbindung dargestellt, wobei die Implementierung der Allgemeinen Schulordnung 1774 als historischer Höhepunkt betrachtet wird. Es werden die jeweiligen Einflüsse dieser vier Bereiche auf das pädagogische Konzept der Zeit erörtert, ihre Wechselwirkungen aufgezeigt und deren Beitrag zur Einführung der allgemeinen Schulpflicht analysiert. Der Abschnitt veranschaulicht die komplexen sozialen, politischen und wirtschaftlichen Faktoren, die zur Schulreform führten.
Mikroteil: Analyse der Schulreformschriften Felbigers: Der Mikroteil befasst sich mit der Analyse der "Saganschen Lehrart" von I. J. Felbiger. Hier werden die Foucaultschen Begriffe Macht, Disziplin und Norm auf die Schulreformschriften angewendet. Die Analyse untersucht, wie die neuen Unterrichtsmethoden den individuellen Körper und Geist prägten, und wie eine Disziplinartechnologie im Schulalltag wirkte. Der Abschnitt deckt auf, wie die Schulreform nicht nur Wissen vermittelte, sondern auch die Ausübung von Macht und die Schaffung einer normierten Gesellschaft ermöglichte. Es wird untersucht, inwieweit die Methoden Felbigers die Foucault'schen Konzepte der Macht und Disziplinierung im schulischen Kontext widerspiegeln. Konkrete Beispiele aus den Schriften Felbigers veranschaulichen diese Analyse.
Schlüsselwörter
Allgemeine Schulpflicht, Österreich, 1774, Maria Theresia, I. J. Felbiger, Schulreform, Aufklärung, Reformabsolutismus, Kameralistik, Pädagogik, Michel Foucault, Macht, Disziplin, Norm, „Sagansche Lehrart“, Glückseligkeit, Disziplinartechnologie, gelehriger Gesellschaftskörper.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Einführung der allgemeinen Schulpflicht in Österreich 1774
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Arbeit untersucht die Einführung der allgemeinen Schulpflicht in Österreich im Jahr 1774 unter Kaiserin Maria Theresia. Im Mittelpunkt steht die Analyse der Schulreformschriften von I. J. Felbiger unter Verwendung der machtanalytischen Konzepte Michel Foucaults. Die Arbeit betrachtet sowohl den historischen Kontext der Reform als auch die Auswirkungen der neuen Unterrichtsmethoden.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist zweigeteilt: Ein Makroteil beleuchtet den historischen Kontext (Aufklärung, Reformabsolutismus, Kameralistik, Pädagogik), während der Mikroteil die Schulreformschriften Felbigers und deren Implikationen analysiert. Die Verbindung zwischen beiden Teilen bildet das aufgeklärte Ideal vom glücklichen Menschen.
Welche Themen werden im Makroteil behandelt?
Der Makroteil untersucht den historischen Kontext der Schulreform von 1774. Er beleuchtet die Aufklärung, den Reformabsolutismus, die Kameralistik und die Pädagogik und deren jeweilige Einflüsse auf das pädagogische Konzept der Zeit. Der Fokus liegt auf der Verbindung dieser Faktoren und deren Beitrag zur Einführung der allgemeinen Schulpflicht.
Was ist der Inhalt des Mikroteils?
Der Mikroteil analysiert die "Sagansche Lehrart" von I. J. Felbiger unter Anwendung der Foucaultschen Begriffe Macht, Disziplin und Norm. Es wird untersucht, wie die neuen Unterrichtsmethoden den individuellen Körper und Geist prägten und wie eine Disziplinartechnologie im Schulalltag wirkte. Die Analyse beleuchtet, wie die Schulreform nicht nur Wissen vermittelte, sondern auch die Ausübung von Macht und die Schaffung einer normierten Gesellschaft ermöglichte.
Welche Rolle spielt Michel Foucault in dieser Arbeit?
Die machtanalytischen Konzepte Michel Foucaults (Macht, Disziplin, Norm) dienen als analytisches Instrument, um die Schulreformschriften Felbigers und die damit verbundenen Unterrichtsmethoden zu untersuchen. Die Arbeit analysiert, wie die Schulreform die Ausübung von Macht und die Schaffung einer normierten Gesellschaft ermöglichte.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Allgemeine Schulpflicht, Österreich, 1774, Maria Theresia, I. J. Felbiger, Schulreform, Aufklärung, Reformabsolutismus, Kameralistik, Pädagogik, Michel Foucault, Macht, Disziplin, Norm, „Sagansche Lehrart“, Glückseligkeit, Disziplinartechnologie, gelehriger Gesellschaftskörper.
Welches Ziel verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Einführung der allgemeinen Schulpflicht in Österreich 1774 und analysiert die damit verbundenen Schulreformschriften von I. J. Felbiger. Sie beleuchtet den historischen Kontext der Reform und untersucht die Auswirkungen der neuen Unterrichtsmethoden auf die Heranbildung eines "nützlichen und gelehrigen Gesellschaftskörpers".
Wie wird das aufgeklärte Ideal des glücklichen Menschen in der Arbeit behandelt?
Das aufgeklärte Ideal der Glückseligkeit des Menschen dient als verbindendes Element zwischen den verschiedenen Aspekten der Arbeit (Aufklärung, Reformabsolutismus, Kameralistik, Pädagogik und die Schulreform). Es wird untersucht, wie dieses Ideal die Schulreform beeinflusste und mit den neuen Unterrichtsmethoden in Verbindung steht.
- Quote paper
- Mag. phil. Verena Lesnik-Schobesberger (Author), 2007, Körper und Geist von Format - Über die Heranbildung eines nützlichen und gelehrigen Gesellschaftskörpers, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124220