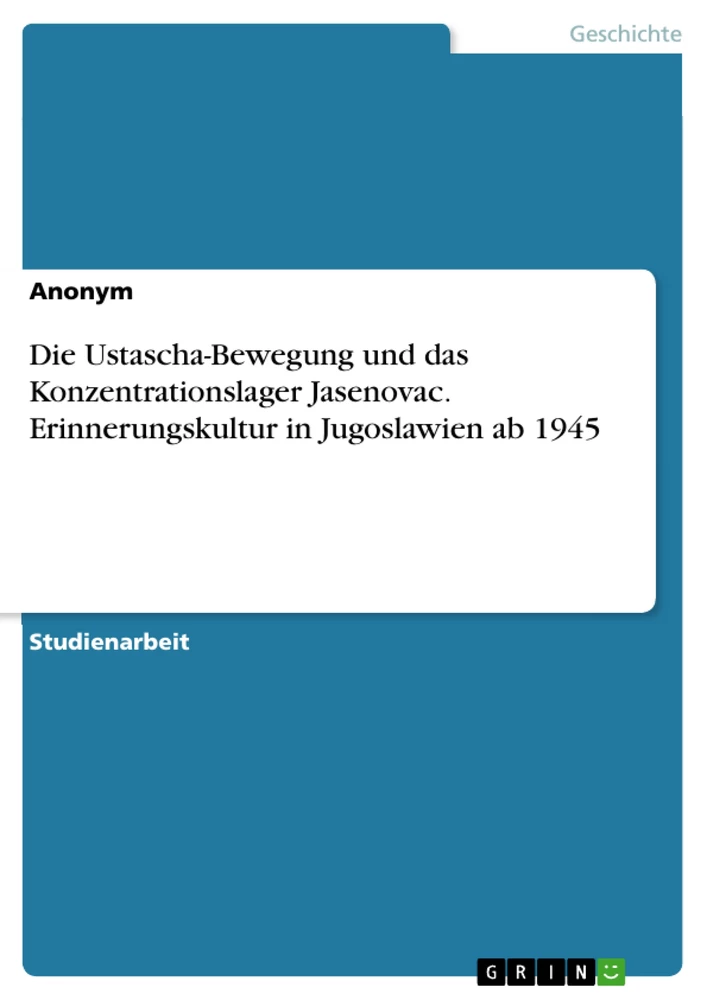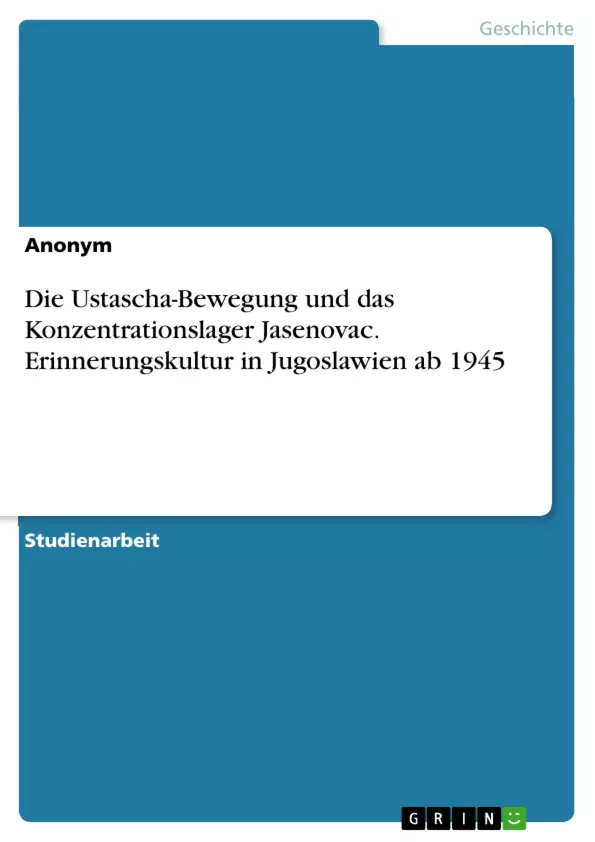Um die Leitfrage „Wie verhält sich die Erinnerungskultur des Konzentrationslagers Jasenovac in der Nachkriegszeit?‟ bearbeiten zu können, wird sich diese Arbeit zunächst mit der Ustascha-Bewegung beschäftigen. Im Anschluss daran wird auf das Konzentrationslager Jasenovac eingegangen, um sich danach mit der Erinnerungskultur in Jugoslawien und der Gedenkstätte für das Lager in Jasenovac zu befassen. Am Schluss werden ein Ausblick und das Fazit verfasst. Um die Thematik mit der oben genannten Fragestellung adäquat bearbeiten zu können, bezieht sich die Arbeit primär auf ausgewählte deutsche und englische Literatur. Die Literatur von Dedijer, Israeli, Korb, Sundhaussen etc. waren bei der Bearbeitung der Fragestellung besonders hilfreich, da diese spezielle Aspekte sowie detaillierte Ausführungen bezüglich der gewählten Thematik aufgreifen.
Das Konzentrationslager in der Nähe des Dorfes Jasenovac, an der Grenze zu Bosnien, existierte von 1941 bis 1945 und war während des Zweiten Weltkrieges das Größte von insgesamt 27 Sammel-, Konzentrations-, Arbeits- und Vernichtungslagern im faschistischen Unabhängigkeitsstaat Kroatien (kroatisch Nezavisna Država Hrvatska, kurz NDH). Das Lager wurde von den Ustaschen geleitet und es herrschte, genauso wie in Deutschland, ein großes Gewaltpotential. In den vier Jahren, in denen das Lager Bestand hatte, wurden circa 80.000 bis 90.000 Männer, Frauen und Kinder, vor allem Serben und Juden, durch verschiedene Waffen getötet, misshandelt oder sind an den Folgen von Hunger und Krankheiten gestorben.
Offiziell gibt die Regierung Jugoslawiens an, dass insgesamt zwischen 600.000 und 700.000 Menschen von der Ustascha in ihren Lagern ermordet wurden. Nachdem das Lager von der Ustascha-Bewegung zerstört wurde blieb es lange Zeit unverändert stehen bis der serbische Architekt Bogdan Bogdanović im Jahr 1966 ein etwa 30 Meter hohes Denkmal aus Beton, „die Blume‟, entwarf, welches in der Nähe des ehemaligen Konzentrationslager steht und mit einem angrenzenden Museum an die Toten erinnern soll. Nachdem die Gedenkstätte in den 1990er Jahren zwischen September 1991 und Mai 1995 in dem Krieg zwischen den Serben und Kroaten zerstört wurde, eröffnete nach Abschluss von Aufbau- und Renovierungsarbeiten im Jahre 2006 eine neue Dauerausstellung in der Gedenkstätte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Ustascha-Bewegung
- 2.1. Die Entstehung von 1928 bis 1941
- 2.2. Die Bewegung von 1941 bis 1945
- 3. Das Konzentrationslager Jasenovac
- 3.1. Beschreibung
- 3.2. Lager III & Stara Gradiska
- 4. Erinnerungskultur in Jugoslawien ab 1945
- 4.1. Erinnerungskultur in Jugoslawien
- 4.2. Gedenkstätte Jasenovac
- 5. Ausblick heute
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Erinnerungskultur des Konzentrationslagers Jasenovac in der Nachkriegszeit. Die zentrale Fragestellung lautet: Wie verhält sich die Erinnerungskultur des Konzentrationslagers Jasenovac in der Nachkriegszeit? Die Arbeit beleuchtet dazu verschiedene Aspekte der Geschichte und ihrer Aufarbeitung.
- Die Entstehung und Entwicklung der Ustascha-Bewegung
- Die Funktionsweise und die Gräueltaten des Konzentrationslagers Jasenovac
- Die Gestaltung der Erinnerungskultur in Jugoslawien nach dem Zweiten Weltkrieg
- Die Rolle der Gedenkstätte Jasenovac in der Erinnerung
- Ein Ausblick auf die heutige Relevanz des Themas
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Konzentrationslagers Jasenovac ein, beschreibt dessen Bedeutung im Kontext des Zweiten Weltkriegs und des faschistischen Unabhängigkeitsstaates Kroatien (NDH), und skizziert die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz der Arbeit. Sie benennt die erschütternden Opferzahlen und die lange Zeit der Untätigkeit nach der Zerstörung des Lagers durch die Ustascha, bis zur Errichtung des Denkmals „Die Blume“ durch Bogdan Bogdanović und die Neueröffnung der Dauerausstellung 2006 nach den Zerstörungen des Jugoslawienkrieges. Die Einleitung legt den Fokus auf die Untersuchung der Erinnerungskultur im Nachkriegsjugoslawien und kündigt den methodischen Aufbau der Arbeit an.
2. Die Ustascha-Bewegung: Dieses Kapitel analysiert die Entstehung und Entwicklung der Ustascha-Bewegung, beginnend mit ihrer Gründung im Jahr 1928 bis zu ihrem Ende 1945. Es beleuchtet die politischen und sozialen Bedingungen, die zur Bildung dieser ultranationalistischen und gewalttätigen Bewegung führten, ihre Organisation und Ideologie. Der Fokus liegt auf Ante Pavelić als Führer und den verschiedenen Phasen ihrer Entwicklung, von den Anfängen als Untergrundorganisation bis zur Machtübernahme im NDH und ihrer Beteiligung an den Verbrechen des Zweiten Weltkriegs. Das Kapitel differenziert zwischen den Entstehungsjahren (1928-1941) und der Zeit der Macht (1941-1945), analysiert die Strategien der Ustascha und die Reaktionen auf politische Ereignisse wie die Königsdiktatur und den Zweiten Weltkrieg. Es zeigt den Weg der Ustascha von einer Untergrundbewegung zur Regierungsmacht und deren Rolle im Kontext der deutschen Besatzung. Die Rolle des Völkerbundes und die internationalen Beziehungen werden ebenfalls thematisiert.
3. Das Konzentrationslager Jasenovac: Dieses Kapitel beschreibt detailliert das Konzentrationslager Jasenovac, das größte und wichtigste Lager der Ustascha im NDH. Es beleuchtet die Lagerstruktur, die Funktionsweise des Lagers und die systematische Ermordung von Serben, Juden und Roma. Die Beschreibung des Lagers und seiner Funktionsweise als Ort systematischer Gewalt und Vernichtung steht im Mittelpunkt. Es wird der Kontext des faschistischen Staates in Kroatien herausgestellt und der Vergleich zu anderen Konzentrationslagern wird angedeutet, ohne jedoch in detaillierte Vergleiche einzugehen. Der Umfang des Lagers und die erschütternden Zahlen der Opfer werden hervorgehoben, sowie dessen Rolle im Rahmen der Gesamtstrategie der Ustascha.
4. Erinnerungskultur in Jugoslawien ab 1945: Dieses Kapitel befasst sich mit der Gestaltung der Erinnerungskultur an das Konzentrationslager Jasenovac im Nachkriegsjugoslawien. Es untersucht die verschiedenen Ansätze und Strategien der jugoslawischen Regierung im Umgang mit der Vergangenheit. Die Aufarbeitung der Verbrechen der Ustascha und die Etablierung der Gedenkstätte Jasenovac werden im Detail untersucht. Die Entwicklung der Gedenkstätte über die Jahrzehnte, die verschiedenen Phasen und die damit einhergehenden ideologischen und politischen Einflüsse werden beleuchtet. Auch der Einfluss des Jugoslawienkrieges und die anschließenden Renovierungsarbeiten werden erwähnt. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung und Bedeutung der Gedenkstätte als Ort des Erinnerns und der Trauer.
Schlüsselwörter
Ustascha, Konzentrationslager Jasenovac, Erinnerungskultur, Jugoslawien, Zweiter Weltkrieg, Genocid, Ante Pavelić, Gedenkstätte, Nachkriegszeit, Opfer, Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit über das Konzentrationslager Jasenovac
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Erinnerungskultur des Konzentrationslagers Jasenovac in der Nachkriegszeit Jugoslawiens. Der Fokus liegt auf der Frage, wie sich diese Erinnerungskultur gestaltet und entwickelt hat.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehung und Entwicklung der Ustascha-Bewegung, die Funktionsweise und Gräueltaten des Konzentrationslagers Jasenovac, die Gestaltung der Erinnerungskultur in Jugoslawien nach dem Zweiten Weltkrieg, die Rolle der Gedenkstätte Jasenovac und die heutige Relevanz des Themas. Es werden die Opferzahlen genannt und die Geschichte der Gedenkstätte von der Errichtung des Denkmals „Die Blume“ bis zur Neueröffnung der Dauerausstellung 2006 nach den Zerstörungen des Jugoslawienkrieges beleuchtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Die Ustascha-Bewegung (unterteilt in Entstehung bis 1941 und die Zeit von 1941 bis 1945), Das Konzentrationslager Jasenovac (mit Beschreibung und Informationen zu Lager III & Stara Gradiska), Erinnerungskultur in Jugoslawien ab 1945 (mit Fokus auf die Erinnerungskultur in Jugoslawien und die Gedenkstätte Jasenovac) und Ausblick heute.
Wie wird die Ustascha-Bewegung in der Arbeit dargestellt?
Das Kapitel zur Ustascha-Bewegung analysiert ihre Entstehung (1928-1941) und Entwicklung bis zu ihrem Ende 1945. Es beleuchtet die politischen und sozialen Bedingungen, die Organisation, die Ideologie und die Rolle Ante Pavelić. Die Strategien der Ustascha und ihre Reaktionen auf politische Ereignisse wie die Königsdiktatur und der Zweite Weltkrieg werden ebenso thematisiert wie die Rolle des Völkerbundes und die internationalen Beziehungen.
Wie wird das Konzentrationslager Jasenovac beschrieben?
Das Kapitel über Jasenovac beschreibt detailliert die Lagerstruktur, Funktionsweise und die systematische Ermordung von Serben, Juden und Roma. Der Kontext des faschistischen Staates in Kroatien und der Umfang des Lagers mit seinen erschütternden Opferzahlen werden hervorgehoben.
Wie wird die Erinnerungskultur in Jugoslawien nach 1945 dargestellt?
Dieses Kapitel untersucht die Ansätze und Strategien der jugoslawischen Regierung im Umgang mit der Vergangenheit, die Aufarbeitung der Verbrechen der Ustascha und die Entwicklung der Gedenkstätte Jasenovac über die Jahrzehnte hinweg, inklusive der Einflüsse des Jugoslawienkrieges und der anschließenden Renovierungsarbeiten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ustascha, Konzentrationslager Jasenovac, Erinnerungskultur, Jugoslawien, Zweiter Weltkrieg, Genocid, Ante Pavelić, Gedenkstätte, Nachkriegszeit, Opfer, Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Was ist die zentrale Fragestellung der Arbeit?
Die zentrale Fragestellung lautet: Wie verhält sich die Erinnerungskultur des Konzentrationslagers Jasenovac in der Nachkriegszeit?
Welche Methode wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit skizziert ihren methodischen Ansatz in der Einleitung, jedoch werden die Details der angewandten Methode nicht im FAQ aufgeführt.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2016, Die Ustascha-Bewegung und das Konzentrationslager Jasenovac. Erinnerungskultur in Jugoslawien ab 1945, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1242637