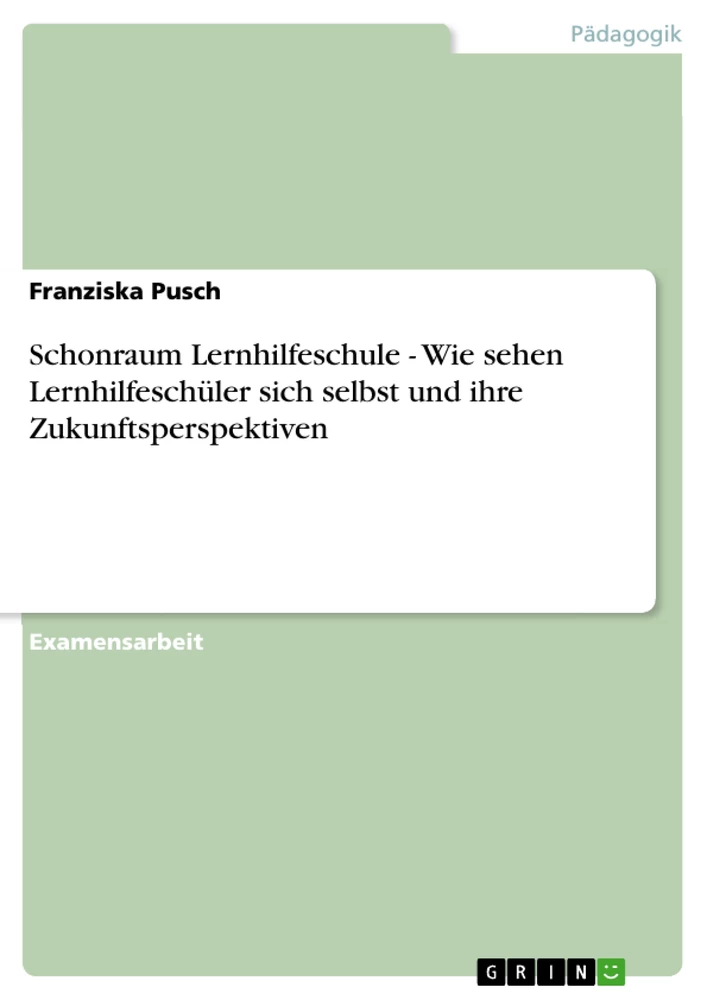Obwohl seit den 1970er Jahren die Forderungen nach einer integrativen Unterrichtung aller Schüler an Regelschulen immer stärker wurden, werden nach aktuellen Erkenntnissen nur ca. 13,5 Prozent aller Förderschüler, bei denen ein Förderbedarf im Schwerpunkt Lernen festgestellt wurde, an Regelschulen unterrichtet (vgl. http://www.kmk.org/statist/Dok184.pdf, S.XI, XIII). Der restliche Anteil der Lernhilfeschüler wird demzufolge an einer Förderschule für Lernhilfe unterrichtet. Im Jahr 2006 waren dies bundesweit 225.000 Schüler (vgl. ebd.). Wie zahlreiche Untersuchungen belegen, hat sich die Lernhilfeschule unlängst zu einer Schule für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund entwickelt. Deshalb stellt sich immer mehr die Frage, ob die Förderschule für Lernhilfe tatsächlich einen ‚Schonraum’ für lernschwache Schüler bietet oder vielmehr ein Auffangbecken für diejenigen ist, die aufgrund anderer Ursachen an der Regelschule scheitern.
Trotz allem wird an der Schonraumthese, der Entlastung der Schüler von Lern- und Leistungsdruck und ihrer daraus resultierenden „seelischen Not“ (Bleidick 1998, zitiert nach Hänsel/Schwager 2004, S.52) sowie den besseren Fördermöglichkeiten an der Lernhilfeschule weiterhin festgehalten. Dennoch bietet der „Schonraum Lernhilfeschule“ nicht ausschließlich ein besseres Lernumfeld. Der Besuch der Förderschule und die damit verbundene Zuschreibung ‚lernbehindert’ stellt eine gravierende emotionale Belastung für die Schüler dar. Nicht nur, dass sie von der Gesellschaft stigmatisiert werden, sie erfahren auch Einschränkungen in ihrer späteren Berufswahl und Berufsausbildung. Nur ca. 20 Prozent aller Lernhilfeschüler verlassen die Schule mit einem Hauptschulabschluss (vgl. http://www.kmk.org/statist/Dok184.pdf, S.XV). Die restlichen Schüler gehen zum Großteil ohne qualifizierten Abschluss in rein schulische oder duale Berufsvorbereitungsmaßnahmen übergehen. Die Aussicht auf einen Ausbildungsplatz bzw. eine Erwerbstätigkeit nach solchen Maßnahmen ist gering (Schröder 2000, S.222).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- TEIL A
- 1. Der lernbehinderte Förderschüler
- 1.1. Definition Lernbehinderung
- 1.2. Soziokulturelle Aspekte der Lernbehinderung
- 1.3. Die Überrepräsentation von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund an Förderschulen für Lernhilfe
- 2. Die Lernhilfeschule als „Schonraum“
- 2.1. Die Förderschule für Lernhilfe – ein kurzer geschichtlicher Abriss
- 2.2. Die Förderschule für Lernhilfe - statistische Grundlagen
- 2.3. Der „Schonraum“ Lernhilfeschule - Realität oder Wunschdenken?
- 2.4. Resümee - Hat die Förderschule für Lernhilfe eine Schonraumwirkung?
- 3. Einflussfaktoren der Förderschule auf das Selbstkonzept
- 3.1. Das globale und das schulische Selbstkonzept
- 3.2. Der Einfluss der sozialen Bezugsgruppe auf das schulische Selbstkonzept
- 3.3. Die Rolle der Lehrerin in Bezug auf das Selbstkonzept eines Schülers
- 3.4. Die gegenseitige Wechselwirkung des Schüler- und Lehrerinnenverhaltens
- 4. Die Zukunftsperspektiven eines Lernhilfeschülers
- 4.1. Arbeitsmarkt und die Ausbildungschancen für „benachteiligte“ Jugendliche
- 4.2. Berufsaussichten aus Schülersicht
- 4.3. Mögliche Wege ins Arbeitsleben für benachteiligte Jugendliche
- 4.3.1. Schulische Berufsvorbereitungsmaßnahmen
- 4.3.2. Das Berufsgrundbildungs- und das Berufsvorbereitungsjahr
- 4.3.3. SchuB-Klassen - eine neue „Erfolg versprechende“ Maßnahme für „benachteiligte“ Jugendliche
- 4.4. Schlussfolgerung
- TEIL B
- 5. Der Untersuchungsauftrag
- 6. Allgemeine methodische Überlegungen
- 6.1. Die Technik des Leitfadeninterviews
- 6.2. Der Aufbau des Leitfadeninterviews
- 7. Die Durchführung der Interviews
- 7.1. Zur Auswahl der Schüler
- 7.2. Gesprächsbedingungen und Durchführung
- 7.3. Die Auswertung der Interviews
- 7.4. Überblick über die Schülerdaten
- 8. Die Ergebnisse der Schülerinterviews
- 8.1. Der Umgang der Schüler mit der Zuschreibung „lernbehindert“
- 8.1.1. Die Gründe der Überweisung an die Lernhilfeschule aus Schülersicht
- 8.1.2. Fazit
- 8.2 Der Umgang der Schüler mit ihrem Förderschulstatus
- 8.2.1. Schüler, die offen mit ihrem Förderschulstatus umgehen
- 8.2.2. Beschämte Schüler, die ihren Förderschulstatus verbergen
- 8.2.3. Fazit
- 8.3. Der Wohlfühleffekt des Schonraums Lernhilfeschule
- 8.3.1. Die Auswirkungen der Überweisung an die Förderschule für Lernhilfe
- 8.3.1.1. Positive Veränderungen aus Schülersicht
- 8.3.1.2. Kritik an der Lernhilfeschule
- 8.3.1.3. Fazit
- 8.4. Der Einfluss der Förderschule auf das schulische Selbstkonzept
- 8.4.1. Der Einfluss der Förderschule auf die Schulnoten der Schüler
- 8.4.1.1. Fazit
- 8.4.2. Die soziale Bezugsgruppe
- 8.4.2.1. Fazit
- 8.4.3. Die Rolle der Lehrerin
- 8.4.3.1. Fazit
- 8.5. Die Zukunftsperspektiven und Zukunftswünsche der Förderschüler
- 8.5.1. Die Zukunftswünsche der Lernhilfeschüler
- 8.5.1.1. Fazit
- 8.5.2. Zu den Berufsaussichten für Förderschüler der Lernhilfeschule
- 8.5.2.1. Fazit
- 9. Die theoretische Einordnung der Untersuchungsergebnisse
- 9.1. Die theoretische Einordnung der Ergebnisse in Bezug auf „Lernbehinderung“
- 9.2. Die Beurteilung der Ergebnisse in Bezug auf die Schonraumwirkung der Lernhilfeschule
- 9.2.1. Die Einordnung der Ergebnisse in Bezug auf die Entlastungsfunktion
- 9.2.2. Die Einordnung der Ergebnisse in Bezug auf die Schulleistungen
- 9.3. Die Einordnung der Ergebnisse in Bezug auf das schulische Selbstkonzept
- 9.3.1. Die Einordnung der Ergebnisse in Bezug auf die soziale Bezugsgruppe
- 9.3.2. Die theoretische Einordnung der Ergebnisse in Bezug auf die Beziehung der Schüler zu ihrer Klassenlehrerin
- 9.3.3. Fazit
- 9.4. Die theoretische Einordnung der Untersuchungsergebnisse in Bezug auf die Zukunftsperspektiven und Zukunftswünsche der Schüler
- 9.4.1. Die Zukunftswünsche der Schüler
- 9.4.2. Die Zukunftsperspektiven der Schüler
- Selbstwahrnehmung von Lernhilfeschülern
- Wirkung der Lernhilfeschule als „Schonraum“
- Einfluss der Förderschule auf das Selbstkonzept
- Zukunftsperspektiven und -wünsche der Schüler
- Soziokulturelle Aspekte der Lernbehinderung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Selbstwahrnehmung von Lernhilfeschülern und ihre Zukunftsperspektiven. Ziel ist es, die Wirkung der Lernhilfeschule als „Schonraum“ zu beleuchten und den Einfluss auf das Selbstkonzept und die Zukunftsplanung der Schüler zu analysieren.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die historische Entwicklung der Förderschulen und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Wirkung der Lernhilfeschule als Schonraum. Teil A befasst sich mit dem lernbehinderten Förderschüler, der Lernhilfeschule als Institution und den Einflussfaktoren der Schule auf das Selbstkonzept der Schüler. Es werden soziokulturelle Aspekte der Lernbehinderung und die Zukunftsperspektiven der Schüler betrachtet, einschließlich der beruflichen Möglichkeiten. Teil B beschreibt die Methodik der Untersuchung, die Durchführung und Auswertung von Schülerinterviews. Die Ergebnisse der Interviews werden bezüglich des Umgangs der Schüler mit ihrer Diagnose, ihrem Förderschulstatus und dem subjektiven Erleben des Schonraums dargestellt. Der Einfluss der Förderschule auf das schulische Selbstkonzept wird analysiert, einschließlich der Rolle der Lehrerin und der sozialen Bezugsgruppe.
Schlüsselwörter
Lernbehinderung, Förderschule, Lernhilfeschule, Schonraum, Selbstkonzept, Zukunftsperspektiven, Schülerinterviews, soziale Bezugsgruppe, Integration, Inklusion, Migrationshintergrund, Berufsaussichten.
- Citation du texte
- Franziska Pusch (Auteur), 2008, Schonraum Lernhilfeschule - Wie sehen Lernhilfeschüler sich selbst und ihre Zukunftsperspektiven, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124317