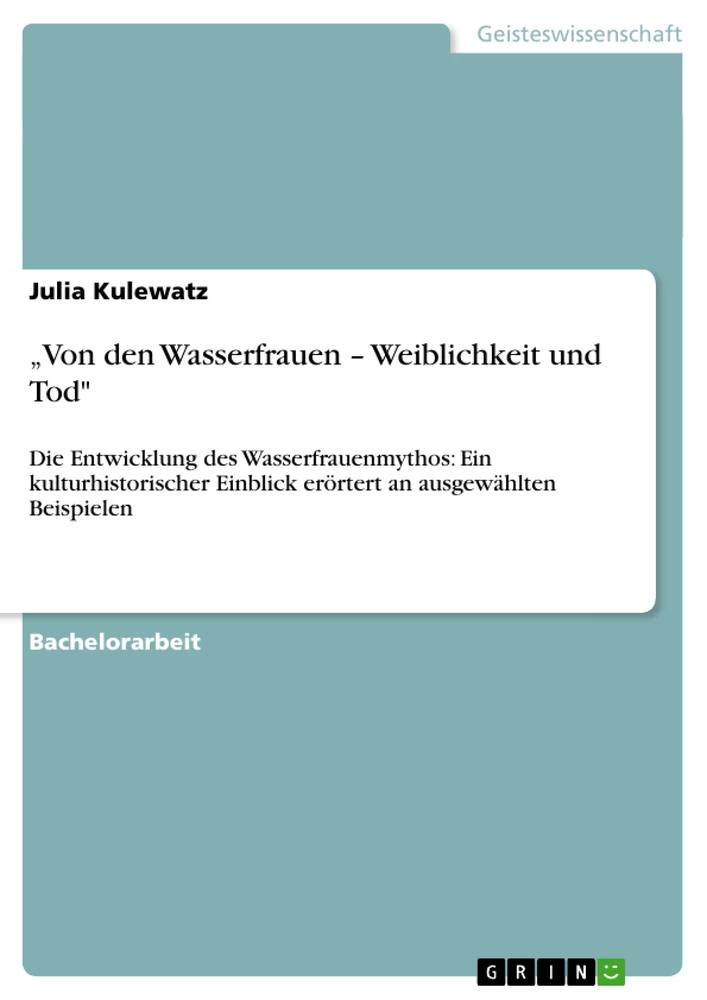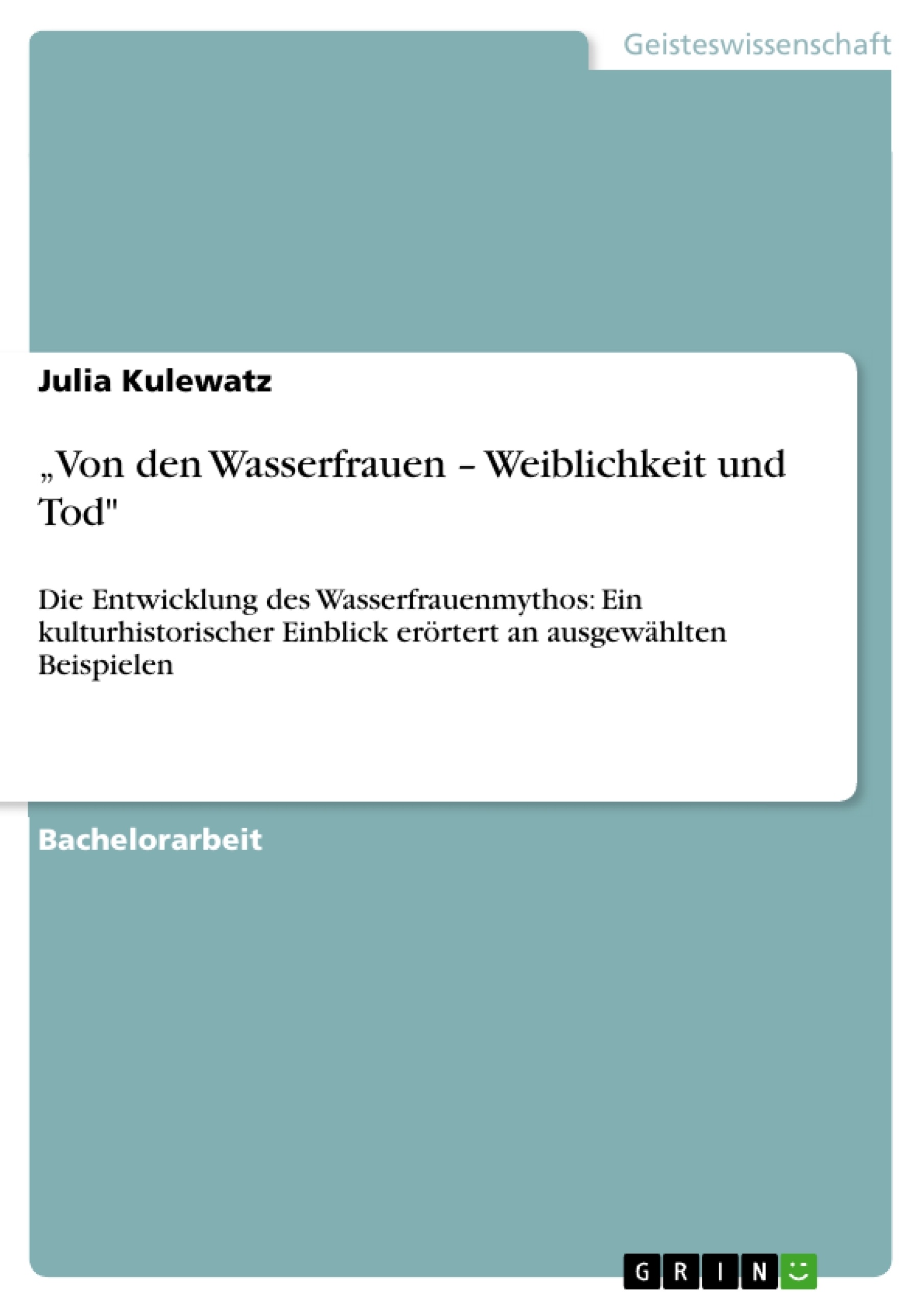Bis heute hat die durchaus ambivalente Gestalt der mythischen Wasserfrau nichts an ihrer Faszinationskraft eingebüßt. Mit regem Interesse verfolgen wir ihre Ursprünge in der Mythologie und in der Sagenwelt, bewundern sie als Ahnenfrau oder Männerfresserin, schöne Sängerin oder sprachlos leidende Schöne.
Mit dieser Arbeit soll die geteilte Frau, in ihrer Sehnsucht und Erlösungsbedürftigkeit in den Vordergrund rücken, die uralte Geschichte um die Verbindung des Weiblichen mit dem Wasser und die Auswirkungen dieser Verbindungen auf Literatur, Kunst und Kultur. Das ewige sehnsüchtige Streben, einer unbeseelten elbischen Natur ist prioritär für das heutige Verständnis einer weiblichen Wassergestalt. Die Bedeutung der Seele für das Weibliche und insbesondere für die Wasserfrau soll innerhalb meiner Ausführungen erörtert werden.
Die Leidensfähigkeit der weiblichen Wasserwesen scheint unendlich.
Ob sie Leiden bewirken oder selbst ertragen müssen, hängt stark von dem jeweiligen Kulturkreis und der Epoche, der sie entwachsen sind, ab. Doch immer wird man sie in Verbindung mit dem Leid sehen, dem eigenen und dem fremden.
Wasserfrauen sind geprägt von der Suche nach Identität.
Als Verkörperung liquider Dualität blieb ihnen diese (bis auf wenige Ausnahmen) oft verwehrt. Ihre Doppelnatur verdammte sie zu einer Existenz zwischen Menschenfrau und Fischleib, ein überirdisch lockender Leib, der viel versprach aber nur wenig Versprochenes einhalten konnte.
Als unwirklicher Bestandteil zweier Welten erscheint mir die Wandlungsfähigkeit der nassen Schönheiten auf der Hand zu liegen. Ergründet man das feuchte Element, dem sie entstammen so wird nicht nur ihr geteilter Leib, sondern auch ein ständig wankendes Gemüt verständlich. Weshalb die Wandelbarkeit der Wasserfrauen ebenso Teil meiner Betrachtungen sein wird.
Den weiblichen Mischwesen wird viel nachgesagt und angehangen:
Gütiges, Verwunderliches, Abnormes, Monströses, Unbegreifliches, Göttliches und Dämon-isches. Tatsächlich trifft beinahe alles auf sie zu: Sie sind göttlich und dämonisch gleichermaßen, denn ist ihre unbegreifliche und geteilte Natur nicht gerade dazu verdammt alles und doch nichts zu sein?
Inhaltsverzeichnis
- Prolog
- 1. Das Wasser
- 1.1 Element der Ambiguität
- 1.1.1 Von den Wassern des Lebens
- 1.1.2 Von den Wassern des Todes
- 1.2 Symbol der Seele
- 1.3 Das Element personifizierter Weiblichkeit
- 1.1 Element der Ambiguität
- 2. Mythologische Ursprünge
- 2.1 Die Sirenen
- 2.2 Von göttlichen Mischwesen und dämonisierten Frauengestalten
- 3. Über die Vielgestaltigkeit der Wasserfrauen
- 3.1 Wandelbare Wasserfrau: Die Bedeutung der Metamorphose für weibliche Wasserwesen
- 3.2 Konstruierte Doppelnatur: Existenz zwischen Fischleib und Menschenfrau
- 4. Vom Verlust der Stimme: Die erfolglosen Sängerinnen
- 5. Sehnsucht und Seele: Ein fließendes Ich auf der Suche nach Identität
- 6. „Undine\", oder von der Kraft einer Nixenstimme
- 6.1 Friedrich de la Motte-Fouqué: „Undine“, Liebe über den Tod hinaus?
- 6.1.1 Undine, eine paracelsische Wassernymphe
- 6.1.2 Von der Liebe der Natur und der Seele des Menschen
- 6.1.3 Weder Menschenfrau noch Wasserwesen
- 6.1.4 Liebe über den Tod hinaus?
- 6.2 Ingeborg Bachmann: „Undine geht“, Liebesverrat: Ein Nixenmonolog
- 6.2.1 Undine geht
- 6.2.2 Männer mit Namen Hans: Über den Identitätsverlust
- 6.2.3 Undinenliebe
- 6.2.4 Von Sprache und Sprachlosigkeit
- 6.2.5 Weiblichkeit und Tod: Wasserexistenz jenseits von allem Menschlichen?
- 6.3 Vergleichende Betrachtungen
- 6.1 Friedrich de la Motte-Fouqué: „Undine“, Liebe über den Tod hinaus?
- Epilog
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die mythische Figur der Wasserfrau in der deutschsprachigen und koreanischen Literatur, fokussiert auf deren Entwicklung und die Darstellung von Weiblichkeit und Tod. Ziel ist es, die Ambivalenz der Wasserfrau, ihre Sehnsucht nach Identität und ihre Leidensfähigkeit im Kontext kultureller und literarischer Darstellungen zu analysieren.
- Die Ambivalenz der Wasserfrau als Symbol der Dualität zwischen Mensch und Natur
- Die Suche nach Identität und der Verlust der Stimme als zentrale Themen der Wasserfrauen-Darstellung
- Die Verbindung von Weiblichkeit, Tod und Wasser in verschiedenen kulturellen Kontexten
- Die Rolle der Metamorphose und Wandelbarkeit in der Konstruktion der Wasserfrau
- Literarische Interpretationen des Wasserfrauenmythos (am Beispiel von Fouqué und Bachmann)
Zusammenfassung der Kapitel
Prolog: Der Prolog führt in die Thematik ein und beschreibt die anhaltende Faszination der ambivalenten Figur der Wasserfrau. Er betont die zentrale Rolle der Sehnsucht, des Leidens und der Suche nach Identität im Kontext der Verbindung von Weiblichkeit und Wasser.
1. Das Wasser: Dieses Kapitel analysiert das Wasser als zentrales Symbol der Arbeit. Es beschreibt die Ambivalenz des Wassers als Element des Lebens und des Todes, als Symbol der Seele und als personifizierte Weiblichkeit. Es legt die Grundlage für das Verständnis der Wasserfrau als ein Wesen, das zwischen diesen Polen changiert.
2. Mythologische Ursprünge: Dieses Kapitel erforscht die Ursprünge des Wasserfrauenmythos in der Mythologie und Sagenwelt. Es behandelt die Sirenen und andere göttliche und dämonische Frauengestalten, um die Vielfalt und die Ambivalenz der Wasserfrau darzustellen. Das Kapitel beleuchtet die vielschichtigen Aspekte der Figur und ihre Verankerung in unterschiedlichen kulturellen Erzählungen.
3. Über die Vielgestaltigkeit der Wasserfrauen: Die Vielgestaltigkeit der Wasserfrauen wird hier beleuchtet. Die Kapitel analysiert ihre Wandelbarkeit und ihre Doppelnatur als Wesen zwischen Fischleib und Menschenfrau. Die Metamorphose wird als Schlüssel zur Interpretation ihrer Existenz zwischen zwei Welten betrachtet.
4. Vom Verlust der Stimme: Die erfolglosen Sängerinnen: Dieses Kapitel thematisiert den häufigen Verlust der Stimme als Ausdruck des Leidens und der Ohnmacht der Wasserfrauen. Es untersucht die Verbindung zwischen Sprachlosigkeit, Identitätskrise und dem Zwiespalt ihrer Existenz.
5. Sehnsucht und Seele: Ein fließendes Ich auf der Suche nach Identität: Das Kapitel fokussiert auf die Sehnsucht der Wasserfrauen nach Identität und die Schwierigkeiten, die mit ihrer Doppelnatur verbunden sind. Die Suche nach Zugehörigkeit und Selbstfindung wird im Kontext ihrer liquiden Existenz analysiert.
6. „Undine\", oder von der Kraft einer Nixenstimme: Dieses Kapitel analysiert die literarischen Interpretationen des Wasserfrauenmythos in den Werken von Fouqué und Bachmann. Es werden die unterschiedlichen Darstellungen von Liebe, Verrat und Tod im Kontext der Wasserfrau und die Bedeutung der Stimme untersucht. Der Vergleich beider Interpretationen vertieft das Verständnis der zentralen Themen der Arbeit.
Schlüsselwörter
Wasserfrau, Mythologie, Weiblichkeit, Tod, Identität, Dualität, Metamorphose, Literatur, Fouqué, Bachmann, Seele, Leid, Sprache, Sprachlosigkeit, Kultur, Ambivalenz, Sehnsucht.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit "Die Wasserfrau: Mythos, Weiblichkeit und Tod in der Literatur"
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit analysiert die mythische Figur der Wasserfrau in der deutschsprachigen und koreanischen Literatur. Im Fokus stehen deren Entwicklung, die Darstellung von Weiblichkeit und Tod sowie die Ambivalenz der Wasserfrau, ihre Sehnsucht nach Identität und ihre Leidensfähigkeit im Kontext kultureller und literarischer Darstellungen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Ambivalenz der Wasserfrau als Symbol der Dualität zwischen Mensch und Natur, die Suche nach Identität und den Verlust der Stimme, die Verbindung von Weiblichkeit, Tod und Wasser in verschiedenen kulturellen Kontexten, die Rolle der Metamorphose und Wandelbarkeit und literarische Interpretationen des Wasserfrauenmythos (am Beispiel von Fouqué und Bachmann).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in einen Prolog, sechs Hauptkapitel und einen Epilog. Die Kapitel behandeln das Wasser als Symbol, die mythologischen Ursprünge der Wasserfrau, deren Vielgestaltigkeit, den Verlust der Stimme, Sehnsucht und Identitätssuche sowie literarische Interpretationen bei Fouqué und Bachmann.
Wie wird das Wasser als Symbol interpretiert?
Das Wasser wird als zentrales Symbol der Ambivalenz dargestellt: als Element des Lebens und des Todes, als Symbol der Seele und als personifizierte Weiblichkeit. Die Wasserfrau changiert zwischen diesen Polen.
Welche Rolle spielen mythologische Ursprünge?
Das Kapitel zu den mythologischen Ursprüngen erforscht die Wurzeln des Wasserfrauenmythos in der Mythologie und Sagenwelt, beleuchtet Figuren wie die Sirenen und zeigt die Vielfalt und Ambivalenz der Wasserfrau in unterschiedlichen kulturellen Erzählungen.
Wie wird die Vielgestaltigkeit der Wasserfrauen dargestellt?
Die Arbeit analysiert die Wandelbarkeit und Doppelnatur der Wasserfrauen als Wesen zwischen Fischleib und Menschenfrau. Die Metamorphose wird als Schlüssel zur Interpretation ihrer Existenz zwischen zwei Welten betrachtet.
Welche Bedeutung hat der Verlust der Stimme?
Der Verlust der Stimme wird als Ausdruck des Leidens und der Ohnmacht der Wasserfrauen interpretiert, verbunden mit Sprachlosigkeit, Identitätskrise und dem Zwiespalt ihrer Existenz.
Wie wird die Sehnsucht nach Identität behandelt?
Die Arbeit fokussiert auf die Sehnsucht der Wasserfrauen nach Identität und die Schwierigkeiten, die mit ihrer Doppelnatur verbunden sind. Die Suche nach Zugehörigkeit und Selbstfindung wird im Kontext ihrer liquiden Existenz analysiert.
Welche literarischen Beispiele werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die literarischen Interpretationen des Wasserfrauenmythos anhand der Werke von Fouqué ("Undine") und Bachmann ("Undine geht"). Der Vergleich beider Interpretationen vertieft das Verständnis der zentralen Themen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wasserfrau, Mythologie, Weiblichkeit, Tod, Identität, Dualität, Metamorphose, Literatur, Fouqué, Bachmann, Seele, Leid, Sprache, Sprachlosigkeit, Kultur, Ambivalenz, Sehnsucht.
- Citar trabajo
- Julia Kulewatz (Autor), 2009, „Von den Wasserfrauen – Weiblichkeit und Tod", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124383