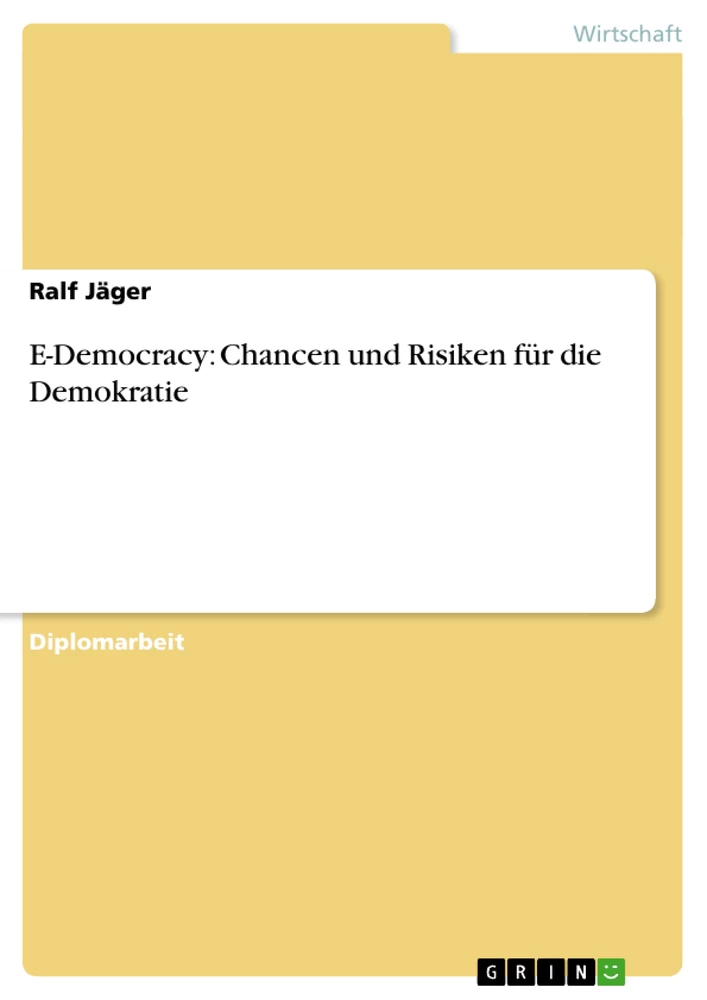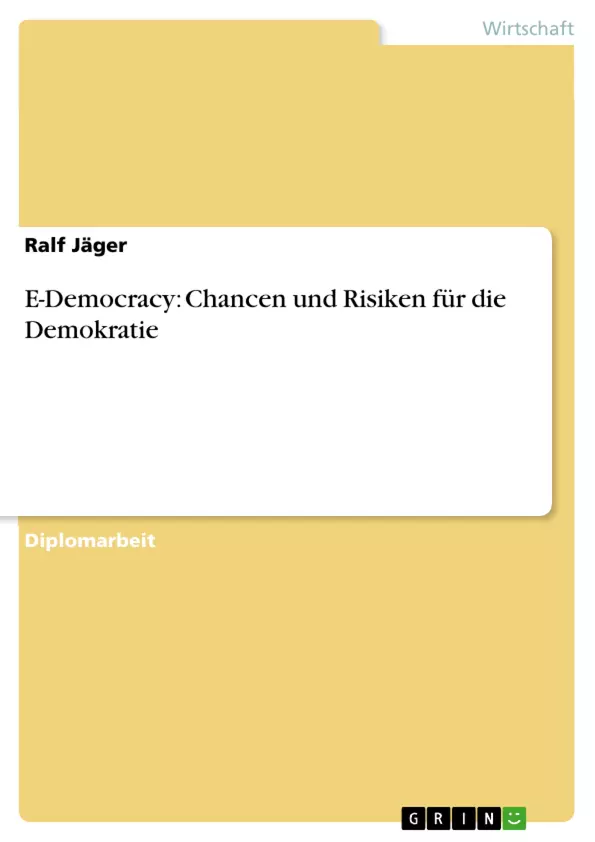In der heutigen Informationsgesellschaft wird E-Democracy vermehrt ein Thema, nachdem sich schon E-Business und E-Commerce teilweise etabliert haben. Zu Beginn der Ausbreitung des Internets in den 1990er Jahren war die Euphorie gross. Es wurde vom Ende der Politikverdrossenheit und von einer neuen Ära der "Cyberdemokratie" gesprochen, in der alle Bürger aktiv in die demokratischen Entscheidungsprozesse auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene eingebunden wären. Allerdings stellte sich bald Ernüchterung ein, als der erwartete Anstieg der politischen Beteiligung mehr oder weniger ausblieb. 2 3 Ebenfalls hat die Einführung der brieflichen Stimmabgabe in vielen Kantonen zu keiner Erhöhung der Stimmbeteiligung geführt.4 Weiter hofft die Auslandschweizer Organisation, dass sich unter Umständen neue Gruppen von Stimmberechtigten politisch beteiligen können, beispielsweise Auslandschweizer oder jüngere Generationen.5 Es leben ungefähr 480′000 Schweizer im Ausland und von diesen machen circa ein Fünftel von ihren politischen Rechten Gebrauch. Falls die Demokratie weiter elektronisiert wird, würden noch mehr Auslandschweizer bei politischen Entscheidungen ihre Stimme abgeben. (vgl. Kap. 4.1).6 Dann besteht die Möglichkeit, dass das Internet viele Informationslücken für die Bürger7 schliessen kann und somit die Transparenz erhöht. Das heisst, eine direkte und interaktive Kommunikation zwischen Bürger und Politik ist möglich. E-Demokratie könnte nun, aufgrund ihrer unbegrenzten zeitlichen und räumlichen Verfügbarkeit und durch Nutzung des kostengünstigen Internets dazu beitragen, die Verwirklichung einer deliberativen Politik einen grossen Schritt näher bringen (vgl. Kap. 2.3).8
Aber die Zuhilfenahme des Internets birgt auch verschiedene Risiken. Das Medium Internet verändert die Demokratie in zumindest doppelter Weise. Einerseits findet die gesellschaftliche Kommunikation zunehmend auch in elektronischen Netzen statt, was zu einer weiteren Zunahme der Anonymität führt.9 Falls die politischen Rechte auf elektronischem Weg ausgeübt werden können, werden wohl die föderalistischen Strukturen, wie sie in der Schweiz sehr stark ausgeprägt sind, darunter leiden (vgl. Kap. 4.5.1). Andererseits bringt das Internet und deren Nutzung neue soziale Ungleichheiten mit sich, beispielsweise die Debatte um den "digital divide" (vgl. Kap. 2.6.1).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Ziele der Arbeit
- 1.3 Aufbau und Vorgehen
- 1.4 Begriffsabgrenzung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Der demokratische Prozess
- 2.1.1 Die Phase des Anstosses
- 2.1.2 Die vorparlamentarische und parlamentarische Phase
- 2.1.3 Die Referendumsphase
- 2.1.4 Abstimmungen und Wahlen
- 2.2 Kostenvorteile von E-Democracy
- 2.3 Internet und deliberative Politik
- 2.4 Entwicklung
- 2.4.1 Der Wandel der Stimmabgabe
- 2.4.2 Die Position der Bürger
- 2.4.3 Einwirkung der Medien auf E-Democracy
- 2.4.4 Stand des Diffusionsprozesses im Internet
- 2.4.5 Forschungsstand
- 2.5 Anschlussfähigkeit
- 2.5.1 Technische Anschlussfähigkeit
- 2.5.2 Rechtliche Anschlussfähigkeit
- 2.5.3 Organisatorische Anschlussfähigkeit
- 2.5.4 Ökonomische Anschlussfähigkeit
- 2.5.5 Kulturelle Anschlussfähigkeit
- 2.5.6 Politische Anschlussfähigkeit
- 2.6 Demokratisches Internet: Voraussetzungen
- 2.6.1 Politische Hürden
- 2.6.2 Moralische Hürden
- 3. E-Democracy Projekte
- 3.1 Smartvote
- 3.2 E-Democracy Projekte in Österreich und Deutschland
- 3.3 E-Voting Projekt des Bundes
- 3.3.1 Sozio-Politisches Umfeld
- 3.3.2 Das Potenzial des «Vote électroniques»
- 3.4 Einschränkungen und Probleme
- 4. Chancen und Risiken für die Demokratie
- 4.1 E-Democracy und Partizipation
- 4.2 E-Democracy und politische Öffentlichkeit
- 4.3 E-Democracy und Wahlen / Abstimmungen
- 4.4 E-Government und E-Democracy
- 4.5 E-Democracy und Institutionen
- 4.5.1 Institutionen und Föderalismus
- 4.5.2 Parteien
- 4.5.3 Sonstige politische Organisationen
- 4.6 Sicherheit und Akzeptanz
- 4.7 E-Democracy und „agenda setting“
- 4.8 E-Democracy und Mobilisierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Chancen und Risiken von E-Democracy für die Demokratie. Sie analysiert die theoretischen Grundlagen, betrachtet konkrete E-Democracy-Projekte und bewertet deren Auswirkungen auf Partizipation, politische Öffentlichkeit, Wahlen und Institutionen.
- Theoretische Fundierung des Konzepts E-Democracy
- Analyse bestehender E-Democracy-Projekte
- Bewertung der Auswirkungen auf politische Partizipation
- Untersuchung der Chancen und Risiken für die demokratische Öffentlichkeit
- Einfluss auf Wahlen und Abstimmungen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik ein, beschreibt die Problemstellung und skizziert den Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 legt die theoretischen Grundlagen dar, indem es den demokratischen Prozess, die Kostenvorteile von E-Democracy und deren Verhältnis zum Internet erläutert. Es werden verschiedene Aspekte der Anschlussfähigkeit von E-Democracy beleuchtet. Kapitel 3 präsentiert verschiedene E-Democracy-Projekte, darunter Smartvote und Projekte in Österreich und Deutschland, und diskutiert dabei auch Einschränkungen und Probleme. Kapitel 4 befasst sich mit den Chancen und Risiken von E-Democracy für die Demokratie, unter anderem in Bezug auf Partizipation, politische Öffentlichkeit, Wahlen und Institutionen.
Schlüsselwörter
E-Democracy, Demokratie, Partizipation, Internet, digitale Politik, Online-Abstimmung, E-Voting, Chancen, Risiken, politische Öffentlichkeit, Institutionen, Deliberation.
Häufig gestellte Fragen
Welche Chancen bietet E-Democracy für die Bürger?
E-Democracy kann Informationslücken schließen, die Transparenz erhöhen und eine direkte, kostengünstige Kommunikation zwischen Bürgern und Politik ermöglichen.
Was sind die größten Risiken der elektronischen Demokratie?
Zu den Risiken gehören zunehmende Anonymität, die Schwächung föderalistischer Strukturen sowie die Entstehung neuer sozialer Ungleichheiten.
Was versteht man unter dem „Digital Divide“?
Der Begriff beschreibt die digitale Spaltung der Gesellschaft in Personen mit und ohne Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologien.
Welchen Nutzen hat E-Voting für Auslandschweizer?
Es ermöglicht eine einfachere Teilnahme an politischen Entscheidungen, da die physische Distanz und Postlaufzeiten bei der Stimmabgabe keine Rolle mehr spielen.
Was ist das Projekt „Smartvote“?
Smartvote ist ein Beispiel für ein E-Democracy-Projekt, das Wählern hilft, ihre politischen Positionen mit denen von Kandidaten zu vergleichen.
- Quote paper
- Master of Arts in Economics and Social Sciences Ralf Jäger (Author), 2007, E-Democracy: Chancen und Risiken für die Demokratie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124512