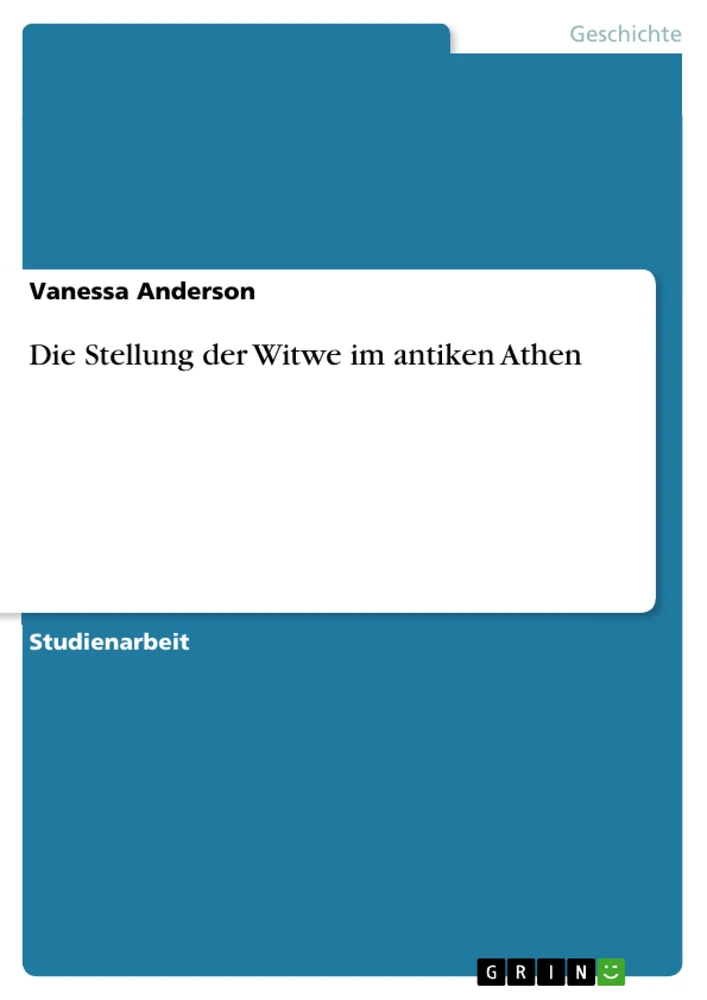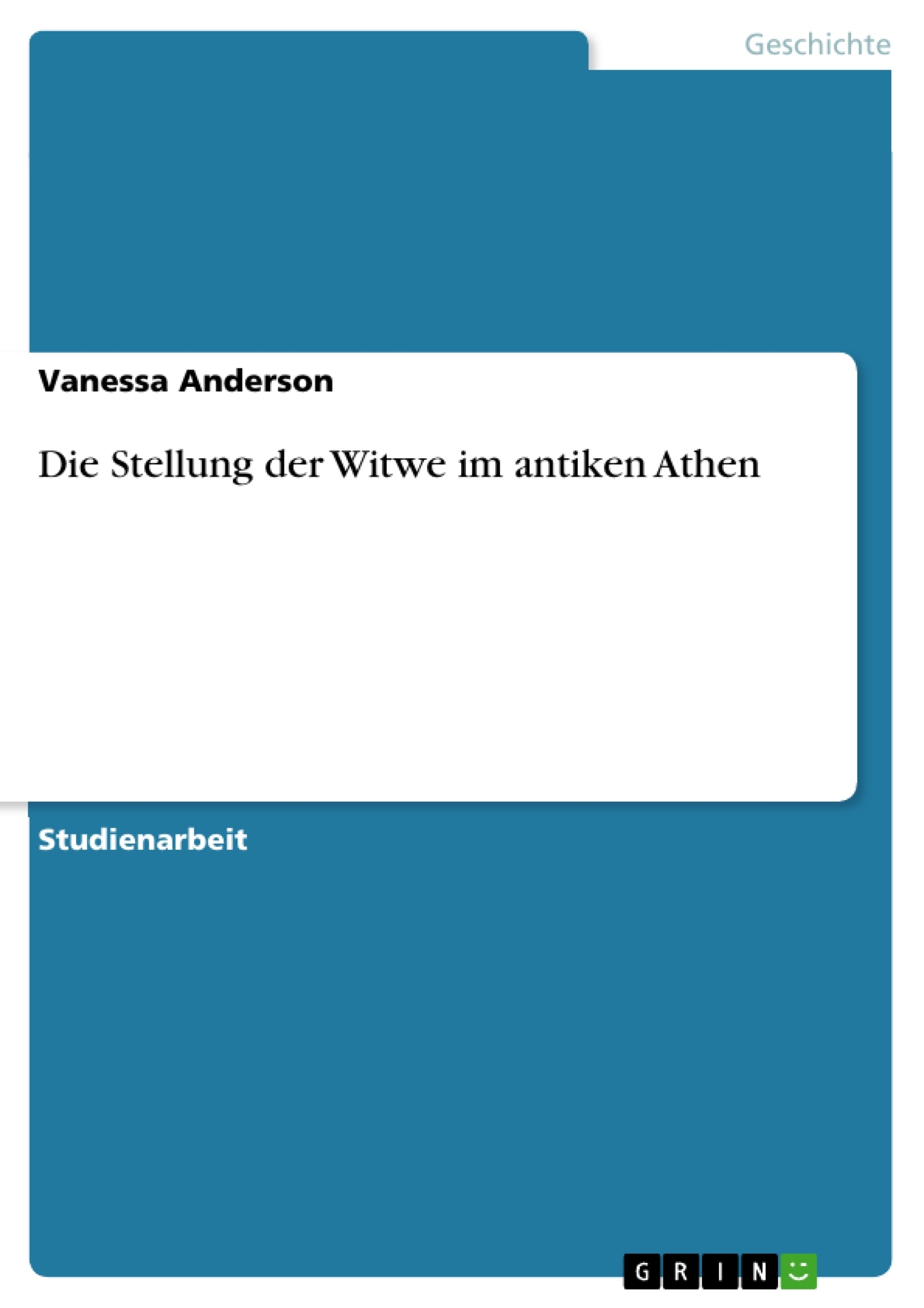Diese Arbeit soll sich nun nicht nur mit der allgemeinen Lage der Frau im Athen der Klassik beschäftigen, sondern auch im speziellen einen Fokus auf die Situation einer Witwe in dieser Zeit legen. Das Thema umfasst somit soziokulturelle, normative, religiöse und zu großen Teilen auch rechtliche Aspekte des Lebens als Hinterbliebene. Der zeitliche Rahmen der Klassik wurde ausgewählt, um die rechtliche und soziale Gerechtigkeit der noch jungen Demokratie zu überprüfen und um die Stellung der Witwe in dieser besonders langzeitig prägenden Ära am Beginn eines Veränderungsprozesses zu betrachten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die gesellschaftlich-rechtliche Stellung der athenischen Frau
- 3. Das weibliche Erbrecht im antiken Griechenland
- 4. Die Witwe
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Rolle der Witwe im antiken Athen. Sie beleuchtet die soziokulturellen, normativen, religiösen und rechtlichen Aspekte des Lebens einer Hinterbliebenen in dieser Zeit. Der Fokus liegt dabei auf der rechtlichen und sozialen Situation von Witwen im Kontext der sich entwickelnden Demokratie Athens.
- Die gesellschaftliche und rechtliche Stellung der Frau im antiken Athen
- Das weibliche Erbrecht im antiken Griechenland
- Die rechtliche und soziale Position der Witwe
- Der Umgang mit Trauer und den finanziellen Folgen des Witwenstatus
- Die Problematik der Unterscheidung zwischen rechtlichen Regularien und individuellen Handlungsfreiräumen in Familien
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und erläutert den aktuellen Forschungsstand zum Thema der Rolle der Frau in der Geschichte. Sie betont die Bedeutung der amerikanischen Frauenbewegung für die verstärkte Beschäftigung mit der Frauengeschichte und erläutert die Zielsetzung und den methodischen Ansatz der Arbeit.
2. Die gesellschaftlich-rechtliche Stellung der athenischen Frau
Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die rechtliche und soziale Stellung der Frau im antiken Athen. Es beleuchtet die rechtlichen Einschränkungen, die Frauen unterlagen, und ihre gesellschaftliche Rolle als Ehefrau, Mutter und Hausverwalterin.
3. Das weibliche Erbrecht im antiken Griechenland
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Erbrecht im antiken Griechenland und der besonderen Position der Frau als potenzielle Erbe. Es thematisiert den Status der Frau als "epikleros" und ihre Rechte im Erbschaftsprozess.
4. Die Witwe
Dieses Kapitel widmet sich dem spezifischen Status der Witwe in der antiken griechischen Gesellschaft. Es beleuchtet ihre rechtliche und soziale Situation, ihren Umgang mit Trauer und finanziellen Folgen, sowie Beispiele aus der Literatur.
Schlüsselwörter
Athen, Witwe, Frau, antike Gesellschaft, Recht, Erbrecht, Soziokultur, Trauer, Familie, Oikos, epikleros, Demokratie, Rechtsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema dieser Hausarbeit?
Die Arbeit untersucht die soziokulturelle, religiöse und vor allem rechtliche Stellung der Witwe im antiken Athen während der Zeit der Klassik.
Was bedeutet der Begriff "epikleros" im antiken Erbrecht?
Eine "epikleros" war eine Tochter, die mangels männlicher Erben das Erbe ihres Vaters zusammen mit der Verpflichtung zur Heirat innerhalb der Verwandtschaft weitergab, um den Fortbestand des Oikos (Haushalts) zu sichern.
Welche rechtliche Stellung hatten Frauen allgemein im antiken Athen?
Frauen unterlagen starken rechtlichen Einschränkungen und standen meist unter der Vormundschaft eines männlichen Verwandten (Kyrios). Ihre Rolle war primär auf den Haushalt und die Familie beschränkt.
Wie wurde die soziale Gerechtigkeit für Witwen in der frühen Demokratie bewertet?
Die Arbeit analysiert, inwieweit die junge athenische Demokratie rechtliche Schutzmechanismen für Witwen bot oder ob individuelle familiäre Handlungsfreiräume die normative Lage überlagerten.
Welche Rolle spielten Trauer und finanzielle Folgen für Witwen?
Die Untersuchung beleuchtet den gesellschaftlichen Umgang mit der Trauer sowie die oft schwierige finanzielle Situation von Hinterbliebenen im Kontext des griechischen Erbrechts.
- Quote paper
- Vanessa Anderson (Author), 2018, Die Stellung der Witwe im antiken Athen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1245149