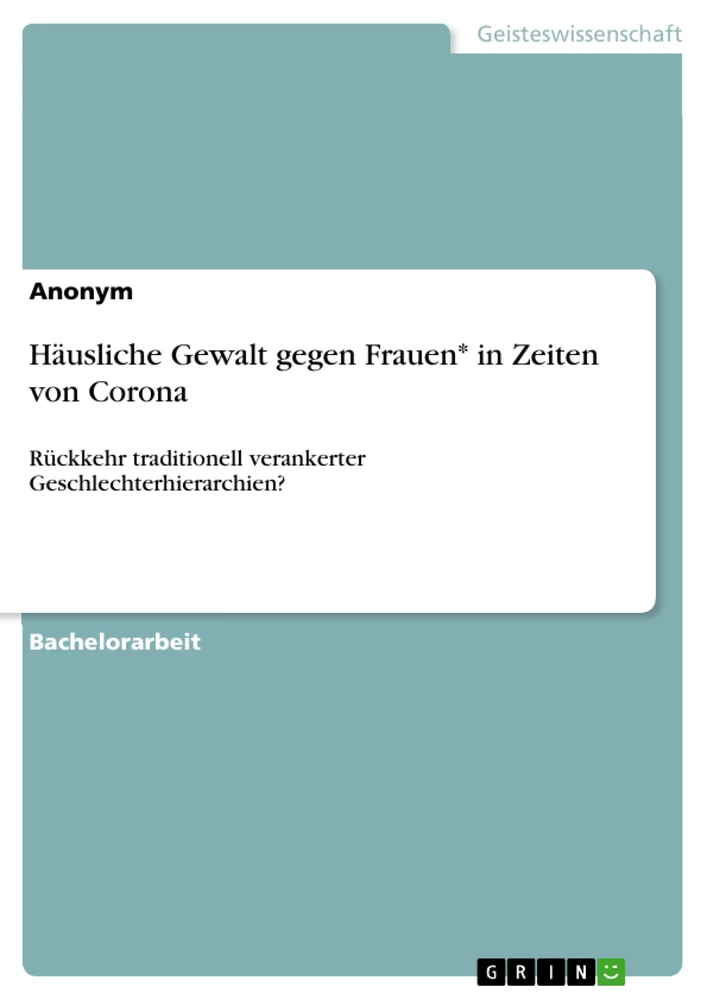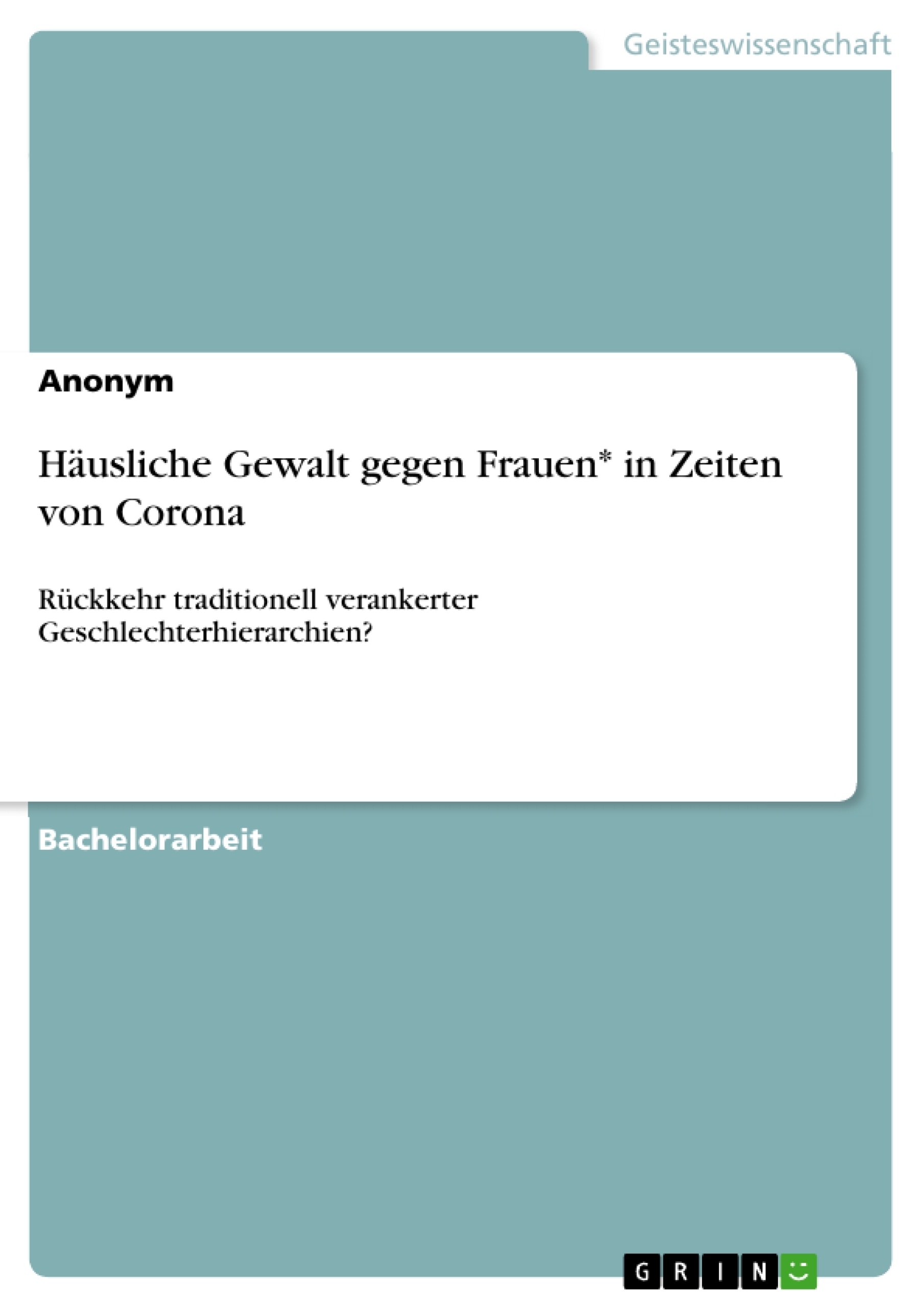Der Zusammenhang von häuslicher Gewalt gegen Frauen* und der Corona-Krise wurde bereits in kleinem Umfang erforscht, allerdings weist die Forschung Lücken auf. Aktuelle Studien und Angaben des Hilfetelefons gehen von einem Anstieg aus. Diese Arbeit beschäftigt sich daher thematisch mit häuslicher Gewalt gegen Frauen* während der Corona-Krise. Es wird Bezug auf die Relevanz und die Rückkehr tradierter Geschlechterhierarchien genommen.
Das Ziel ist es, herauszufinden, in welchem Ausmaß Frauen* Gewalt erleben, welche Rolle alte Geschlechterbilder spielen und inwiefern die Corona-Pandemie das Gewaltpotenzial verstärkt hat. Im Rahmen der Arbeit wird von cis-männlichen* und cis-weiblichen* Personen ausgegangen. Frauen* sind stärker von männlicher* Gewalt betroffen, nichtsdestoweniger sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass Männer sowie LQBT+ ebenso Opfer von häuslicher Gewalt werden. Häusliche und Partnerschaftsgewalt werden synonym verwendet. Die Arbeit bedient sich der Methode der Literaturrecherche.
Im ersten, theoretischen Teil wird das Verhältnis von Geschlecht, Gewalt und Gesellschaft analysiert. Kapitel 3 ist den Dimensionen häuslicher Gewalt gewidmet. Es erfolgt zunächst eine terminologische Klärung. Darauf aufbauend werden Formen, Ursachen und Folgen von Gewalt aufgegriffen. Im nächsten Kapitel werden die Auswirkungen der Pandemie auf die Gesellschaft und die Geschlechter beleuchtet. Kapitel 5 gibt einen Einblick in den Forschungsstand zu häuslicher Gewalt vor und während der Pandemie. Schließlich werden die gesammelten Fragmente zusammengeführt und diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Verhältnis von Geschlecht, Gewalt und Gesellschaft
- Geschlecht und Gewalt als Strukturzusammenhang
- Geschlechtsspezifische Sozialisation
- Traditionell verankerte Rollenbilder und Geschlechterhierarchien
- Hegemoniale Männlichkeit*
- Misogynie
- Dimensionen häuslicher Gewalt
- Definition häuslicher Gewalt
- Erscheinungsformen häuslicher Gewalt
- Physische Gewalt
- Psychische Gewalt
- Sexuelle Gewalt
- Soziale Gewalt
- Ökonomische Gewalt
- Ursachen häuslicher Gewalt
- Folgen häuslicher Gewalt
- Psychische Folgen
- Gesundheitliche Folgen
- Soziale Folgen
- Volkswirtschaftliche Folgen
- Gewaltspirale
- Auswirkungen der Pandemie auf die Geschlechter
- Stand der Forschung
- Zusammenführung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf häusliche Gewalt gegen Frauen*. Es werden die Relevanz und die Rückkehr tradierter Geschlechterhierarchien in diesem Zusammenhang analysiert. Ziel ist es, das Ausmaß an Gewalt, die Rolle von traditionellen Geschlechterbildern und die potenzielle Verstärkung des Gewaltpotenzials durch die Corona-Pandemie zu erforschen.
- Das Verhältnis von Geschlecht, Gewalt und Gesellschaft
- Dimensionen häuslicher Gewalt
- Auswirkungen der Pandemie auf die Geschlechter
- Der Einfluss von traditionellen Geschlechterrollen auf häusliche Gewalt
- Der Zusammenhang zwischen der Corona-Krise und einem möglichen Anstieg von Gewalt gegen Frauen*
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 analysiert das Verhältnis von Geschlecht, Gewalt und Gesellschaft, wobei verschiedene Aspekte wie geschlechtsspezifische Sozialisation, traditionelle Rollenbilder, hegemoniale Männlichkeit* und Misogynie beleuchtet werden. Kapitel 3 widmet sich den Dimensionen häuslicher Gewalt, inklusive Definition, Erscheinungsformen, Ursachen und Folgen. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Gesellschaft und die Geschlechter werden in Kapitel 4 untersucht. Kapitel 5 gibt einen Überblick über den Forschungsstand zu häuslicher Gewalt vor und während der Pandemie.
Schlüsselwörter
Häusliche Gewalt, Frauen*, Corona-Pandemie, Geschlechterhierarchien, traditionelle Rollenbilder, hegemoniale Männlichkeit*, Misogynie, Sozialisation, Pandemiefolgen, Forschung.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Häusliche Gewalt gegen Frauen* in Zeiten von Corona, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1245258