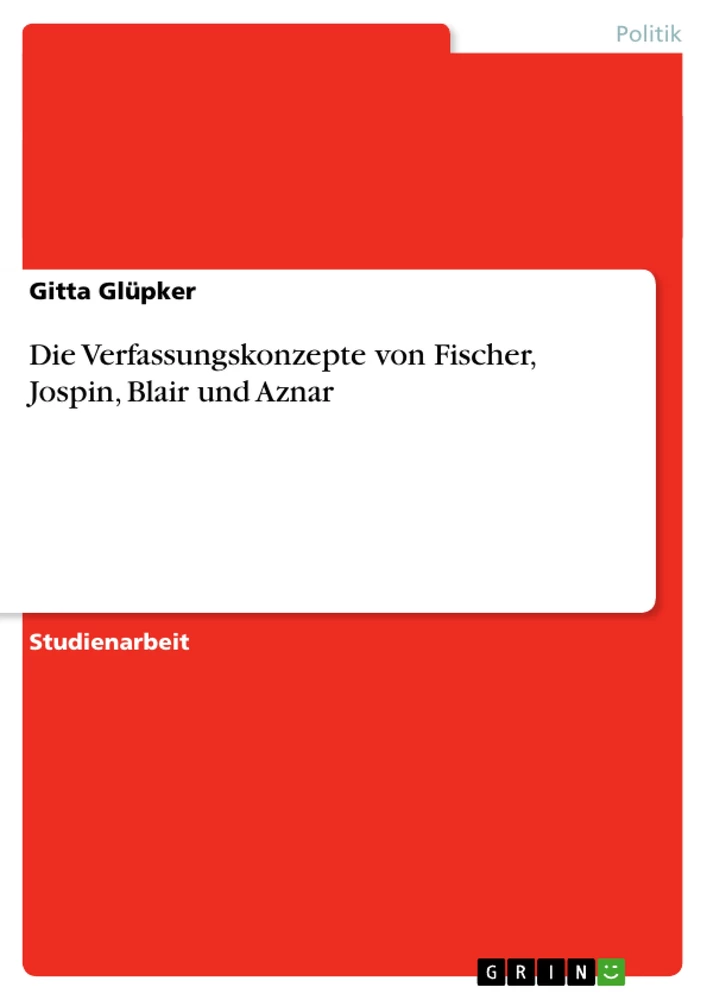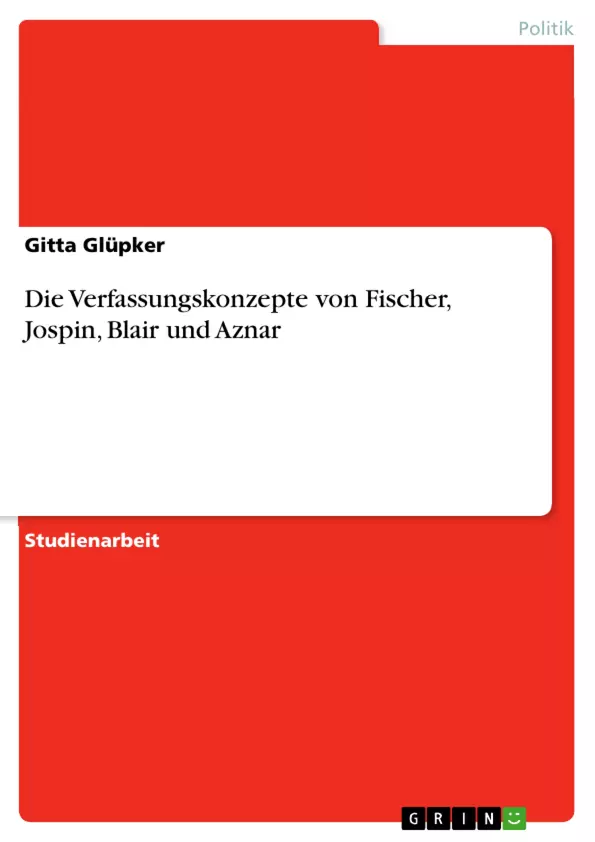Diese Frage formulierte der deutsche Außenminister Joschka Fischer im Mai 2000 im Rahmen einer Rede vor der Berliner Humboldt-Universität. Mit seiner persönlichen Antwort auf die offene Finalität des europäischen Integrationsprozesses gab er den Anstoß zu einer Debatte, die schließlich zum Verfassungsvertrag für die EU führte.
Sechs Monate zuvor hatten sich die europäischen Staatschefs in Helsinki darauf geeinigt, mit den osteuropäischen Staaten Beitrittsverhandlungen aufzunehmen. So war eine erweiterte EU zu erwarten und damit die Reform der Institutionen dringender als je zuvor – ohne dass sich die Europäer seit der Gründung der EGKS 1952 auf ein gemeinsames Endziel hatten einigen können.
Wo sollte sich die EU im Feld zwischen den Polen „Staatenbund“ und „Bundesstaat“ platzieren? Brauchten die Europäer eine gemeinsame Verfassung?
Mit der geplanten Osterweiterung, dem im Dezember 1999 begonnenen Konvent für die europäische Grundrechtecharta, dem letzten Treffen des Europäischen Rates im Februar 2000 in Nizza und der Rede Fischers gewann diese alte Problematik wieder an Aktualität.
Inhaltsverzeichnis
- ,,Quo vadis Europa?“.
- Die Verfassungskonzepte
- Joschka Fischer: ,,Vom Staatenbund zur Föderation - Gedanken über die Finalität der europäischen Integration“
- Tony Blair: ,,Europas Politische Zukunft“.
- Lionel Jospin: „Zukunft des erweiterten Europas“
- José María Aznar: „Europa war nie eine Föderation und wird niemals eine sein.“
- Vergleich der vier Verfassungskonzepte
- Das Europäische Parlament
- Der Europäische Rat und der Rat der EU
- Die Kommission
- Subsidiarität: Kompetenzverteilung zwischen der EU und den Nationalstaaten
- Verfassungsinhalt und -erarbeitung
- Die weitere Entwicklung der Verfassungsdebatte und ihr Ergebnis
- Reaktionen und Gegenentwürfe auf nationaler Ebene
- Die Entwicklung auf europäischer Ebene
- Die Reaktion der EU-Bürger: Der Ratifizierungsprozess
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verfassungskonzepte von Joschka Fischer, Tony Blair, Lionel Jospin und José María Aznar im Kontext der europäischen Integrationsdebatte um die Jahrtausendwende. Die Hauptaugenmerke liegen auf den Gemeinsamkeiten und Unterschieden der einzelnen Vorschläge und deren Einfluss auf den späteren Verfassungsvertrag der EU.
- Vergleich der Verfassungskonzepte der vier Politiker
- Analyse der jeweiligen Positionen zu zentralen EU-Institutionen
- Bewertung der Rolle der Subsidiarität
- Die Entwicklung der Verfassungsdebatte auf nationaler und europäischer Ebene
- Der Einfluss der vier Konzepte auf den finalen Verfassungsvertrag
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt die Ausgangslage der Debatte dar, initiiert durch Joschka Fischers Rede "Quo vadis Europa?". Kapitel zwei analysiert die individuellen Verfassungskonzepte von Fischer, Blair, Jospin und Aznar, wobei auf die jeweiligen Grundprinzipien und Unterschiede eingegangen wird. Kapitel drei vergleicht die vier Konzepte anhand verschiedener Kriterien wie die Rolle des Europäischen Parlaments, des Rates der EU und der Kommission sowie der Frage der Subsidiarität. Kapitel vier beleuchtet die weitere Entwicklung der Verfassungsdebatte, inklusive nationaler Reaktionen und der Entwicklung auf europäischer Ebene.
Schlüsselwörter
Europäische Integration, Verfassungskonzepte, Föderation, Staatenbund, Subsidiarität, Europäisches Parlament, Europäischer Rat, Kommission, Joschka Fischer, Tony Blair, Lionel Jospin, José María Aznar, Osterweiterung, Verfassungsvertrag.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Kern von Joschka Fischers Rede „Quo vadis Europa?“
Fischer plädierte für den Übergang vom Staatenbund zu einer europäischen Föderation mit einer eigenen Verfassung und einem klaren Endziel der Integration.
Wie unterschied sich Tony Blairs Vision von Fischers Konzept?
Blair sah Europa eher als ein Netzwerk von Nationalstaaten und lehnte ein föderales Modell („Superstaat“) ab, betonte jedoch die politische Handlungsfähigkeit.
Was forderte Lionel Jospin für die Zukunft der EU?
Jospin betonte die soziale Dimension und ein „Europa der Projekte“, wobei er die Rolle der Nationalstaaten als Träger der Legitimität hervorhob.
Welche Position vertrat José María Aznar?
Aznar war ein klarer Gegner der Föderalisierung; für ihn war und sollte Europa niemals eine Föderation sein, sondern ein Verbund souveräner Staaten.
Warum wurde die Verfassungsdebatte um das Jahr 2000 so aktuell?
Die geplante Osterweiterung der EU machte eine Reform der Institutionen und eine Klärung der Kompetenzverteilung (Subsidiarität) dringender als je zuvor.
- Quote paper
- B. A. Gitta Glüpker (Author), 2005, Die Verfassungskonzepte von Fischer, Jospin, Blair und Aznar, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124564