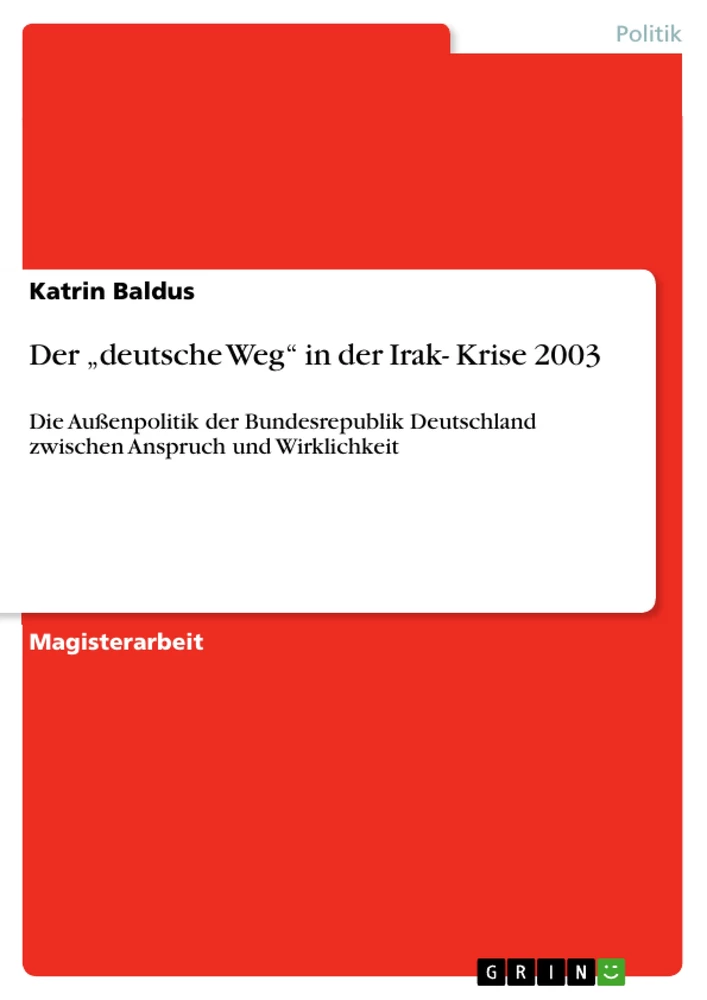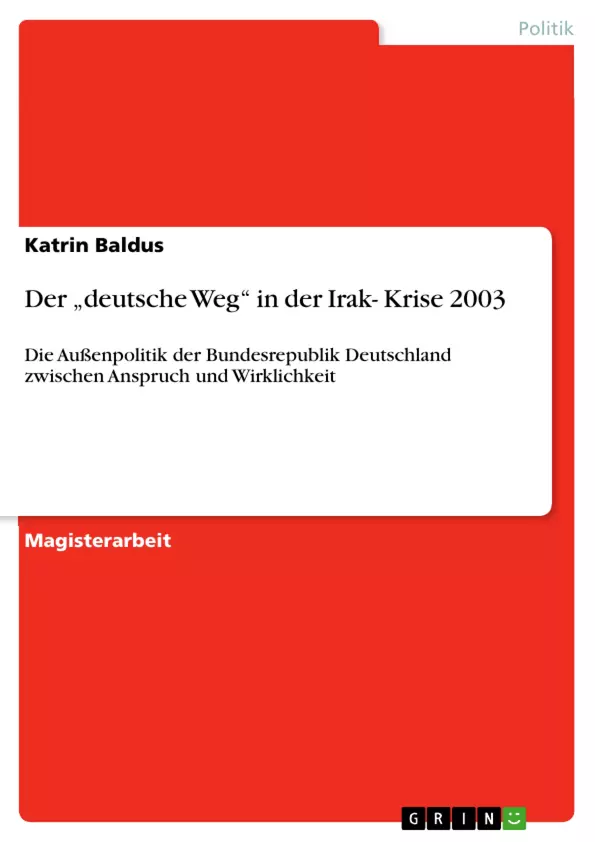I. Einleitung
1.Von der „gezähmten“ zur „normalen“ Nation – Eine Einführung
Das Ende des Kalten Krieges stellte die Weichen für eine neue Weltordnung, in der auch das wiedervereinigte Deutschland eine neue Rolle einnehmen sollte. Doch beides konfrontierte die internationale Staatengemeinschaft mit zahlreichen Fragen und Problemen. Nicht nur, dass die Proklamation einer „neuen Weltordnung“ seitens des amerikanischen Präsidenten George H. Bush zunächst nicht mit Inhalt gefüllt werden konnte , auch die deutsche Außenpolitik sah sich der Herausforderung gegenüber, einerseits den Forderungen des In- wie Auslands nach Übernahme größerer internationaler Verantwortung nachkommen zu wollen, und gleichzeitig die Befürchtungen bezüglich einer neuen „deutschen Gefahr“ zerstreuen zu müssen. So mannigfaltig die politikwissenschaftlichen Antworten auf die Frage waren, wie der neuen Welt(un)ordnung zu begegnen sei bzw. in welche Ordnung sie gebracht werden solle , so umfangreich war die Diskussion um die künftige deutsche Außenpolitik . Diese beiden Momente können jedoch nicht getrennt voneinander betrachtet werden. Die Wechselwirkung zwischen den internationalen Gegebenheiten und dem Handlungs- und Gestaltungsspielraum der Bundesrepublik sollte auch in der Ära nach dem Kalten Krieg fortbestehen. Damit einher ging die Frage nach der künftigen Gestaltung der internationalen Beziehungen. Hatte sich die NATO auf Grund ihres eigenen Erfolges überlebt, würden die USA als „lonely superpower“ über den „unipolaren Moment“ wachen und war die transatlantische Partnerschaft tatsächlich nur eine „Episode des Kalten Krieges“ , zusammengehalten durch die Klammer des gemeinsamen Feindes?
An dieser Stelle soll nicht der Versuch unternommen werden, einen Überblick über die ordnungs- und sicherheitspolitische Debatte zu Beginn der neunziger Jahre zu leisten. Vielmehr soll eine Sensibilisierung dafür geschaffen werden, vor welchem Hintergrund die Bundesrepublik die Neuausrichtung ihrer Außen- und Sicherheitspolitik bewältigen musste.[...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1. Von der „gezähmten“ zur „normalen“ Nation – Eine Einführung
- 2. Erkenntnisleitendes Interesse und Vorstellung der Gliederung
- 3. Forschungsstand und Literatur
- II. Die Auswirkungen des 11. September 2001 auf die Bundesrepublik Deutschland und die transatlantischen Beziehungen
- III. Kontinuität und Wandel der außenpolitischen Konzeption seit 1998
- 1. Leitlinien der rot-grünen Regierungskoalition bezüglich der Hauptbezugskreise deutscher Außenpolitik
- 2. Neues „Selbstbewusstsein“ oder alte „Selbstbeschränkung“? Das Selbstverständnis von Gerhard Schröder und Joschka Fischer
- IV. Bedrohungsperzeption der Bundesregierung
- V. „Foreign policy begins at home“ – Die Stimmung der deutschen Bevölkerung im Vorfeld des Irak-Krieges
- VI. Die deutsche Interessenlage in der Irak-Frage
- 1. Die Interessensetzung der Bundesregierung
- 2. Werte und Interessen: Kongruenz oder Konflikt?
- VII. Die Genese des „deutschen Weges“
- VIII. Die Auswirkungen des „deutschen Weges“ auf die maßgeblichen Bezugskreise deutscher Außenpolitik
- 1. „Coalition of the Unwilling“ anstatt prinzipieller Multilateralismus
- 2. Das Ende des transatlantischen Zeitalters?
- 2.1. Die deutsch-französische Kooperation
- 2.2. Von der uneingeschränkten Solidarität zur Gegenmachtbildung: die deutsche Politik gegenüber den USA
- 3. Nationalisierung oder Europäisierung: Der deutsche Weg und die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
- IX. Analyse der Interessenorientiertheit der deutschen Außenpolitik
- 1. Grundvoraussetzungen interessenorientierter deutscher Politik
- 2. Das Ende des „aufgeklärten Eigeninteresse“
- 2.1. Irrelevanz der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union
- 2.2. Die Distanzierung von den USA
- 2.3. Die Marginalisierung der Vereinten Nationen
- 3. Zwischenergebnis
- X. Der neue Primat der Innenpolitik: innerstaatliche Ursachen des „deutschen Weges“
- XI. Rhetorik und Diplomatie der Bundesregierung in der Irak-Krise
- 1. Stilistische Fehltritte als Ursache der transatlantischen Differenzen
- 2. Das Ende der deutschen Berechenbarkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die deutsche Außenpolitik während der Irak-Krise 2003 und analysiert den sogenannten „deutschen Weg“, der sich von der Politik anderer westlicher Staaten unterschied. Die Arbeit beleuchtet die komplexen Faktoren, die zu dieser Positionierung Deutschlands führten.
- Die Kontinuität und der Wandel der deutschen außenpolitischen Konzeption nach 1998
- Die Interessenlage Deutschlands in der Irak-Frage
- Die Auswirkungen des „deutschen Weges“ auf die Beziehungen zu den USA und Frankreich sowie zur EU
- Die Rolle innerstaatlicher Faktoren in der Gestaltung der deutschen Irak-Politik
- Die Analyse der Rhetorik und Diplomatie der Bundesregierung während der Krise
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Herausforderungen für die deutsche Außenpolitik nach dem Ende des Kalten Krieges. Kapitel II und III beleuchten die Auswirkungen des 11. Septembers und die außenpolitische Konzeption der rot-grünen Regierung. Kapitel IV bis VI behandeln die Bedrohungsperzeption der Bundesregierung, die Stimmung in der Bevölkerung und die deutschen Interessen in Bezug auf den Irak. Kapitel VII skizziert die Entstehung des „deutschen Weges“. Die Kapitel VIII und IX analysieren die Auswirkungen des „deutschen Weges“ auf die Beziehungen zu wichtigen Partnern und untersuchen die Interessenorientierung der deutschen Außenpolitik.
Kapitel X konzentriert sich auf innerstaatliche Ursachen des „deutschen Weges“, während Kapitel XI die Rhetorik und Diplomatie der Bundesregierung im Kontext der Krise untersucht.
Schlüsselwörter
Deutsche Außenpolitik, Irak-Krise 2003, „Deutscher Weg“, transatlantische Beziehungen, deutsch-französische Kooperation, Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), Multilateralismus, Interessenorientierung, Innenpolitik, Rhetorik, Diplomatie.
Häufig gestellte Fragen
Was wird unter dem „deutschen Weg“ in der Irak-Krise 2003 verstanden?
Der „deutsche Weg“ bezeichnet die spezifische außenpolitische Positionierung der Bundesrepublik Deutschland unter der rot-grünen Regierung, die sich 2003 gegen eine Teilnahme am Irak-Krieg entschied und damit einen eigenständigen Kurs einschlug.
Welche Rolle spielten Gerhard Schröder und Joschka Fischer in dieser Krise?
Die Arbeit untersucht das Selbstverständnis von Kanzler Schröder und Außenminister Fischer, wobei zwischen neuem „Selbstbewusstsein“ und traditioneller „Selbstbeschränkung“ in der deutschen Außenpolitik abgewogen wird.
Wie wirkte sich der „deutsche Weg“ auf die transatlantischen Beziehungen aus?
Die Krise führte zu einer deutlichen Distanzierung von den USA und markierte einen Wandel von uneingeschränkter Solidarität hin zu einer kritischeren Haltung und einer verstärkten Kooperation mit Frankreich.
Welchen Einfluss hatte die deutsche Bevölkerung auf die Entscheidung gegen den Krieg?
Unter dem Leitsatz „Foreign policy begins at home“ analysiert die Arbeit die Stimmung der Bevölkerung im Vorfeld des Krieges als maßgeblichen Faktor für die Regierungsentscheidung.
Was waren die Folgen für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) der EU?
Die Untersuchung zeigt eine zeitweise Irrelevanz der GASP auf, da Deutschland eher auf nationale Alleingänge oder bilaterale Kooperationen (wie mit Frankreich) setzte, anstatt auf einen rein multilateralen EU-Ansatz.
Wurde die deutsche Diplomatie während der Krise kritisiert?
Ja, die Arbeit thematisiert stilistische Fehltritte in der Rhetorik und Diplomatie der Bundesregierung, die zum Ende der deutschen Berechenbarkeit für internationale Partner beitrugen.
- Quote paper
- M.A. Katrin Baldus (Author), 2007, Der „deutsche Weg“ in der Irak- Krise 2003, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124594