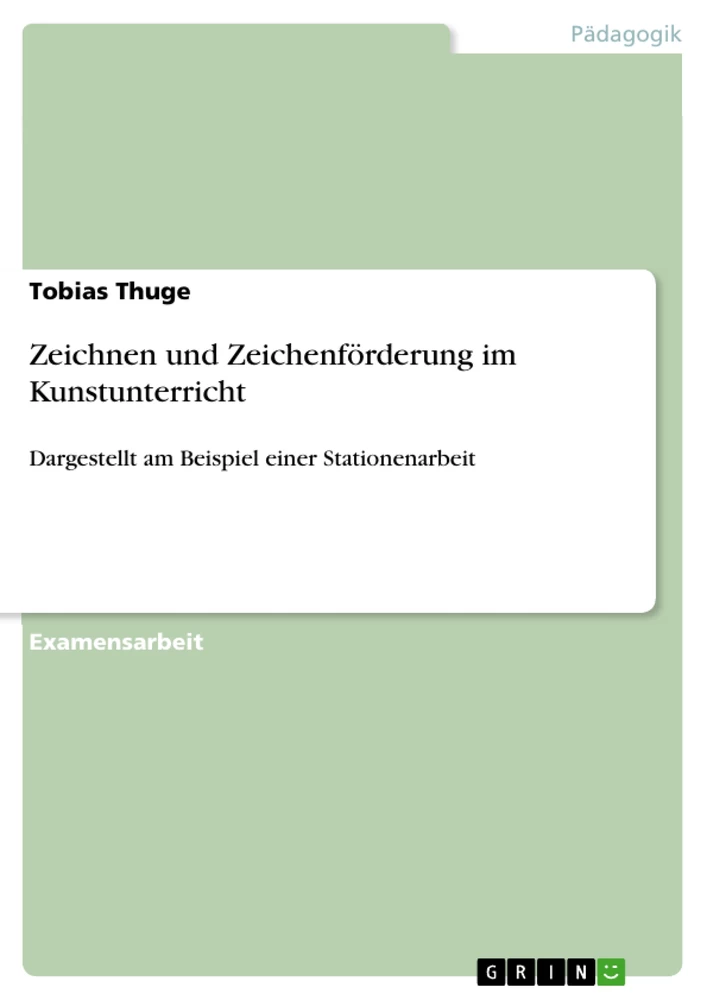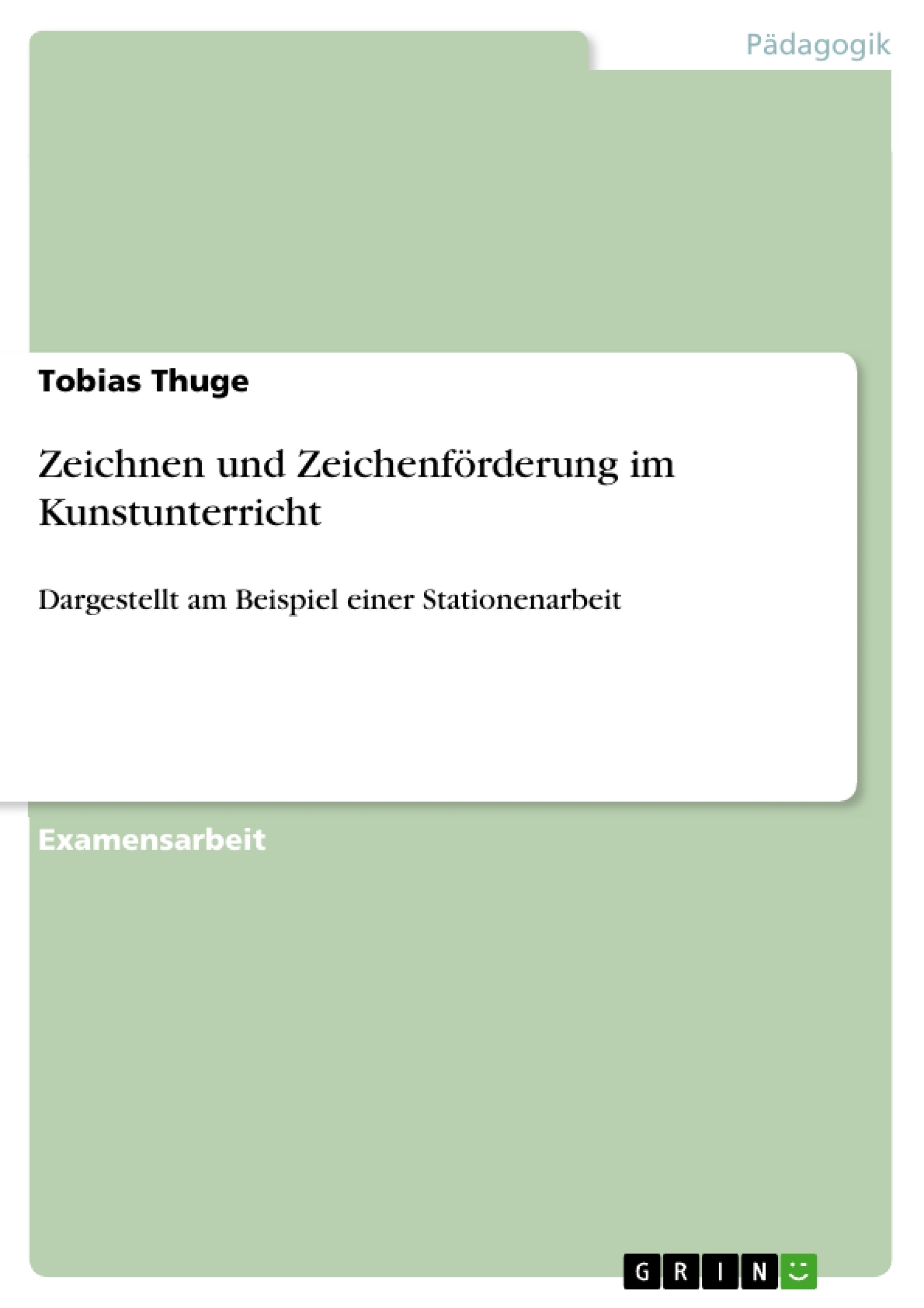Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, inwiefern im Rahmen des heutigen Kunstunterrichts die Möglichkeit besteht, eine grundlegende Kulturtechnik wie die Handzeichnung zu üben und als Mittel der (künstlerischen) Kommunikation bewusst zu machen. Ausgehend von einer Betrachtung der kulturgeschichtlichen Entwicklung der Zeichnung, ihrer Bedeutung im Rahmen pädagogischer Vermittlung sowie der Frage nach der Verankerung der Technik in aktuellen Curricula wird ein Konzept zur Zeichenförderung der US-amerikanischen Kunstpädagogin Judith M. Burton umfassend erläutert und auf schulische Praktikabilität untersucht. Hierzu beruft sich der Verfasser auf eigene Unterrichtseinheiten zur Handzeichnung, in welchen das Modell Burtons in methodisch abgewandelter Form zur Anwendung kam. Darauf aufbauend werden didaktisch-methodische Vorgehensweisen begründet, Vor- und Nachteile des beschriebenen Handelns abgewogen und exemplarische Ergebnisse aus Schülerarbeiten dokumentiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Forschungsstand und Literatur
- 2.1 Überblicksdarstellungen in kunstpädagogischer Literatur
- 2.2 Problemorientierte kunstpädagogische Literatur
- 3 Zur künstlerischen Technik des Zeichnens
- 3.1 Die Zeichnung als künstlerisches Medium
- 3.2 Die Zeichnung als (künstlerisches) Kommunikationsmittel
- 4 Zeichnen im Kunstunterricht
- 4.1 Ausgangslage – schulische Aspekte zur Förderung der Zeichenfähigkeit
- 4.1.1 Historischer Exkurs
- 4.1.2 Die Verankerung des Zeichnens in brandenburgischen Lehrplänen
- 4.1.3 Das Zeichnen und Aspekte der bildnerischen Entwicklung
- 4.2 Das Konzept der Zeichenförderung nach Judith M. Burton
- 4.1 Ausgangslage – schulische Aspekte zur Förderung der Zeichenfähigkeit
- 5 Zeichenförderung am Beispiel einer Stationenarbeit
- 5.1 Situative Voraussetzungen
- 5.2 Inhaltliche Entscheidungen
- 5.3 Methodische Entscheidungen
- 5.4 Verlaufsbeobachtungen
- 5.5 Ergebnisanalyse und konzeptionelle Kritik
- 6 Lehrerqualifikationen und Zeichenförderung
- 7 Abschließende Bemerkungen und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Stellenwert des Zeichnens im Kunstunterricht, insbesondere im Hinblick auf die Förderung der Zeichenfähigkeit bei Schülern. Sie analysiert den aktuellen Forschungsstand, die curriculare Verankerung des Zeichnens und die Herausforderungen der bildnerischen Entwicklung im Jugendalter. Ein konkretes Unterrichtskonzept, basierend auf der Arbeit von Judith M. Burton, wird vorgestellt und anhand einer durchgeführten Stationenarbeit evaluiert.
- Der Stellenwert des Zeichnens als künstlerisches Ausdrucksmittel
- Die kommunikativen Funktionen der Zeichnung
- Die curriculare Verankerung des Zeichnens in Brandenburgischen Lehrplänen
- Die Herausforderungen der Zeichenförderung im Jugendalter
- Evaluation eines praxisorientierten Unterrichtskonzepts zur Zeichenförderung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Zeichnens und der Zeichenförderung im Kunstunterricht ein und formuliert zentrale Forschungsfragen. Sie beleuchtet die Relevanz des Zeichnens in einer digitalisierten Welt und stellt die Bedeutung der handgefertigten Zeichnung in den Mittelpunkt. Die Arbeit kündigt ihre methodische Vorgehensweise an, die auf der Analyse von Fachliteratur und der Präsentation eines konkreten Unterrichtsansatzes beruht. Der Fokus liegt auf der Bedeutung des Zeichnens für die künstlerische Entwicklung und den schulischen Kontext.
2 Forschungsstand und Literatur: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die kunstpädagogische Literatur zum Thema Zeichnen. Es werden Überblicksdarstellungen und problemorientierte Arbeiten zu verschiedenen Aspekten wie der Funktion der Zeichnung im Unterricht, der Entwicklung des Zeichenunterrichts, der bildnerischen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie den Auswirkungen digitaler Medien auf das Zeichnen vorgestellt. Die Arbeit fokussiert auf aktuelle Tendenzen in der kunstpädagogischen Forschung und zeigt den Kontext der weiteren Arbeit auf.
3 Zur künstlerischen Technik des Zeichnens: Dieses Kapitel untersucht die Zeichnung als künstlerisches Medium und Kommunikationsmittel. Es analysiert die anthropologischen Grundlagen des Zeichnens und differenziert zwischen dem Zeichnen als handwerklicher Tätigkeit und dem schöpferischen Zeichnen aus der Imagination. Die Bedeutung der Reduktion und Abstraktion im Zeichnen wird hervorgehoben, sowie die Unmittelbarkeit und Spontaneität dieses Mediums. Der kommunikative Aspekt der Zeichnung wird umfassend erläutert, einschließlich ihrer Verwendung in verschiedenen Bereichen über die Kunst hinaus.
4 Zeichnen im Kunstunterricht: Dieses Kapitel befasst sich mit der Rolle des Zeichnens im schulischen Kontext. Es wird ein historischer Exkurs zum Zeichenunterricht gegeben, gefolgt von einer Analyse der curricularen Verankerung des Zeichnens in den brandenburgischen Lehrplänen der Primar- und Sekundarstufe. Die Kapitel beleuchten die Herausforderungen der bildnerischen Entwicklung im Jugendalter, insbesondere die „Krise“ in der Jugendzeichnung und führen zum Konzept der Zeichenförderung nach Judith M. Burton über.
5 Zeichenförderung am Beispiel einer Stationenarbeit: Dieses Kapitel beschreibt die Adaption und Umsetzung des Konzepts von Judith M. Burton in Form einer Stationenarbeit in zwei Schulklassen. Die situativen Voraussetzungen und die inhaltlichen Entscheidungen zur Gestaltung der Unterrichtseinheit werden detailliert dargestellt. Der methodische Ansatz, die Verlaufsbeobachtungen und eine kritische Ergebnisanalyse der Stationenarbeit werden vorgestellt. Die Arbeit reflektiert Stärken und Schwächen des Konzepts und gibt Ansatzpunkte für Verbesserungen.
6 Lehrerqualifikationen und Zeichenförderung: Dieses Kapitel beleuchtet den vorgestellten Unterrichtsansatz aus der Perspektive der Lehrerqualifikationen. Es werden die Aspekte des Unterrichtens und des Innovierens hervorgehoben und die Flexibilität des Konzepts in Bezug auf Anpassung an individuelle Lernumgebungen und -gruppen diskutiert. Das Kapitel zeigt Möglichkeiten auf, wie die Zeichenförderung langfristig im Kunstunterricht verbessert werden kann.
Schlüsselwörter
Zeichnen, Zeichenförderung, Kunstunterricht, Kunstpädagogik, bildnerische Entwicklung, Jugendzeichnung, Judith M. Burton, Stationenarbeit, Curricula, Lehrerqualifikation, digitale Medien, Kommunikation, künstlerischer Ausdruck.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Zeichenförderung im Kunstunterricht
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Stellenwert des Zeichnens im Kunstunterricht, insbesondere die Förderung der Zeichenfähigkeit bei Schülern. Sie analysiert den aktuellen Forschungsstand, die curriculare Verankerung des Zeichnens und die Herausforderungen der bildnerischen Entwicklung im Jugendalter. Ein konkretes Unterrichtskonzept, basierend auf der Arbeit von Judith M. Burton, wird vorgestellt und anhand einer durchgeführten Stationenarbeit evaluiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Forschungsstand und Literatur, Zur künstlerischen Technik des Zeichnens, Zeichnen im Kunstunterricht, Zeichenförderung am Beispiel einer Stationenarbeit, Lehrerqualifikationen und Zeichenförderung und Abschließende Bemerkungen und Fazit. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Zeichenförderung im Kunstunterricht.
Was wird im Kapitel "Forschungsstand und Literatur" behandelt?
Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die kunstpädagogische Literatur zum Thema Zeichnen. Es werden Überblicksdarstellungen und problemorientierte Arbeiten zu verschiedenen Aspekten wie der Funktion der Zeichnung im Unterricht, der Entwicklung des Zeichenunterrichts, der bildnerischen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie den Auswirkungen digitaler Medien auf das Zeichnen vorgestellt.
Wie wird die künstlerische Technik des Zeichnens betrachtet?
Das Kapitel "Zur künstlerischen Technik des Zeichnens" analysiert die Zeichnung als künstlerisches Medium und Kommunikationsmittel. Es untersucht die anthropologischen Grundlagen des Zeichnens, differenziert zwischen handwerklicher und schöpferischer Tätigkeit und betont die Bedeutung von Reduktion, Abstraktion, Unmittelbarkeit und Spontaneität. Der kommunikative Aspekt der Zeichnung wird umfassend erläutert.
Welche Rolle spielt das Zeichnen im Kunstunterricht?
Das Kapitel "Zeichnen im Kunstunterricht" behandelt die Rolle des Zeichnens im schulischen Kontext. Es beinhaltet einen historischen Exkurs, eine Analyse der curricularen Verankerung in brandenburgischen Lehrplänen und beleuchtet die Herausforderungen der bildnerischen Entwicklung im Jugendalter, insbesondere die „Krise“ in der Jugendzeichnung. Das Konzept der Zeichenförderung nach Judith M. Burton wird eingeführt.
Wie wird die Zeichenförderung konkret umgesetzt?
Im Kapitel "Zeichenförderung am Beispiel einer Stationenarbeit" wird die Adaption und Umsetzung des Konzepts von Judith M. Burton in Form einer Stationenarbeit in zwei Schulklassen beschrieben. Situative Voraussetzungen, inhaltliche und methodische Entscheidungen, Verlaufsbeobachtungen und eine kritische Ergebnisanalyse werden detailliert dargestellt.
Welche Bedeutung haben Lehrerqualifikationen für die Zeichenförderung?
Das Kapitel "Lehrerqualifikationen und Zeichenförderung" beleuchtet den Unterrichtsansatz aus der Perspektive der Lehrerqualifikationen. Aspekte des Unterrichtens und Innovierens sowie die Flexibilität des Konzepts werden diskutiert, und Möglichkeiten zur langfristigen Verbesserung der Zeichenförderung im Kunstunterricht werden aufgezeigt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Zeichnen, Zeichenförderung, Kunstunterricht, Kunstpädagogik, bildnerische Entwicklung, Jugendzeichnung, Judith M. Burton, Stationenarbeit, Curricula, Lehrerqualifikation, digitale Medien, Kommunikation, künstlerischer Ausdruck.
Welche methodische Vorgehensweise wird angewendet?
Die Arbeit beruht auf der Analyse von Fachliteratur und der Präsentation eines konkreten Unterrichtsansatzes. Der Fokus liegt auf der Bedeutung des Zeichnens für die künstlerische Entwicklung und den schulischen Kontext. Eine empirische Untersuchung in Form einer Stationenarbeit wird durchgeführt und evaluiert.
Welche zentralen Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht den Stellenwert des Zeichnens als künstlerisches Ausdrucksmittel, die kommunikativen Funktionen der Zeichnung, die curriculare Verankerung des Zeichnens in Brandenburgischen Lehrplänen, die Herausforderungen der Zeichenförderung im Jugendalter und evaluiert ein praxisorientiertes Unterrichtskonzept zur Zeichenförderung.
- Quote paper
- M.A. Tobias Thuge (Author), 2008, Zeichnen und Zeichenförderung im Kunstunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124645