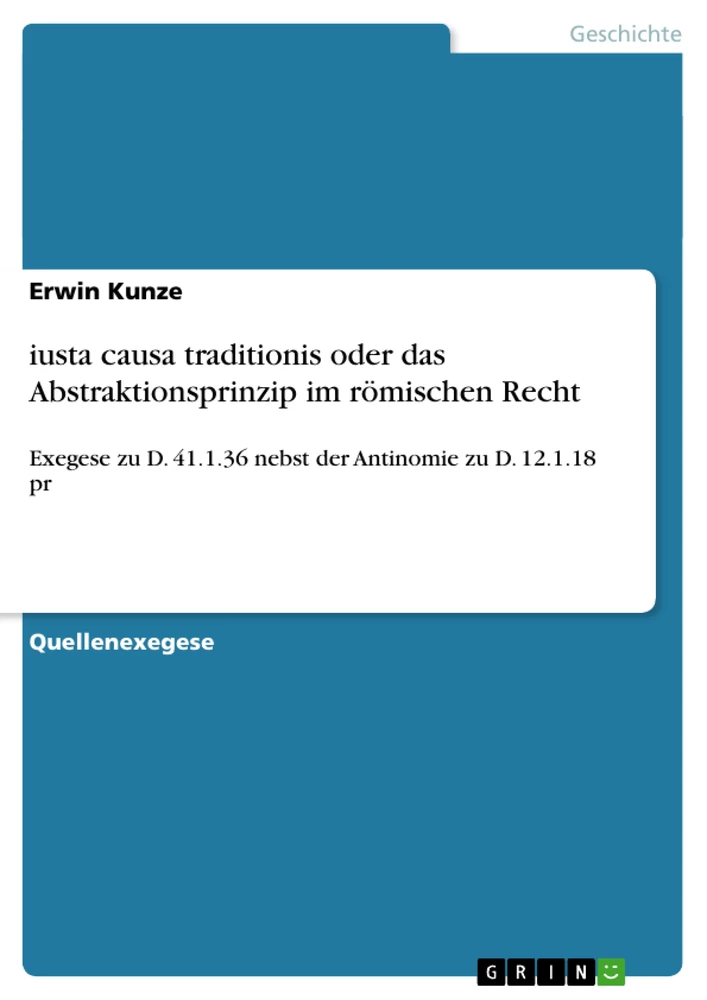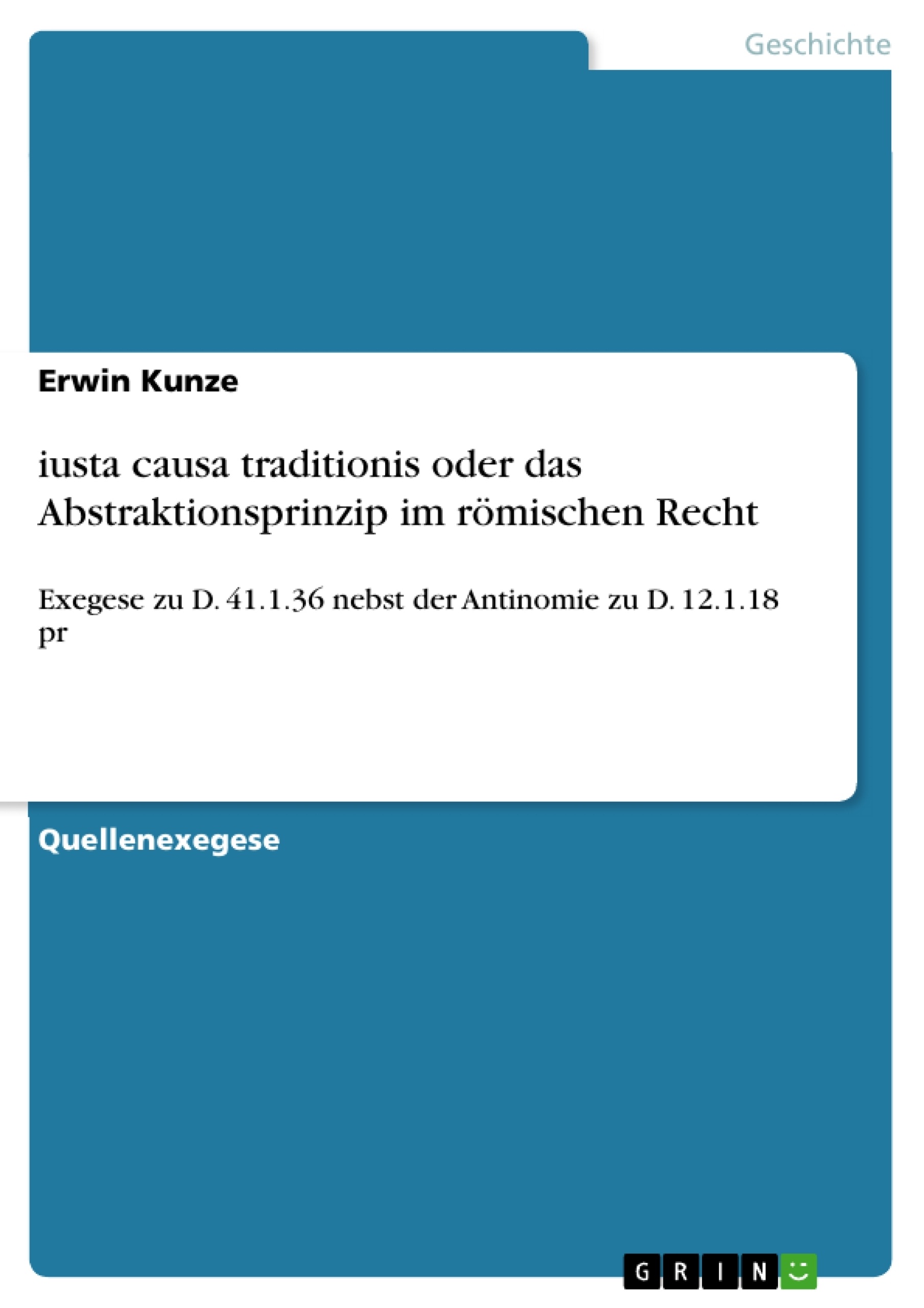Herkömmliche Exegese einer Quelle des römischen Rechts. Dem Leser wird der typische Aufbau einer Digestenexegese vermittelt.
Aus der Einleitung:
"In der zu behandelnden Textstelle Julian D.41.1.36 tritt ein bereits seit der Zeit der Glossatoren vieldiskutiertes Problem zu Tage, dessen Ursprung nicht zuletzt aus dem Übergang des streng formalen, altrömischen Rechtes (ius civile) hin zum modernen Wirtschaftsrecht der klassischen Zeit (ius gentium) resultiert: der derivative Erwerb von Eigentum an Sachen durch deren formlose Übergabe (traditio). War die traditio eine moderne Antwort der römischen Rechtsfortbildung auf die im rasch zunehmenden Wirtschaftsverkehr immer hinderlicher werdenden Formalgeschäfte (mancipatio, in iure cessio), so war für einen wirksamen Eigentumsübergang anders als im heutigen Recht nicht nur die sog. dingliche Einigung, sondern ein ebenso wirksamer Rechtsgrund, die causa erforderlich : Nunquam nuda traditio transferit dominium, sed ita, si venditio aut aliqua iusta causa praecesserit, propterquam traditio sequeretur. (D. 41.1.31.pr., Paul. 31. ad. ed.).
Auch das Erfordernis der sog. „iusta causa traditionis“ für die Übereignung unterlag jedoch einer rechtsgenetischen Bedeutungs- und Begriffsentwicklung und wurde, wie im Falle des behandelten Fragmentes, durchaus in Frage gestellt. So wird von Julian hinsichtlich zweier spezieller Fälle die Frage des dissensus (vel error) in causa aufgeworfen und – der klassischen Kasuistik der bonae fidei negotia entsprechend – in einer für die jeweilige Detailfrage brauchbaren, wenngleich unkonventionellen Weise beantwortet, was eine nähere Untersuchung verdient.
Im Zuge der rechtlichen Analyse des Textfragmentes soll ferner dem ebenso vieldiskutierten und widersprüchlichen Problem der Antinomie des Fragmentes zu D.12.1.18 (Ulp. 7. disp.) nachgegangen und unter Berücksichtigung der zahlreich anzutreffenden Lösungsansätze bedeutender Rechtswissenschaftler, nicht zuletzt auch der neueren Forschung ein eigener Interpretationsversuch unternommen werden. Abschließend soll das Fragment hinsichtlich seines Gehaltes und seiner Bedeutung rechtsvergleichend mit Blick auf die rechtsgeschichtliche Entwicklung sowie auf das geltende Recht untersucht werden."
Inhaltsverzeichnis
- I. Einführung
- II. Quellentext und Übersetzung von D.41.1.36
- 1. Text
- 2. Übersetzung
- III. Inskription
- 1. Salvius Iulianus
- a) Die römische Hochklassik
- b) Die Rechtsschule der Sabinianer
- 2. Herkunft des Fragments
- 1. Salvius Iulianus
- IV. Textkritik
- 1. Von der Spätklassik bis zur Neuzeit
- 2. Lenels Textkritik
- 3. Neuere Forschung
- V. Rechtliche Bedeutung
- 1. Sachverhalt
- a) Erster Fall - Vermächtnis und Stipulation
- b) Zweiter Fall - Schenkung und Darlehen
- c) Äquivalenz der Verpflichtungstitel
- 2. Rechtliche Interpretation
- 1. Sachverhalt
- VI. Rechtsentwicklung und -vergleichung
- 1. Die traditio und ihre causa in der Rechtsgeschichte
- a) Spät- und Nachklassik
- b) Mittelalter und frühe Neuzeit
- d) Das Abstraktionsprinzip der historischen Rechtsschule
- 2. Der derivative Eigentumserwerb im deutschen BGB
- a) Die Übereignung nach §§ 929 ff. BGB
- b) Regelungen im ABGB und im Code Civil
- d) Besonderheiten im angelsächsischen Recht
- 3. Überblick über das ausländische Recht
- a) Das Niederländische BGB
- b) Schweiz
- Moderne Kodifikation: das ZGB der russischen Föderation
- 4. Fazit
- 1. Die traditio und ihre causa in der Rechtsgeschichte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Exegese von D. 41.1.36 und untersucht das Abstraktionsprinzip im römischen Recht. Ziel ist es, die rechtliche Bedeutung des Fragments zu klären und seine Relevanz für die Rechtsentwicklung bis in die Gegenwart aufzuzeigen. Dabei wird auch die Antinomie zu D. 12.1.18 pr. beleuchtet.
- Das Abstraktionsprinzip im römischen Recht
- Die Interpretation von D. 41.1.36
- Die Rechtsentwicklung der traditio und ihrer causa
- Rechtsvergleichende Aspekte (deutsches BGB, ABGB, Code Civil, angelsächsisches Recht)
- Die Antinomie zu D. 12.1.18 pr.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einführung: Dieses einführende Kapitel legt den Grundstein für die gesamte Arbeit. Es beschreibt den Gegenstand der Untersuchung, nämlich die Exegese des Rechtsfragments D. 41.1.36, und skizziert den methodischen Ansatz. Es wird die zentrale Bedeutung des Abstraktionsprinzips im römischen Recht und seine Relevanz für die nachfolgende Rechtsentwicklung hervorgehoben. Die Einführung dient als Orientierungshilfe und gibt einen Überblick über die Struktur und den Inhalt der folgenden Kapitel.
II. Quellentext und Übersetzung von D.41.1.36: Dieses Kapitel präsentiert den lateinischen Originaltext von D. 41.1.36 und bietet eine sorgfältig erstellte deutsche Übersetzung. Die sorgfältige Präsentation des Quellenmaterials bildet die Grundlage für die anschließende rechtliche und historische Analyse. Der Vergleich von Text und Übersetzung ermöglicht ein tiefgreifendes Verständnis des Rechtsfragments und seiner möglichen Interpretationen.
III. Inskription: Das Kapitel befasst sich mit der Inskription des Fragments, insbesondere mit der Zuschreibung an Salvius Iulianus und seiner Einordnung in die römische Hochklassik und die Rechtsschule der Sabinianer. Die Herkunft des Fragments wird kritisch untersucht, um seine Authentizität und seinen historischen Kontext zu beleuchten. Diese Informationen sind essentiell für das Verständnis der historischen Entwicklung und der rechtlichen Argumentation des Fragments.
IV. Textkritik: Hier wird die Entstehungsgeschichte des Textes von der Spätklassik bis zur Neuzeit nachvollzogen und die Arbeit verschiedener Textkritiker, insbesondere Lenels, analysiert und bewertet. Das Kapitel widmet sich den Herausforderungen der Textrekonstruktion und der unterschiedlichen Interpretationen des Rechtsfragments aufgrund von möglichen Textvarianten. Die Diskussion der neueren Forschung zu D.41.1.36 rundet den Abschnitt ab.
V. Rechtliche Bedeutung: In diesem zentralen Kapitel wird die rechtliche Bedeutung von D. 41.1.36 eingehend untersucht. Es werden die relevanten Sachverhalte analysiert, insbesondere die Fälle von Vermächtnis und Stipulation sowie Schenkung und Darlehen. Die Äquivalenz der Verpflichtungstitel wird diskutiert. Die rechtliche Interpretation des Fragments bildet den Schwerpunkt, wobei die Konzepte von Eigentum, Übereignung und iusta causa traditionis im römischen Recht im Detail erläutert werden. Julians Lösung des Problems des dissensus (oder Irrtums) in causa wird analysiert und im Kontext der Antinomie zu D. 12.1.18 pr. betrachtet.
VI. Rechtsentwicklung und -vergleichung: Abschließend wird die Entwicklung der traditio und ihrer causa in der Rechtsgeschichte von der Spät- und Nachklassik über das Mittelalter und die frühe Neuzeit bis hin zum Abstraktionsprinzip der historischen Rechtsschule betrachtet. Der Vergleich mit dem deutschen BGB, dem ABGB, dem Code Civil und dem angelsächsischen Recht verdeutlicht die langfristige Relevanz des römischen Rechtsprinzips. Der Abschnitt bietet einen umfassenden Überblick über die internationale Rezeption des Abstraktionsprinzips.
Schlüsselwörter
iusta causa traditionis, Abstraktionsprinzip, römisches Recht, D. 41.1.36, D. 12.1.18 pr., Salvius Iulianus, Eigentumserwerb, traditio, Rechtsgeschichte, Rechtsvergleichung, deutsches BGB, ABGB, Code Civil, angelsächsisches Recht, Textkritik.
Häufig gestellte Fragen zu: Exegese von D. 41.1.36 und das Abstraktionsprinzip im römischen Recht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit befasst sich mit der eingehenden Analyse des römischen Rechtsfragments D. 41.1.36 und untersucht das darin zum Ausdruck kommende Abstraktionsprinzip. Der Fokus liegt auf der Klärung der rechtlichen Bedeutung des Fragments und seiner Auswirkungen auf die Rechtsentwicklung bis in die Gegenwart.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das Abstraktionsprinzip im römischen Recht, die Interpretation von D. 41.1.36, die Rechtsentwicklung der traditio und ihrer causa, rechtsvergleichende Aspekte (deutsches BGB, ABGB, Code Civil, angelsächsisches Recht), und die Antinomie zu D. 12.1.18 pr. Es werden der lateinische Originaltext und dessen Übersetzung präsentiert, die Textkritik beleuchtet und die rechtliche Bedeutung des Fragments im Detail analysiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einführung, Quellentext und Übersetzung von D. 41.1.36, Inskription (Salvius Iulianus und die Herkunft des Fragments), Textkritik, Rechtliche Bedeutung (inkl. Analyse der Sachverhalte und rechtlicher Interpretation), und Rechtsentwicklung und -vergleichung (inkl. Vergleich mit verschiedenen Rechtssystemen).
Wer ist Salvius Iulianus und welche Rolle spielt er?
Salvius Iulianus war ein bedeutender römischer Jurist der Hochklassik. Die Arbeit untersucht die Zuschreibung des Fragments D. 41.1.36 an ihn und ordnet ihn in den Kontext der Rechtsschule der Sabinianer ein. Seine Rolle ist essentiell für die Einordnung des Fragments in die historische Entwicklung des römischen Rechts.
Was ist das Abstraktionsprinzip im römischen Recht?
Das Abstraktionsprinzip im römischen Recht ist ein zentrales Thema der Arbeit. Es wird untersucht, wie dieses Prinzip in D. 41.1.36 zum Ausdruck kommt und welche Bedeutung es für die Entwicklung des Eigentumsrechts hat. Der Vergleich mit modernen Rechtssystemen zeigt die anhaltende Relevanz dieses Prinzips.
Welche Rechtsordnungen werden im rechtsvergleichenden Teil betrachtet?
Die Arbeit vergleicht das römische Recht mit dem deutschen BGB, dem österreichischen ABGB, dem französischen Code Civil und dem angelsächsischen Recht. Dies dient dazu, die langfristige Relevanz des in D. 41.1.36 behandelten Prinzips und dessen Auswirkungen auf die moderne Rechtsprechung zu verdeutlichen.
Welche Bedeutung hat die Antinomie zu D. 12.1.18 pr.?
Die Arbeit beleuchtet die Antinomie zwischen D. 41.1.36 und D. 12.1.18 pr., um die Komplexität der rechtlichen Argumentation und die unterschiedlichen Interpretationen des Abstraktionsprinzips zu diskutieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: iusta causa traditionis, Abstraktionsprinzip, römisches Recht, D. 41.1.36, D. 12.1.18 pr., Salvius Iulianus, Eigentumserwerb, traditio, Rechtsgeschichte, Rechtsvergleichung, deutsches BGB, ABGB, Code Civil, angelsächsisches Recht, Textkritik.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung, gefolgt von der Präsentation des Quellentextes und der Übersetzung. Die Inskription und Textkritik werden anschließend behandelt, bevor die rechtliche Bedeutung im Detail analysiert und im rechtsvergleichenden Teil in den Kontext anderer Rechtsordnungen eingeordnet wird.
- Citar trabajo
- Dipl.-Jurist Univ. Erwin Kunze (Autor), 2006, iusta causa traditionis oder das Abstraktionsprinzip im römischen Recht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124721