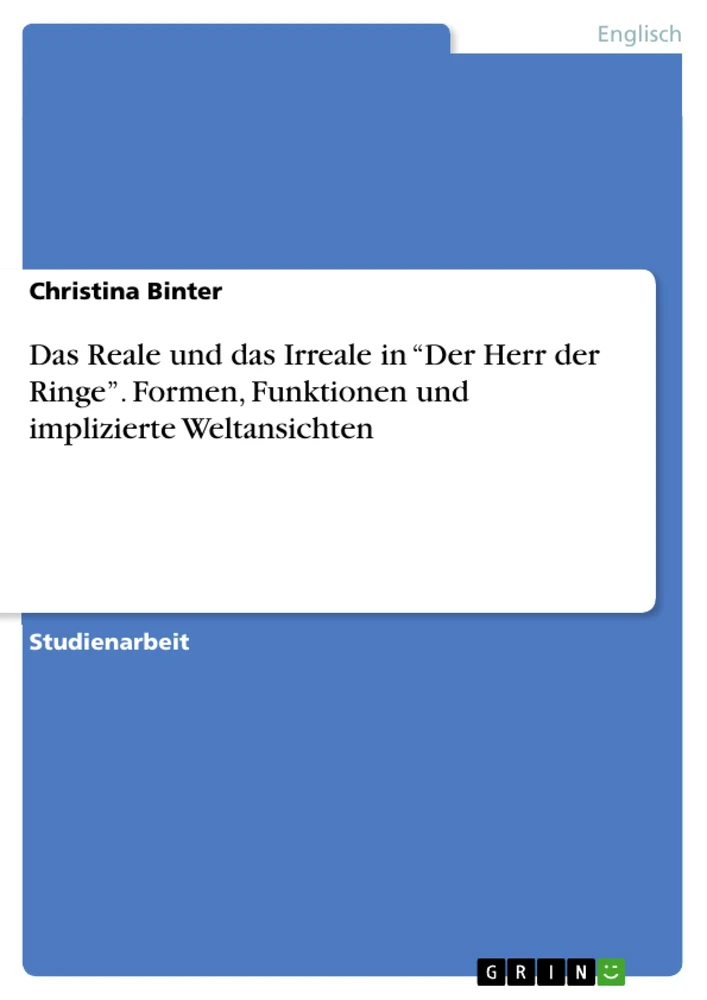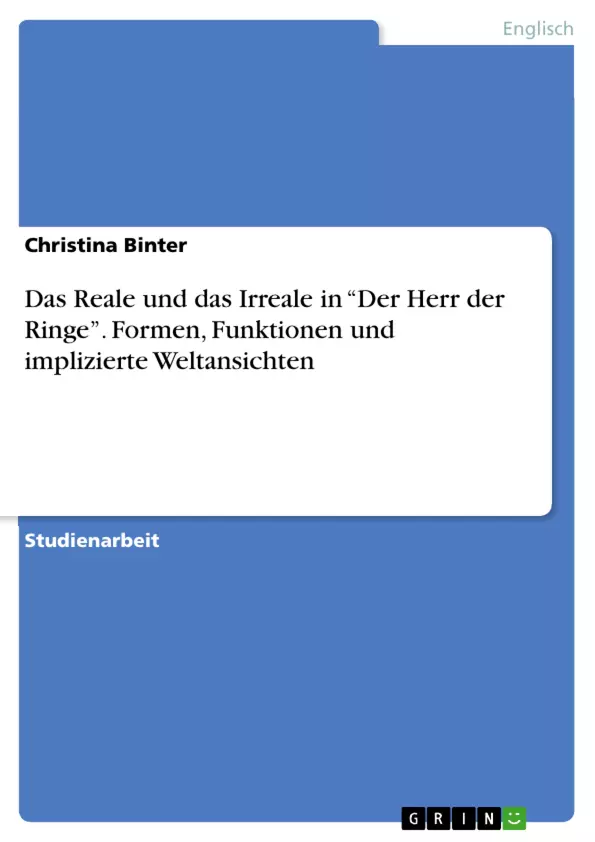Durch die vorliegende Arbeit mit dem Titel „Das "Reale" und das "Irreale" in “Der Herr der Ringe” – Formen, Funktionen und implizierte Weltansichten“ wird J. R. R. Tolkiens Trilogie „Herr der Ringe“ analysiert. Der Fokus der Analyse liegt dabei auf der Unterscheidung zwischen realitätsherstellenden und realitätsbrechenden Mechanismen, wie diese erreicht werden, und welche Wirkung sie auf die Rezipienten haben. Außerdem wird versucht, die enthaltenen Weltansichten der Erzählung darzustellen.
Aus diesem Grund wird zuerst eine literarische Einordnung des Werkes angestrebt, bevor die beiden Definitionen „Phantastische Literatur“ und „Realismus“ geklärt werden. Anschließend sollen werden realistische Funktionen in der phantastischen Literatur näher beschrieben, wobei sich die Strategien zur Realitätsherstellung unter anderem auf Christine Brooke-Roses (1981) Theorie aus „A rhetoric of the unreal“ beziehen, die wiederum auf die Auslegungen von Hamons „Fifteen procedures of realism“ und Tzvetan Todorov zurückgreift.
In Bezug darauf wird schließlich anhand einer narrativen Textanalyse versucht, realistische Prozeduren in der „Herr der Ringe“-Trilogie schrittweise zu untersuchen. Anhand diverser Textpassagen und Beispielen aus den drei Bänden soll dies anschaulicher und besser verdeutlicht werden. Daher wird die Arbeit in zwei große Hauptteile gegliedert. Einerseits wird eine Analyse des „Level of histoire“ vorgenommen, wobei räumliches und zeitliches Setting, die Handlung, die Figuren sowie die Figurenkonstellation des Textes genauestens untersucht werden. Andererseits findet eine Analyse des „Level of discours“ statt. Hierbei werden zuerst die Erzählsituation, -form und –perspektive beleuchtet. In einem nächsten Schritt sollen dann realistische Prozeduren im Hinblick auf Erzählzeit und erzählter Zeit aufgedeckt werden. Anschließend sollen auch die Ebene des Klanges, der Morphologie, der Syntax und der Semantik analysiert werden, denn auch dort sind bestimmt einige Techniken und Funktionen vorzufinden, die das Werk Tolkiens authentischer wirken lassen. Schlussendlich werden in einer Konklusion die wichtigsten Erkenntnisse festgehalten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Literarische Einordnung von „Herr der Ringe“
- Definition „Phantastische Literatur“
- Definition „Realismus“
- Realismus in Phantastischer Literatur
- Analyse des „Level of histoire“
- Räumliches Setting
- Zeitliches Setting
- Handlung
- Figuren
- Figurenkonstellation
- Analyse des „Level of discours“
- Erzählsituation und Erzählform
- Erzählperspektive
- Erzählzeit und Erzählte Zeit
- Ebene des Klanges
- Ebene der Morphologie
- Ebene der Syntax
- Ebene der Semantik
- Conclusio
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert J. R. R. Tolkiens Trilogie „Herr der Ringe“ und untersucht die Unterscheidung zwischen realitätsherstellenden und realitätsbrechenden Mechanismen. Außerdem wird versucht, die enthaltenen Weltansichten der Erzählung darzustellen.
- Literarische Einordnung von „Herr der Ringe“
- Definitionen von „Phantastische Literatur“ und „Realismus“
- Realismus in phantastischer Literatur
- Analyse des „Level of histoire“ und „Level of discours“
- Implizierte Weltansichten in Tolkiens Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die Zielsetzung der Arbeit vor. Das zweite Kapitel befasst sich mit der literarischen Einordnung von Tolkiens Werk, indem es die Begriffe „Phantastische Literatur“ und „Realismus“ definiert. Anschließend wird die Frage beleuchtet, wie realistische Funktionen in der phantastischen Literatur zum Tragen kommen. In Kapitel 4 wird die Analyse des „Level of histoire“ durchgeführt, wobei räumliches und zeitliches Setting, die Handlung, die Figuren sowie die Figurenkonstellation untersucht werden. Kapitel 5 widmet sich der Analyse des „Level of discours“, wobei die Erzählsituation, -form und -perspektive beleuchtet werden. Anschließend werden realistische Prozeduren im Hinblick auf Erzählzeit und erzählter Zeit aufgedeckt sowie die Ebene des Klanges, der Morphologie, der Syntax und der Semantik analysiert.
Schlüsselwörter
Phantastische Literatur, Realismus, „Herr der Ringe“, J.R.R. Tolkien, Level of histoire, Level of discours, Weltansichten, Erzähltheorie, literarische Analyse.
Häufig gestellte Fragen
Wie schafft Tolkien Realität in einer phantastischen Welt?
Durch realitätsherstellende Mechanismen wie detaillierte räumliche Settings, komplexe Figurenkonstellationen und eine konsistente Morphologie und Syntax.
Was ist der Unterschied zwischen "Level of histoire" und "Level of discours"?
Histoire bezieht sich auf die erzählte Welt (Handlung, Figuren), während Discours die Art und Weise der Erzählung (Perspektive, Zeitstruktur) beschreibt.
Welche Weltansichten sind im "Herr der Ringe" impliziert?
Die Arbeit analysiert die zugrunde liegenden moralischen und philosophischen Konzepte, die Tolkiens Werk seine Tiefe und Authentizität verleihen.
Warum wirkt die Welt von Mittelerde so authentisch?
Aufgrund realistischer Prozeduren, die Tolkien auf Ebenen des Klanges, der Semantik und der Erzählzeit anwendet, um die "Irrealität" glaubwürdig zu machen.
Was ist "Phantastische Literatur" laut dieser Analyse?
Ein Genre, das Elemente des Realismus nutzt, um das Unmögliche innerhalb einer fiktiven Logik als wahr darzustellen.
- Quote paper
- Christina Binter (Author), 2021, Das Reale und das Irreale in “Der Herr der Ringe”. Formen, Funktionen und implizierte Weltansichten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1247273