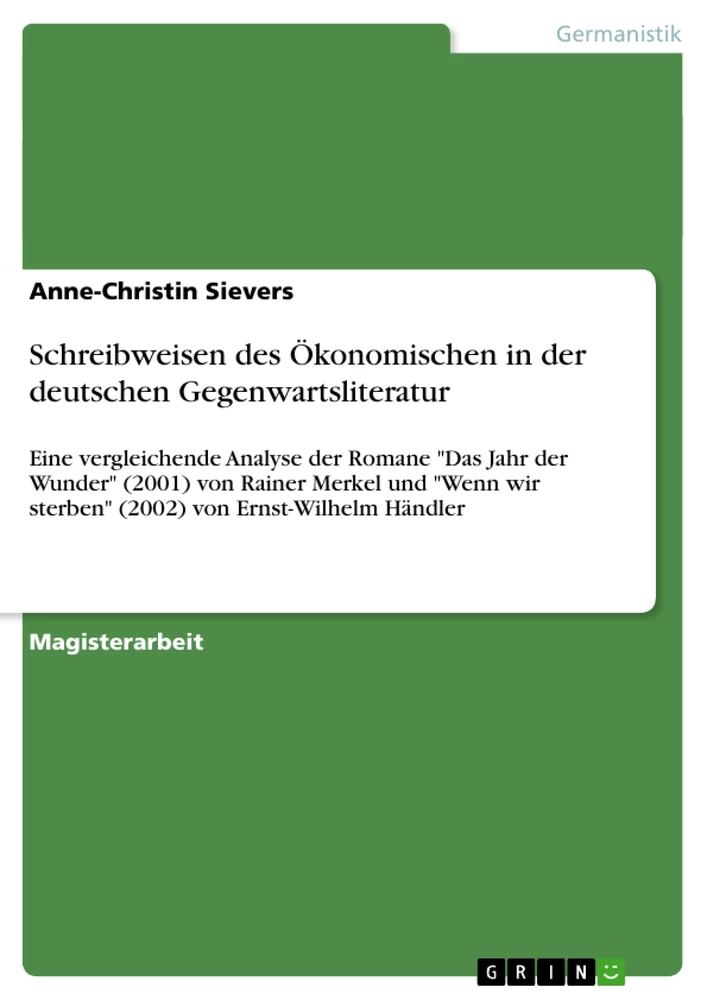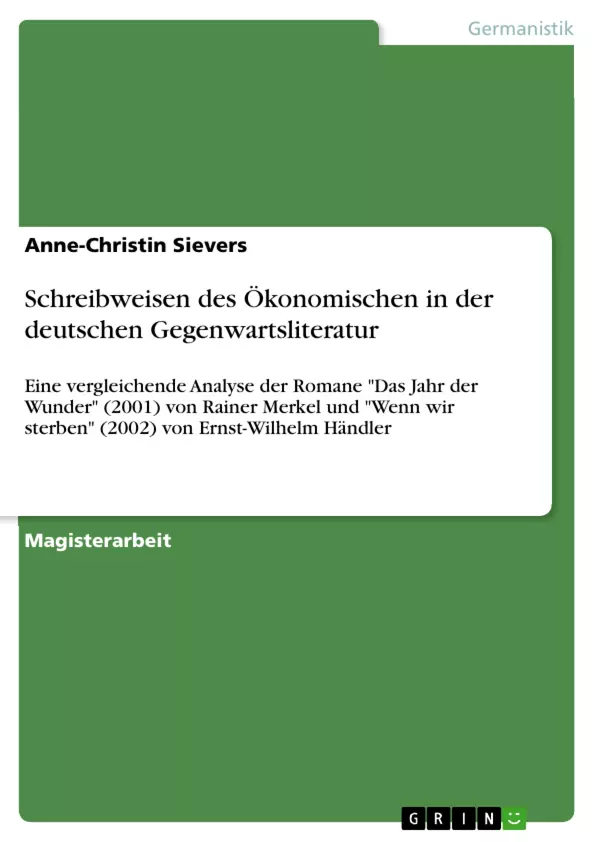Die Arbeit beschäftigt sich mit den vielfältigen Austauschprozessen zwischen ökonomischen und literarischen Diskursen am Beispiel der Romane "Das Jahr der Wunder" (2001) von Rainer Merkel und "Wenn wir sterben" (2002) von Ernst-Wilhelm Händler. Sie stellt die These auf, dass in der Literaturlandschaft seit Mitte der neunziger Jahre vermehrt Texte zum Vorschein treten, die der Wirtschaftswelt und ihren Sprech- und Wahrnehmungsweisen neue Aufmerksamkeit schenken und die gegenüber den eher marxistisch geprägten, literarischen Auseinandersetzung mit dem Ökonomischen in den siebziger Jahren auch literarisch-formal einen neuen, ambivalenteren Umgang mit dem ökonomischen Feld anstreben. Händlers und Merkels Texte bilden paradigmatische Fälle für dieses Phänomen.
In einem methodischen Teil wird zunächst über die theoretischen Voraussetzungen reflektiert, auf deren Grundlage Parallelen zwischen Narration, Metaphern und sprachlichen Zeichen einerseits und der Logik monetärer Zeichen, der Ökonomie und des Tausches andererseits ausgemacht werden können. Der literarische Text wird in Anlehnung an den "New Historicism" als ein aus ökonomischen Diskursfäden gebildetes Gewebe erkennbar, das durch die Aneignung ökonomischer Sprechformationen und Theorien ein poetologisches Wissen über das Wirtschaftliche hervorbringt. Als theoretische Grundlagen dienen des Weiteren der amerikanische Forschungsansatz des "New Economic Criticism" (Woodmansee, McCloskey), der als interdisziplinärer Zugang den Dialog zwischen Wirtschafts- und Literatur- bzw. Kulturwissenschaften befördert, sowie Simmels Begriff des Monetären in seiner "Philosophie des Geldes".
Bei der Analyse der Romane stehen zwei Fragen im Mittelpunkt, die sich dialektisch von zwei verschiedenen Perspektiven aus ergänzen:
1) Inwiefern beeinflusst die Auseinandersetzung mit dem wirtschaftlichen Diskurs in der Literatur das poetische Verfahren beider Texte und inwiefern können ökonomische Theorien und Konzepte für die Beschreibung der literarischen Strategien fruchtbar gemacht werden?
2) Wie werden im Gegenzug die Wirtschaftswelten der Romane durch literarische Strategien ästhetisiert? Und inwiefern lässt die Poesie durch diese Ästhetisierung des Ökonomischen die fiktionale, imaginäre Potentialität der Wirtschaft und des Geldes hervortreten und produziert somit ein spezifisch literarisches Wissen über wirtschaftliche Zusammenhänge?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Methodologie und Vorstellung der Romane
- 2.1 Methodologische Vorbemerkungen: Zum Verhältnis von Ökonomie und Literatur
- 2.2 Biographische Bezüge, Forschungsstand und Vorstellung der Romane
- 3 Wirtschaft als Erzählung und ökonomische Kodierung des Poetischen: Das dialektische Verhältnis von Ökonomie und Literatur auf der Ebene des Erzählten
- 3.1 Wirtschaft als Erzählung
- 3.1.1 Narrative Momente des Ökonomischen auf der inhaltlichen Ebene
- 3.1.2 Deirdre McCloskeys Storytelling in Economics
- 3.1.3 Fiktionalität von materieller und immaterieller Ökonomie
- 3.2 Ökonomische Kodierung des Poetischen
- 3.2.1 Werttheorie in Simmels Philosophie des Geldes und in der Neoklassik
- 3.2.2 Ökonomische Durchdringung literarischer Medien
- 3.2.2.1 Tagebuch und Subjektdiskurs
- 3.2.2.2 Zwischenmenschliche Kommunikation und Intersubjektivitätsdiskurs
- 3.2.3 Auswege aus der ökonomischen Logik? Gesellschaftlicher Ausstieg und Tod
- 3.2.3.1 Am Rand der Tanzfläche: Gesellschaftlicher Ausstieg
- 3.2.3.2 „Man fällt einfach fürs öffentliche Leben aus.“: Tod, Blut und Geld
- 3.1 Wirtschaft als Erzählung
- 4 Von Ökonomie erzählen: Poetische Verfahren
- 4.1 „[I]n der Luft gehen“: Poetische Aneignungsstrategien, monetäre Semiotik und literarische Selbstverzinsung in Händlers Roman Wenn wir sterben
- 4.1.1 Ökonomische, monetäre Strukturierung des Romanverfahrens
- 4.1.1.1 Metareflexive Aneignung verschiedener Sprachstile
- 4.1.1.2 Schlafender und Wächter zugleich: Erzähltheoretische Analyse der Instanz Wir
- 4.1.1.3 Poetische und pekuniäre Semiotik
- 4.1.2 Verschwendungslogik und Ästhetisierung der Wirtschaft
- 4.1.2.1 Umschlag der ökonomischen Aneignungsstrategie und monetären Semiotik in poetische Verschwendung
- 4.1.2.2 Der Leser als Ethnograph und die Ästhetisierung ökonomischer Diskurse
- 4.1.2.3 „[G]rundsätzlich [hängt] alles von allem ab“: Die Theorie der rationalen Erwartung als Reflexionsmedium des dialektischen Romanverfahrens
- 4.1.1 Ökonomische, monetäre Strukturierung des Romanverfahrens
- 4.2 „Saint-Exupéry und seine ganz spezielle märchenhafte Logik mit den Anforderungen von Lipinski [...] verbinden“: Ironische Brechungen, Märchentopoi und Verschwendung in Merkels Roman Das Jahr der Wunder
- 4.2.1 Ökonomische, monetäre Strukturierung des Romanverfahrens
- 4.2.1.1 „Natürlich ist [das Konzept] auch ein bisschen ironisch gemeint“: Rollenprosa und ironische Brechungen
- 4.2.1.2 „Ich glaube, dass die Unterschiede nicht so groß [sind]“: Ästhetische und zeichentheoretische Implikationen der monetären Logik
- 4.2.2 Verschwendungslogik und Ästhetisierung der Wirtschaft
- 4.2.2.1 Der ethnographische Blick des Christian Schlier
- 4.2.2.2 Märchenhafte Logik und Geschichten für kleine Jungs: Intertextuelle Bezüge
- 4.2.2.3 Zu wenig Sekt und zu viel Trinkgeld: Das dialektische Verhältnis zwischen wirtschaftlicher Knappheit und maßloser Fülle
- 4.2.1 Ökonomische, monetäre Strukturierung des Romanverfahrens
- 4.3 Die fiktionale Potentialität des Monetären: Simmels, Superadditum des Geldes’ und seine Implikationen für die literarischen Verfahren
- 4.1 „[I]n der Luft gehen“: Poetische Aneignungsstrategien, monetäre Semiotik und literarische Selbstverzinsung in Händlers Roman Wenn wir sterben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht das komplexe Wechselspiel zwischen ökonomischen und literarischen Diskursen in der Gegenwartsliteratur. Sie analysiert, wie ökonomische Prinzipien und Modelle die poetische Sprache und Erzählverfahren beeinflussen und umgekehrt, wie ökonomische Themen literarisch gestaltet und imaginativ aufgeladen werden. Die Arbeit konzentriert sich auf eine vergleichende Analyse zweier Romane.
- Das Verhältnis von Ökonomie und Literatur in der Gegenwartsliteratur
- Die ästhetische Produktivität ökonomischer Konzepte in der Literatur
- Die literarische Gestaltung und imaginative Aufladung ökonomischer Themen
- Vergleichende Analyse der Erzählverfahren in zwei ausgewählten Romanen
- Die Rolle von Erzählstrategien und der Semiotik des Geldes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die historische Entwicklung des literarischen Interesses an ökonomischen Themen. Kapitel 2 beschreibt die methodologische Vorgehensweise und stellt die ausgewählten Romane vor. Kapitel 3 analysiert die Darstellung der Wirtschaft als Erzählung und die ökonomische Kodierung des Poetischen. Kapitel 4 untersucht die poetischen Verfahren in den beiden Romanen, fokussiert auf die Aneignung ökonomischer Strategien und die Ästhetisierung wirtschaftlicher Diskurse, inklusive der Analyse von Erzählstrukturen und intertextuellen Bezügen.
Schlüsselwörter
Gegenwartsliteratur, Ökonomie, Literatur, Erzählverfahren, monetäre Semiotik, ökonomische Kodierung, poetische Sprache, vergleichende Analyse, Romananalyse, Verschwendung, Werttheorie.
Häufig gestellte Fragen
Welche Romane werden in dieser Arbeit analysiert?
Analysiert werden "Das Jahr der Wunder" von Rainer Merkel und "Wenn wir sterben" von Ernst-Wilhelm Händler.
Was ist der "New Economic Criticism"?
Ein interdisziplinärer Forschungsansatz, der den Dialog zwischen Wirtschafts- und Literaturwissenschaften fördert und Parallelen zwischen Geld und Sprache untersucht.
Wie beeinflusst die Ökonomie die literarische Form?
Ökonomische Theorien und die Logik des Tausches werden genutzt, um Erzählstrategien, Metaphern und die Struktur der Romane zu beschreiben.
Welche Rolle spielt Simmels "Philosophie des Geldes" in der Arbeit?
Simmels Werk dient als theoretische Grundlage, um die Fiktionalität des Geldes und dessen Einfluss auf zwischenmenschliche Beziehungen zu verstehen.
Was bedeutet "Ästhetisierung der Wirtschaft" in diesem Kontext?
Es beschreibt, wie Literatur wirtschaftliche Abläufe durch poetische Mittel darstellt und dadurch ein spezifisches Wissen über das Ökonomische hervorbringt.
Wie unterscheidet sich die neuere Literatur von der marxistischen Literatur der 70er Jahre?
Die moderne Literatur zeigt einen ambivalenteren Umgang mit dem ökonomischen Feld und schenkt dessen Sprech- und Wahrnehmungsweisen neue Aufmerksamkeit.
- Citation du texte
- Anne-Christin Sievers (Auteur), 2007, Schreibweisen des Ökonomischen in der deutschen Gegenwartsliteratur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124727