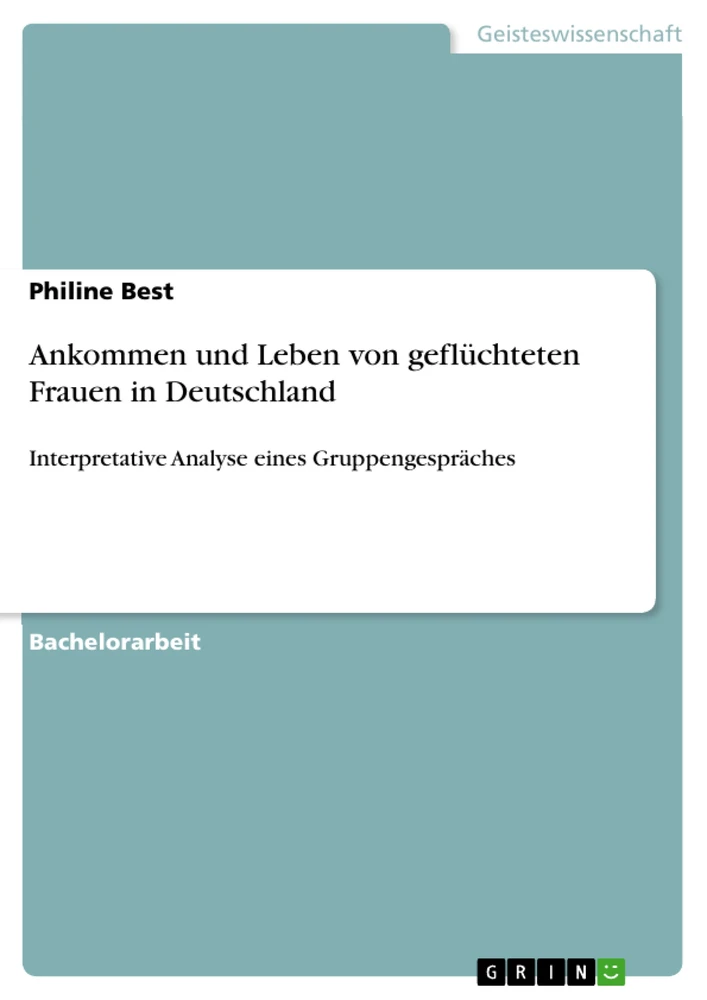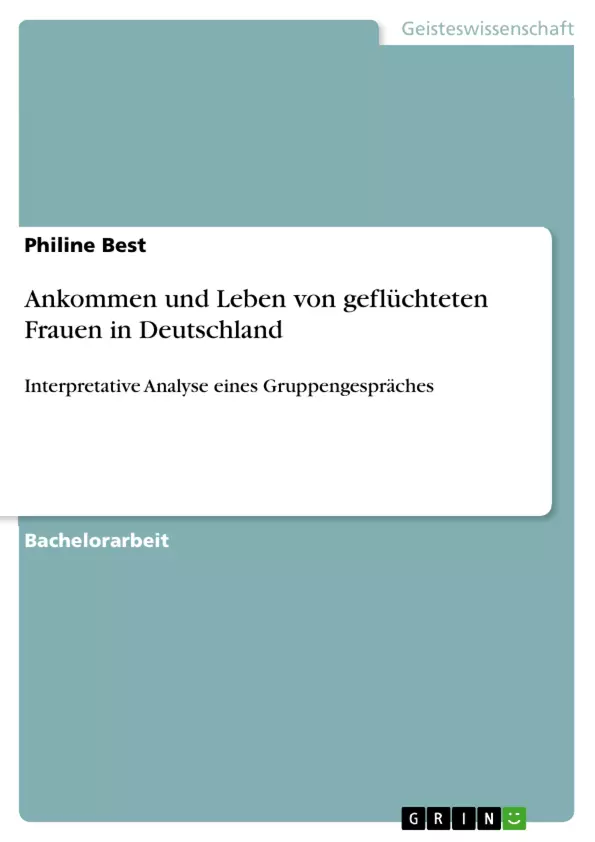In dieser Forschungsarbeit soll anhand der Analyse einer Gruppendiskussion von drei geflüchteten Frauen, der Frage nachgegangen werden, wie geflüchtete Frauen ihr Leben und Ankommen in Deutschland konstruieren.
Seit der verstärkten Zuwanderung 2015 und 2016 stehen Menschen mit Fluchthintergrund vermehrt im Fokus der Öffentlichkeit. Im öffentlichen Diskurs spielen Frauen dabei eine untergeordnete Rolle und es wird hauptsächlich das Bild von jungen Männern gezeigt. Auch in der Migrationsforschung gelten Männer als prototypische Migranten und Migrantinnen werden als Ausnahme und Folgeerscheinung der Migration von Männern gesehen. Dabei sind fast die Hälfte der statistisch erfassten MigrantInnen Frauen und es wird angenommen, dass sie unter den weltweiten Flüchtlingen die Mehrheit ausmachen. In dem Zeitraum von 2012-2016 sind über 500.000 Asylanträgerinnen weiblichen Geschlechts und machen damit durchschnittlich ein Drittel der Asylanträge aus. In den Jahren 2015 und 2016 waren 40% der Antragsstellerinnen minderjährig und 38% im Alter von 18-35. Die Mehrheit der Frauen ist dabei muslimischen Glaubens, 2016 waren es 74,8%. 12,8% der Antragstellerinnen sind Christinnen und 8% Yezidinnen. Die Frauen stammen mehrheitlich aus nicht-europäischen Ländern und fliehen hauptsächlich aus Syrien, dem Irak und Afghanistan.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- 1. Forschungsdesign
- 1.1 Qualitative Sozialforschung
- 1.2 Das Gruppengespräch
- 1.3 Auswertung
- 2. Falldarstellung
- 2.1 Fallbeschreibung
- 2.1.1 Beginn der Gruppendiskussion
- 2.1.2 Eingangserzählung Frau Blade
- 2.1.3 Eingangserzählung Frau Hermy
- 2.1.4 Eingangserzählung Frau Lomer
- 2.1.5 Nachfragen an Frau Blade
- 2.1.6 Nachfragen an Frau Hermy
- 2.1.7 Nachfragen an Frau Lomer
- 2.1.8 Abschluss der Gruppendiskussion
- 2.2 Ergebnisse der Analyse
- 3. Einbindung in den aktuellen Genderdiskurs
- 3.1 Aktuelles zum Genderdiskurs
- 3.2 Gruppentypik und Gender
- 3.3 Gender und Bildung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Forschungsarbeit untersucht, wie geflüchtete Frauen ihr Leben und Ankommen in Deutschland konstruieren. Dabei wird ein Gruppengespräch von drei geflüchteten Frauen analysiert. Die Arbeit integriert Erkenntnisse aus der qualitativen Sozialforschung, analysiert die Ergebnisse der Gruppendiskussion und bindet diese in den aktuellen Genderdiskurs ein. Die Studie soll einen Beitrag zum Verständnis der Lebenslagen und Integrationsperspektiven geflüchteter Frauen liefern.
- Die Konstruktion von Leben und Ankommen in Deutschland durch geflüchtete Frauen
- Analyse einer Gruppendiskussion mit drei geflüchteten Frauen
- Einbindung der Ergebnisse in den Genderdiskurs
- Geschlechtsspezifische Ungleichheiten und Gefahren für geflüchtete Frauen
- Integrationsperspektiven und Herausforderungen für geflüchtete Frauen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beleuchtet die Bedeutung der Flucht und den Kontext der verstärkten Zuwanderung nach Deutschland. Kapitel 1 stellt das Forschungsdesign vor, erläutert die qualitative Sozialforschung und die Methode des Gruppengespräches, sowie die Auswertungsschritte der vorliegenden Arbeit. In Kapitel 2 wird die Gruppendiskussion rekonstruiert, der Verlauf der Diskussion dargestellt und die daraus resultierende Fallstruktur erläutert. Abschließend integriert Kapitel 3 die Ergebnisse in den Genderdiskurs, stellt den Typus der Diskussion in Bezug auf Gender vor und verbindet Gender mit Bildung. Die Arbeit wird mit einem Fazit abgeschlossen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Flucht, Migration, Geschlecht, Gender, Integration, Gruppendiskussion, qualitative Sozialforschung, Deutschland, Lebenslagen, Integrationsperspektiven, geflüchtete Frauen, Frauen in der Migrationsforschung, Geschlechterrollen, Empowerment.
- Quote paper
- Philine Best (Author), 2020, Ankommen und Leben von geflüchteten Frauen in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1247353