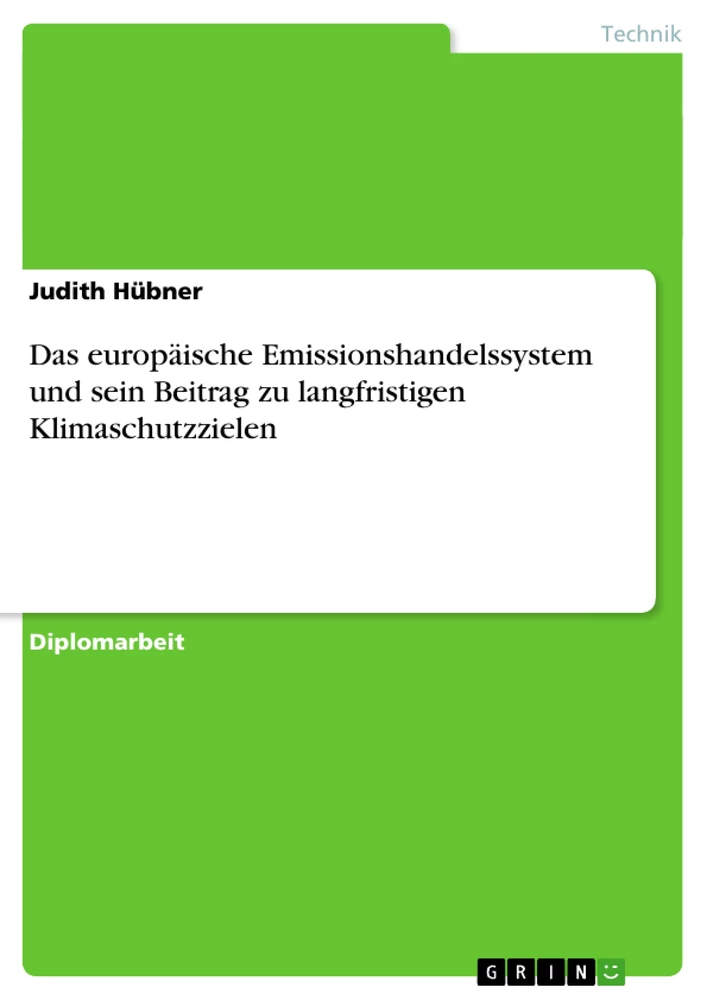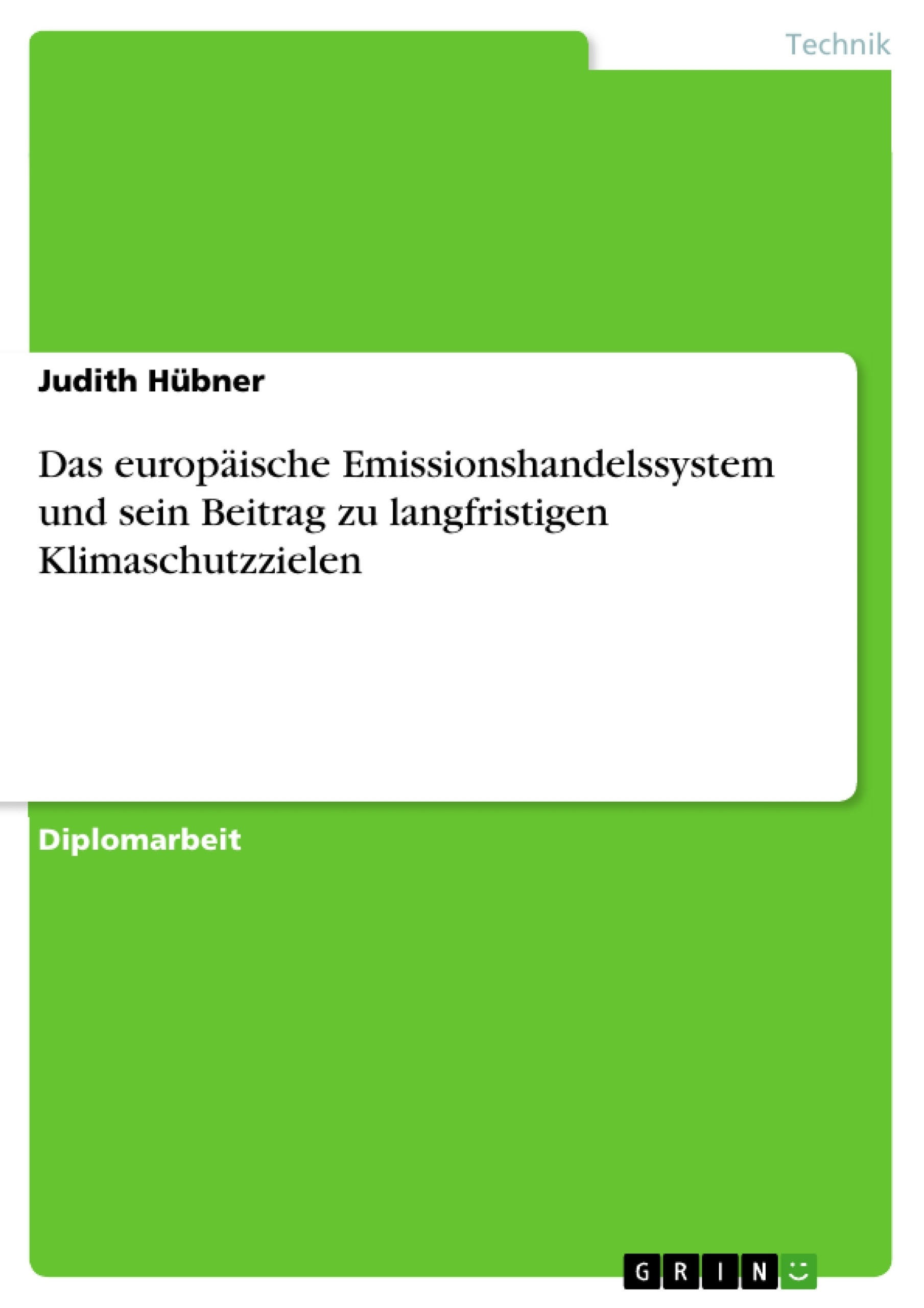Durch die russische Unterzeichnung des Kyoto-Protokolls im November 2004 kam wieder Bewegung in die politische Debatte um den globalen Klimaschutz. Die Verhandlungen waren stagniert, nachdem die USA 2001 ihren Plan zur Ratifizierung des Protokolls zurückgezogen hatte. Sogar von einem Scheitern der Klimaverhandlungen war die Rede (SACHS 2001). Schließlich konnte das Kyoto-Protokoll am 16. Februar 2005 in Kraft treten.
Durch die russische Ratifizierung wurde die zum In-Kraft-Treten zu überschreitende Grenze von 55 Staaten, welche zusammen mehr als 55 % der Treibhausgasemissionen des Jahres 1990 der Industrieländer verursachen, überschritten worden (RAHMEYER 2004). Im Mai 2005 fand das 22. Treffen der Subsidiary Bodies, Unterorganen der Vertragsstaatenkonferenzen der Klimarahmenkonvention, in Bonn statt. Diese sollen die im Dezember diesen Jahres anstehende 11. Vertragsstaatenkonferenz vorbereiten. Dabei wurden Maßnamen zur Emissionsreduktion und solche zur Anpassung an den Klimawandel
diskutiert (UNFCCC 2005a). Aufgrund der Ablehnung der USA und Saudi-Arabiens
wurde noch nicht über langfristige, über das Jahr 2012 hinausgehende Klimaschutzziele beratschlagt (BROUNS et al. 2004). Dessen ungeachtet muss nach dem Kyoto-Protokoll noch in diesem Jahr mit der Besprechung neuer, langfristiger Klimaschutzziele begonnen werden (UN 1997). In der Studie „International Climate Effects beyond 2012: A survey of approaches“ (BODANSKY et al. 2004) wird auf die Vielzahl der Ansätze von globalen Klimaschutzzielen eingegangen. Auf europäischer Ebene wurde u. a. durch eine Informationsplattform
und ein Diskussionsforum mit der Meinungsbildung und –befragung zu diesem
Thema begonnen (EU 2005a, EU 2005b). In Deutschland wurde die Studie „Options
for the second commitment period of the Kyoto Protocol“ veröffentlicht, welche sich mit demselben Thema beschäftigt (HÖHNE et al. 2005). Die Literatur sowohl zum Thema „Langfristige Klimaschutzziele“ als auch „Emissionshandel“ ist sehr umfassend. Aus diesem Grund können an dieser Stelle lediglich einige Beispiele erwähnt werden.
Der Emissionshandel „gilt grundsätzlich als effizientes Instrument, um ein vorgegebenes Reduktionsziel kostenminimal zu erreichen“ (KLEMMER et al. 2002). Praktische Anwendung fand er bis jetzt nur im regionalen Bereich z. B. im RECLAIM-Projekt in Kalifornien und im nationalen Bereich wie in Dänemark und Großbritannien (MEZ und PIENING 2000).
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Der anthropogene Einfluss auf das Klimasystem
- 2.1 Das Klimasystem der Erde
- 2.2 Kohlenstoffkreislauf
- 2.2.1 Atmosphäre
- 2.2.2 Biosphäre
- 2.2.3 Hydrosphäre
- 2.2.4 Lithosphäre
- 2.3 Das Klimasystem unter anthropogenem Einfluss
- 2.3.1 Der anthropogene Treibhauseffekt
- 2.3.2 Auswirkungen des anthropogenen Einflusses auf das Klimasystem
- 2.4 Stabilisierung der CO2-Konzentration
- 2.4.1 Anthropogene Kohlenstoff-Flüsse
- 2.4.2 Erste verpflichtende Schritte in der globalen Klimapolitik
- 2.4.3 Szenarien
- 2.5 Zusammenfassung
- 3 Emissionsentwicklung, Klimaschutzziele und Emissionshandel
- 3.1 Klimaschutzziele
- 3.1.1 Kurzfristige Klimaschutzziele (bis 2012)
- 3.1.2 Zwischenbilanz: Emissionsentwicklungen der EU und Deutschlands im Zeitraum 1990 bis 2000/02
- 3.1.3 Langfristige Klimaschutzziele (nach 2012)
- 3.2 Emissionshandel in der EU und in Deutschland vor dem Hintergrund des Kyoto-Protokolls
- 3.2.1 Theorie des Emissionshandels und der projektbezogenen Mechanismen
- 3.2.2 Joint Implementation und Clean Development Mechanism
- 3.2.3 Rahmenbedingungen des globalen Emissionshandels
- 3.2.4 Rahmenbedingungen des europäischen Emissionshandels
- 3.3 Zusammenfassung
- 3.1 Klimaschutzziele
- 4 Rahmendaten der Klimaschutzziele und des Emissionshandels
- 4.1 Bewertung der Ziele hinsichtlich ihrer Wirkung auf den Klimaschutz
- 4.1.1 Beschreibung der Szenariendaten
- 4.1.2 Bewertung der Ziele
- 4.2 Abdeckungsrate des Emissionshandels
- 4.3 Emissionsintensitäten
- 4.4 Anteil des CO2 an den Gesamtemissionen
- 4.5 Zusammenfassung
- 4.1 Bewertung der Ziele hinsichtlich ihrer Wirkung auf den Klimaschutz
- 5 Entwicklungen der Klimaschutzziele und des europäischen Emissionshandels
- 5.1 Langfristige Klimaschutzziele
- 5.2 Folgen der EU-Osterweiterung 2004
- 5.3 Einbezug weiterer Sektoren: Verkehr und private Haushalte
- 5.4 Einbezug weiterer Treibhausgase
- 6 Folgen für die praktische Ausgestaltung des Emissionshandels
- 6.1 (Primär-)Allokation
- 6.2 Sonderregelungen
- 6.3 Banking und Borrowing
- 6.4 Einbezug weiterer Treibhausgase
- 6.5 Teilnehmer
- 6.6 Kontroll- und Sanktionsmechanismen
- 6.7 Joint Implementation und Clean Development Mechanism
- 6.8 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht das europäische Emissionshandelssystem und dessen Beitrag zur Erreichung langfristiger Klimaschutzziele. Die Arbeit analysiert die Entwicklung der Emissionshandelspolitik, bewertet die Wirksamkeit der gesetzten Ziele und beleuchtet die Herausforderungen bei der praktischen Umsetzung.
- Der anthropogene Einfluss auf das Klimasystem
- Entwicklung und Ziele des europäischen Emissionshandelssystems
- Bewertung der Wirksamkeit des Emissionshandels
- Herausforderungen bei der praktischen Umsetzung des Emissionshandels
- Langfristige Perspektiven des Klimaschutzes
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 dient als Einleitung. Kapitel 2 beschreibt den anthropogenen Einfluss auf das Klimasystem, einschließlich des Kohlenstoffkreislaufs und des Treibhauseffekts. Kapitel 3 behandelt die Entwicklung der Klimaschutzziele und die Einführung des Emissionshandels in der EU. Kapitel 4 analysiert die Rahmendaten der Klimaschutzziele und des Emissionshandels, während Kapitel 5 Entwicklungen und Herausforderungen des Systems beleuchtet. Kapitel 6 befasst sich mit den Folgen für die praktische Ausgestaltung des Emissionshandels.
Schlüsselwörter
Europäisches Emissionshandelssystem, Klimaschutz, Treibhausgase, CO2-Emissionen, Kyoto-Protokoll, Klimarahmenkonvention, Emissionshandel, Stabilisierungsszenarien, langfristige Klimaziele, EU-Osterweiterung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des europäischen Emissionshandelssystems (ETS)?
Das Ziel ist die kostenminimale Erreichung von Reduktionszielen für Treibhausgasemissionen durch einen marktbasierten Handel mit Verschmutzungsrechten.
Welche Bedeutung hatte die russische Ratifizierung des Kyoto-Protokolls?
Sie ermöglichte das Inkrafttreten des Protokolls im Februar 2005, da erst dadurch die erforderliche Quote an emittierenden Industrieländern erreicht wurde.
Was sind „Joint Implementation“ und „Clean Development Mechanism“?
Es sind projektbezogene Mechanismen des Kyoto-Protokolls, die es Industrieländern erlauben, Emissionsgutschriften durch Projekte in anderen Ländern zu erwerben.
Wie wirkt sich die EU-Osterweiterung auf den Emissionshandel aus?
Die Integration neuer Mitgliedstaaten erforderte Anpassungen bei der Allokation von Zertifikaten und berücksichtigte unterschiedliche Emissionsintensitäten.
Sollen weitere Sektoren in den Emissionshandel einbezogen werden?
Die Arbeit diskutiert die Einbeziehung weiterer Sektoren wie des Verkehrs und privater Haushalte sowie zusätzlicher Treibhausgase über CO2 hinaus.
- Arbeit zitieren
- Judith Hübner (Autor:in), 2005, Das europäische Emissionshandelssystem und sein Beitrag zu langfristigen Klimaschutzzielen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124736