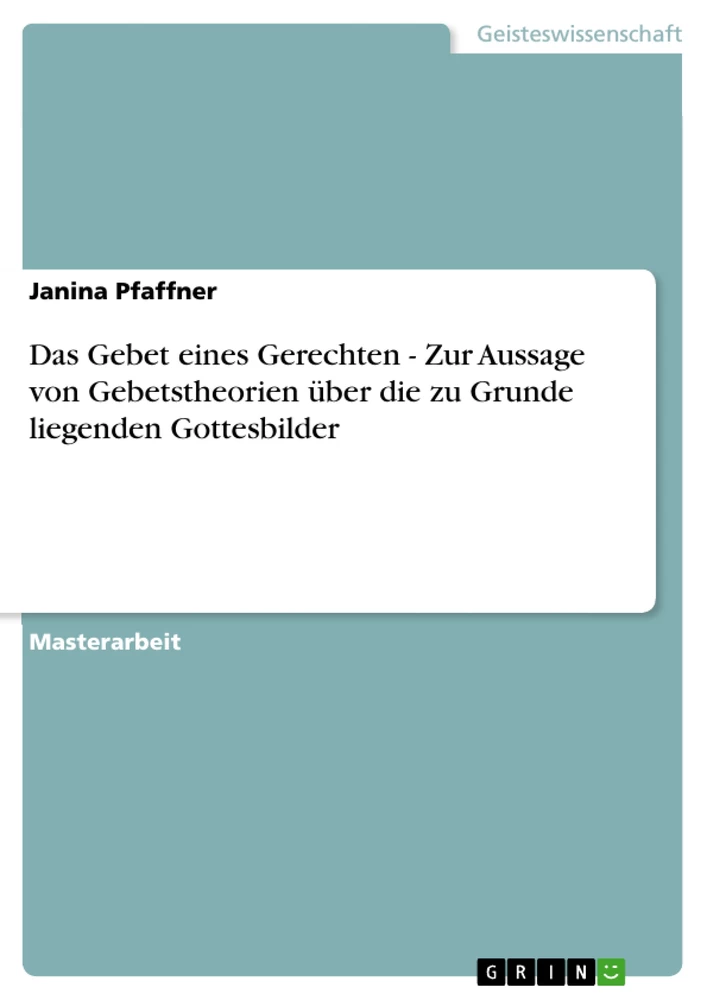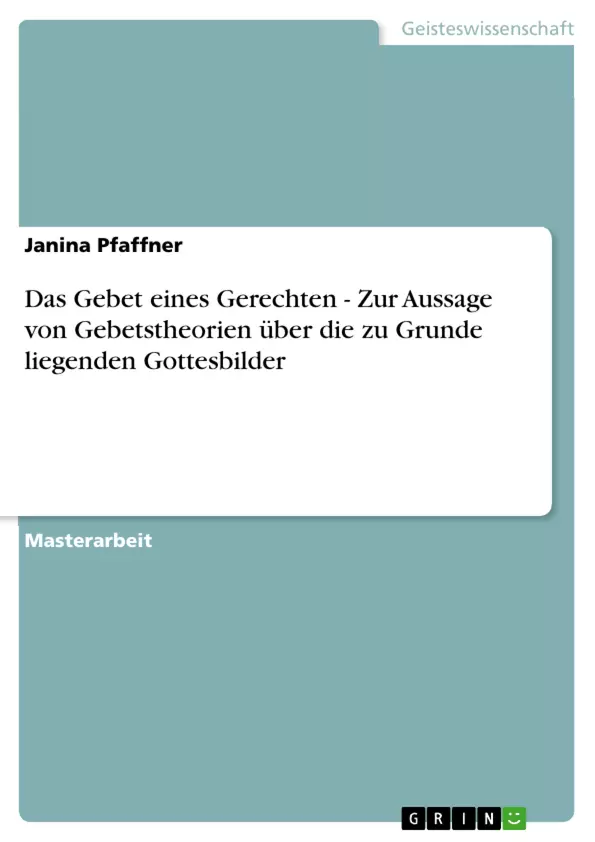Theologie ist unverständlich, Dogmatik im Besonderen.
„Diese Gefahr [der Unverständlichkeit] besteht vor allem dann, wenn man über etwas schreibt, was jedermann aus seinem eigenen Erleben kennt.“
Was der Psychologe und Kommunikationsanalytiker Schulz von Thun sich hier über seine Zunft eingesteht, gilt in entsprechender Weise für die Arbeit des Theologen zum Thema Gebet. Was er schreibt, wird beim Gläubigen als verkomplizierte Binsenweisheit, beim empirischen Wissenschaftler als leeres Geschwätz ankommen. Es erscheint als hoffnungsloses Unterfangen, dieser Unverständlichkeit und Unvereinbarkeit entgegenwirken zu wollen, da bereits an der Vokabel „Gott“ dogmatische Definitionsversuche scheitern.
„Im Falle einer echt empfundenen Unverständlichkeit des Wortes ‚Gott‘ muß (sic!) an ein vertrautes Sprachgeschehen verwiesen werden, an dem bestimmtes überliefertes Reden von Gott den Resonanzboden findet, der es zum Klingen bringt und verstehbar werden lässt.“
Das Sprachgeschehen, von dem aus Ebeling seine Dogmatik denkt, ist das Gebet. Hier artikuliert sich Glaube auf einer kommunikativen Ebene. Für das Gelingen der Kommunikation ist ein Faktor elementar: Verständlichkeit. Das bedeutet, dass es sich lohnt, Gebete auf ihr Gottesbild hin zu untersuchen, die in ihrem vielgestaltigen Überlieferungsgeschehen Jahrtausende ebendeshalb überdauert haben, weil in ihnen die Kommunikation als geglückt betrachtet wird.
Diese Arbeit fragt jedoch nicht nach dem Warum des Glückens jenes Sprachgeschehens zwischen Mensch und Gott, sondern will der Frage nachgehen, inwiefern Gebete all-gemein (Kap. 2) und der biblischen Überlieferung im Speziellen (Kap. 3 und 4) tatsächlich helfen können, Erkenntnisse über das Sein Gottes aus der Perspektive des (vermittelten) Beters zu gewinnen und so verständlich über Gott zu sprechen. Insofern will die vorliegende Arbeit keinem Anspruch auf synchrone wie diachrone Vollständigkeit genügen. Sie legt sich auf den Bereich jüdisch-christlicher Überlieferung fest und verzichtet bewusst auf die Arbeitsschritte der Literar-, Überlieferungs- sowie der Redaktionskritik. Der Text der fünf zu untersuchenden Gebete wird so hingenommen, wie er heute überliefert ist. Ältere Überlieferungsformen sind an dieser Stelle nicht von Relevanz. Die Auswahl der Texte erscheint nicht nur willkürlich.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wie ist Gott? - Von der Schwierigkeit, eine Frage zu beantworten
- Gotteserkenntnis und Erkenntnistheorie
- Der hermeneutische Zirkel menschlicher Erkenntnis
- Der Begriff der Gotteserkenntnis
- Gotteserkenntnis als contradictio in adiecto
- Gotteserkenntnis in theologischer Perspektive
- Gebet als erkannter Ort erkennender Gotteserkenntnis
- Allgemeines
- Subjektives
- Vorverständnis: Gott beim Gebet
- Vorverständnis: Mensch beim Gebet
- Fazit zum Vorverständnis
- Gebet als hermeneutischer Schlüssel zur Gotteserkenntnis
- Gebetsexegese als Mittel zum Zweck
- Ein Exkurs: Kommunikationsanalyse
- Gotteserkenntnis und Erkenntnistheorie
- Das Gebet im Alten Testament
- Exodus - Das Mirjamlied (Ex 15,20f.)
- Exegetische Grundbetrachtungen
- Zur psychologischen Kommunikationsstruktur
- Gott, der Parteiische
- Vorexilisch-Das Gebet Hiskias (2Kön 19,14-19 par.)
- Exegetische Grundbetrachtungen
- Zur psychologischen Kommunikationsstruktur
- Gott, der Einzige
- Nachexilisch-Das Gebet Nehemias (Neh 1,4-11)
- Exegetische Grundbetrachtungen
- Zur psychologischen Kommunikationsstruktur
- Gott der gebundene Unverfügbare
- Exodus - Das Mirjamlied (Ex 15,20f.)
- Das Gebet im Neuen Testament
- Menschgott - Das Gebet Jesu in Gethsemane (Mt 26,39-44 par.)
- Exegetische Grundbetrachtungen
- Zur psychologischen Kommunikationsstruktur
- Gott der Vater
- Urgemeinde – Loswurf der Apostel (Apg 1,23-26)
- Exegetische Grundbetrachtungen
- Zur psychologischen Kommunikationsstruktur
- Gott der Weltenlenker
- Menschgott - Das Gebet Jesu in Gethsemane (Mt 26,39-44 par.)
- Alles ist eitel! – Vom Nutzen einer gebetsorientierten Rede von Gott – Ein Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht, inwieweit Gebete – insbesondere aus der jüdisch-christlichen Tradition – Aufschluss über das Gottesbild des Betenden geben können. Die Arbeit analysiert ausgewählte Gebete, um zu verstehen, wie sie zur Gotteserkenntnis beitragen und verständlich über Gott sprechen.
- Analyse des Zusammenhangs zwischen Gebet und Gotteserkenntnis
- Untersuchung verschiedener Gottesbilder in biblischen Gebeten
- Hermeneutische Betrachtung der Kommunikation zwischen Mensch und Gott im Gebet
- Exegetische Analyse ausgewählter Gebete aus dem Alten und Neuen Testament
- Beitrag zum Verständnis theologischer Fragestellungen durch die Gebetstheorie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert die Forschungsfrage. Das zweite Kapitel behandelt theoretische Grundlagen der Gotteserkenntnis und positioniert das Gebet als hermeneutischen Schlüssel. Die Kapitel drei und vier analysieren ausgewählte Gebete aus dem Alten und Neuen Testament, jeweils unter exegetischen und kommunikationsanalytischen Aspekten, um die jeweiligen Gottesbilder zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Gotteserkenntnis, Gebet, Gebetstheorie, Gottesbild, Hermeneutik, Bibel, Altes Testament, Neues Testament, Kommunikation, Exegese.
Häufig gestellte Fragen
Was verraten Gebete über das Gottesbild eines Menschen?
Gebete sind ein Sprachgeschehen, in dem sich der Glaube artikuliert. Die Art, wie ein Mensch Gott anspricht, offenbart seine tiefere Vorstellung von Gottes Wesen (z.B. als Vater, Weltenlenker oder Parteiischer).
Warum wird das Gebet als „hermeneutischer Schlüssel“ bezeichnet?
Weil das Gebet den Ort darstellt, an dem Gotteserkenntnis für den Menschen verstehbar und erfahrbar wird, jenseits von abstrakten dogmatischen Definitionen.
Welche biblischen Gebete werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit untersucht unter anderem das Mirjamlied (Exodus), das Gebet Hiskias, das Gebet Nehemias sowie das Gebet Jesu in Gethsemane.
Wie hilft Kommunikationsanalyse beim Verständnis von Gebeten?
Durch Modelle wie das von Schulz von Thun lässt sich die psychologische Struktur der Kommunikation zwischen Mensch und Gott untersuchen, was Rückschlüsse auf das zugrunde liegende Gottesbild erlaubt.
Was ist das Fazit zur gebetsorientierten Rede von Gott?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass die Analyse von Gebeten eine der effektivsten Möglichkeiten ist, verständlich und lebensnah über Gott zu sprechen.
- Citar trabajo
- Janina Pfaffner (Autor), 2009, Das Gebet eines Gerechten - Zur Aussage von Gebetstheorien über die zu Grunde liegenden Gottesbilder, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124848