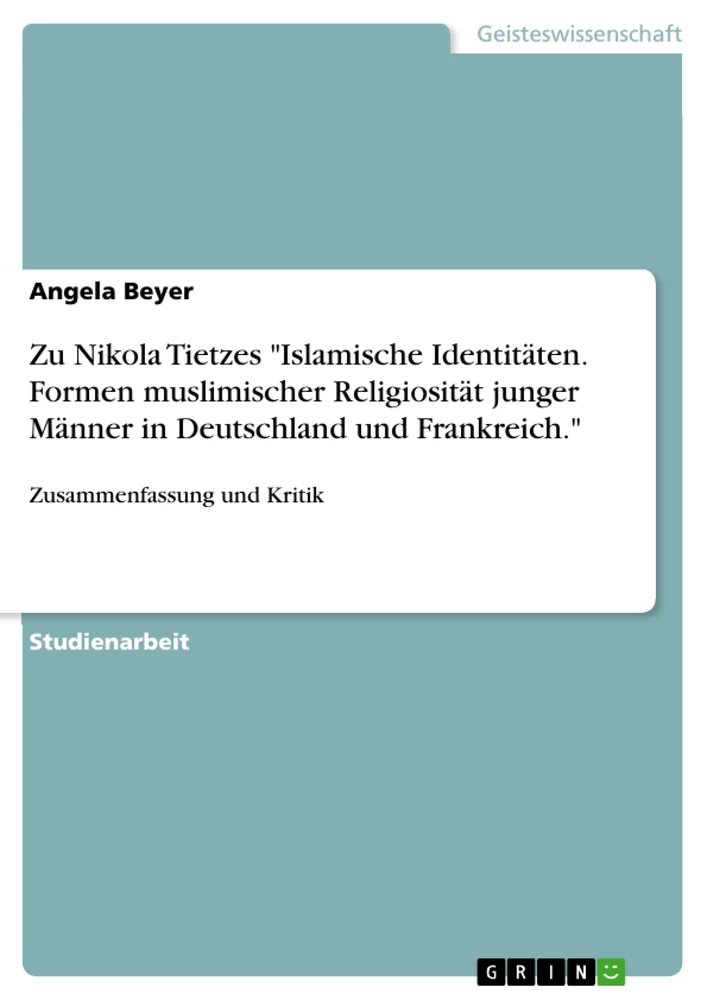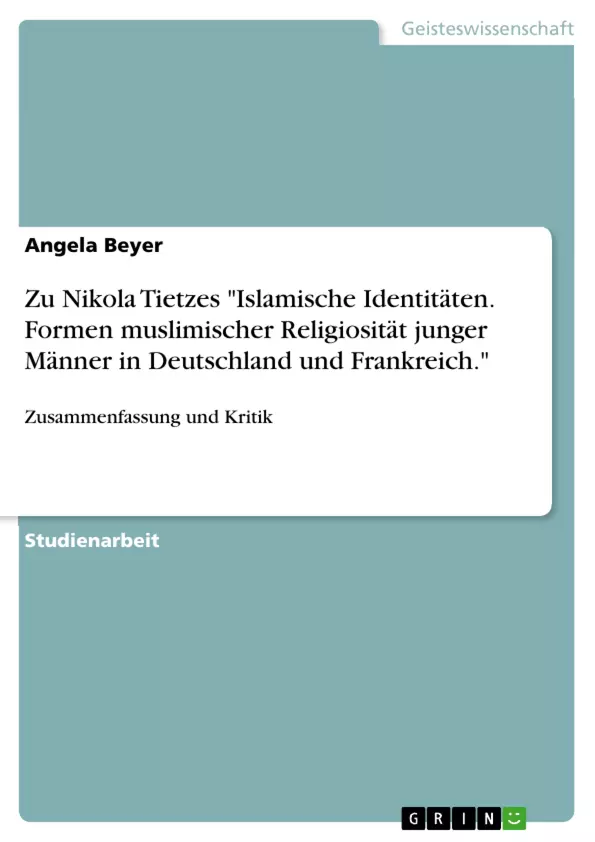Der Islam gehört heute zum gesellschaftlichen Alltag vieler europäischer Großstädte. Nicht nur Immigrant_innen der ersten Generation fühlen sich ihm zugehörig, auch junge Menschen, die in Deutschland oder Frankreich aufgewachsen sind, praktizieren ihre Religion. Das Bild, das die Öffentlichkeit von Muslim_as hat, scheint überwiegend negativ. Oft werden sie aufgrund ihrer Herkunft oder Religion stigmatisiert und von der Mehrheitsgesellschaft ausgeschlossen. Sie gelten als „Traditionalisten“, die dem „westlichen Fortschritt“ oder der Emanzipation ablehnend gegenüber stehen. Sie werden als „Fremde“ angesehen, die sich nicht integrieren wollen. Oft findet auch die Gleichsetzung mit Gewalt, Fundamentalismus oder Terrorismus statt.
Die nachindustrielle Moderne und die zunehmende Globalisierung führten in Frankreich wie auch in Deutschland zu einer Schwächung bestehender Wertesysteme. Eine zunehmende Individualisierung ist die Folge. Jeder einzelne ist gefordert, sich und sein Leben selbst zu entwerfen. In den Einwandererländern geschieht dies mit Hilfe des Islams, der es den Einwander_innen ermöglicht, sich sowohl von der übrigen Gesellschaft abzugrenzen als auch sich zu integrieren. Tietze möchte in ihrem Buch „Islamische Identitäten. Formen muslimischer Religiosität junger Männer in Deutschland und Frankreich.“ zeigen, wie diese Strategien, sich selbst zu entwerfen, funktionieren.
Sie will zeigen, dass Muslim sein kein statisches Programm ist, sondern sich vorherrschenden Umständen anzupassen versucht. Es ist ein Prozess, in dem sich das Individuum als handelndes Subjekt immer wieder neu entwirft. Als Beispiele dienten ihr junge muslimische Männer, die unter vergleichbaren sozialen Umständen leben. Anhand teilnehmender Beobachtung, Interviews und relevanter wissenschaftlicher Arbeiten entwickelt sie eine Typologie verschiedener Formen muslimischer Religiosität.
Das Buch lässt zwei Teile erkennen: Im ersten Teil führt die Autorin hin zum Thema, gibt Hintergrundinformationen (die im zweiten Teil ausführlicher diskutiert werden) und zeichnet die Portraits auf, auf denen sie ihre Arbeit stützt. Im zweiten Teil zieht sie einen Vergleich zwischen Deutschland und Frankreich anhand ihrer gewonnen Erkenntnisse. Aufgrund des Umfanges und des von Tietze detailliert ausgearbeiteten theoretischen Rahmens, werde ich mich in dieser Arbeit „nur“ mit dem ersten Teil beschäftigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Über die Autorin
- Hintergrundinformationen zum Buch: politischer und sozialer Rahmen
- Zentrale Thesen und Formen muslimischer Religiosität
- Wissenschaftliche Diskurse vom Islam der Immigranten in der Literatur
- Drei historische Konfigurationen des Islams in Frankreich
- Wissenschaftliche Diskurse in Deutschland
- Formen muslimischer Religiosität – Portraits junger Muslime in Deutschland und Frankreich
- Zwischen believing und belonging – Die drei Phasen
- Vergleich der religiösen Formen zwischen Deutschland und Frankreich
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit von Nikola Tietze untersucht die Formen muslimischer Religiosität junger Männer in Deutschland und Frankreich. Ziel ist es, aufzuzeigen, dass "Muslim sein" kein statisches Konzept ist, sondern sich an die jeweiligen gesellschaftlichen Umstände anpasst. Tietze analysiert die Strategien, mit denen sich junge muslimische Männer in diesen Kontexten selbst definieren und ihre Identität gestalten.
- Formen muslimischer Religiosität in Deutschland und Frankreich
- Der Einfluss gesellschaftlicher und politischer Rahmenbedingungen auf religiöse Praktiken
- Vergleichende Analyse der Integrations- und Identitätsprozesse
- Die Rolle des Islams als Ressource der Selbstentfaltung und Abgrenzung
- Die Wahrnehmung von Muslimen in der deutschen und französischen Öffentlichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den gesellschaftlichen Kontext, in dem sich junge Muslime in Deutschland und Frankreich befinden. Sie thematisiert die oft negativen öffentlichen Bilder von Muslimen und die Herausforderungen der Integration in einer säkularisierten Gesellschaft. Tietzes Ziel, die dynamischen und vielschichtigen Identitätskonstruktionen junger muslimischer Männer zu beleuchten, wird dargelegt. Die methodische Vorgehensweise, basierend auf teilnehmender Beobachtung und Interviews, wird kurz skizziert. Der Fokus auf den ersten Teil des Buches wird begründet.
Über die Autorin: Dieses Kapitel präsentiert eine kurze Biografie der Autorin Nikola Tietze, ihre akademischen Qualifikationen und ihre Forschungsschwerpunkte. Es wird auf ihre Motivation zur Untersuchung der Thematik eingegangen, wobei ihre Erfahrungen in Frankreich und die unterschiedlichen öffentlichen Diskurse zum Islam in Deutschland und Frankreich hervorgehoben werden. Die persönliche Perspektive der Autorin wird in Bezug auf ihre Forschungsfrage kontextualisiert.
Hintergrundinformationen zum Buch: politischer und sozialer Rahmen: Dieses Kapitel liefert zusätzliche Kontextinformationen zur Studie. Es beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven der Mehrheitsgesellschaft und junger Muslime auf Integration in Deutschland. Der Unterschied zwischen der Wahrnehmung von Muslimen als "Ausländer" trotz Staatsbürgerschaft und der Selbstwahrnehmung als "Muslim in Deutschland" wird diskutiert. Der kolonialgeschichtliche Kontext in Frankreich und dessen Einfluss auf die Integrationsdebatte werden ebenfalls thematisiert.
Zentrale Thesen und Formen muslimischer Religiosität: Dieser Abschnitt stellt die zentralen Argumentationslinien des Buches vor und skizziert die verschiedenen Formen der muslimischen Religiosität, die Tietze identifiziert hat. Es werden die theoretischen Grundlagen und die methodische Herangehensweise kurz zusammengefasst, um das Verständnis für die anschließende Analyse zu legen. Die Vielschichtigkeit der religiösen Praktiken und Identitätsbildungsprozesse wird antizipiert.
Wissenschaftliche Diskurse vom Islam der Immigranten in der Literatur: Dieses Kapitel analysiert die bestehenden wissenschaftlichen Diskurse zum Thema Islam und Immigration. Es untersucht historische Konfigurationen des Islams in Frankreich und vergleicht diese mit den wissenschaftlichen Diskursen in Deutschland. Die unterschiedlichen Perspektiven und methodischen Ansätze werden kritisch beleuchtet und bilden die Grundlage für Tietzes eigene Untersuchung.
Formen muslimischer Religiosität – Portraits junger Muslime in Deutschland und Frankreich: Dieses Kapitel präsentiert detaillierte Fallstudien, die verschiedene Formen muslimischer Religiosität bei jungen Männern in beiden Ländern illustrieren. Durch die Präsentation von konkreten Beispielen wird die Vielfalt und Komplexität der religiösen Praktiken verdeutlicht. Die Zusammenhänge zwischen sozialem Umfeld, persönlicher Biografie und religiöser Ausrichtung werden analysiert.
Zwischen believing und belonging – Die drei Phasen: Dieser Abschnitt beschreibt wahrscheinlich eine Typologie der Religiosität und integriert die Erkenntnisse aus den Fallstudien. Die drei Phasen zeigen wahrscheinlich einen Entwicklungsprozess der religiösen Identität, die jeweiligen Merkmale dieser Phasen werden erläutert, und wie sie mit den sozialen und kulturellen Kontexten zusammenhängen.
Vergleich der religiösen Formen zwischen Deutschland und Frankreich: Dieses Kapitel zieht einen Vergleich zwischen den in Deutschland und Frankreich beobachteten Formen muslimischer Religiosität. Es analysiert die Gemeinsamkeiten und Unterschiede und verknüpft diese mit den unterschiedlichen gesellschaftlichen und politischen Kontexten. Die Ergebnisse ermöglichen eine differenzierte Perspektive auf Integrationsprozesse und Identitätsbildung in beiden Ländern.
Schlüsselwörter
Islamische Identitäten, Religiosität, junge Männer, Deutschland, Frankreich, Integration, Migration, Vergleichende Analyse, Identitätsbildung, Selbstentwurf, Wissenschaftliche Diskurse, soziale Rahmenbedingungen, politische Kontexte.
Häufig gestellte Fragen zu: Formen Muslimischer Religiosität junger Männer in Deutschland und Frankreich
Was ist der Gegenstand der Studie von Nikola Tietze?
Die Studie von Nikola Tietze untersucht die Formen muslimischer Religiosität junger Männer in Deutschland und Frankreich. Sie analysiert, wie sich "Muslim sein" in Abhängigkeit von den jeweiligen gesellschaftlichen Umständen gestaltet und welche Strategien junge muslimische Männer zur Selbstdefinition und Identitätsfindung einsetzen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Studie?
Die Studie will zeigen, dass "Muslim sein" kein statisches Konzept ist, sondern sich dynamisch an gesellschaftliche Bedingungen anpasst. Sie analysiert die Integrations- und Identitätsprozesse junger muslimischer Männer in Deutschland und Frankreich im Vergleich und beleuchtet die Rolle des Islams als Ressource der Selbstentfaltung und Abgrenzung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Studie behandelt die Formen muslimischer Religiosität in beiden Ländern, den Einfluss gesellschaftlicher und politischer Rahmenbedingungen auf religiöse Praktiken, vergleichende Analysen der Integrationsprozesse, die Rolle des Islams als Ressource der Selbstfindung und Abgrenzung, sowie die öffentliche Wahrnehmung von Muslimen in Deutschland und Frankreich.
Wie ist das Buch aufgebaut?
Das Buch beginnt mit einer Einleitung und einer Vorstellung der Autorin. Es folgt ein Kapitel zu den politischen und sozialen Rahmenbedingungen in Deutschland und Frankreich. Die zentralen Thesen und Formen muslimischer Religiosität werden dargelegt, gefolgt von einer Analyse wissenschaftlicher Diskurse zum Thema. Ein umfangreicher Teil präsentiert Fallstudien junger muslimischer Männer in beiden Ländern. Es wird eine Typologie der Religiosität ("believing und belonging" in drei Phasen) vorgestellt, bevor ein Vergleich der religiösen Formen zwischen Deutschland und Frankreich gezogen und eine Schlussbetrachtung präsentiert wird.
Welche Methode wurde angewendet?
Die Studie basiert auf teilnehmender Beobachtung und Interviews. Die methodische Vorgehensweise wird in der Einleitung kurz skizziert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Studie?
Schlüsselwörter sind: Islamische Identitäten, Religiosität, junge Männer, Deutschland, Frankreich, Integration, Migration, Vergleichende Analyse, Identitätsbildung, Selbstentwurf, Wissenschaftliche Diskurse, soziale Rahmenbedingungen, politische Kontexte.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in jedem Kapitel?
Das Buch umfasst Kapitel zu Einleitung, der Autorin, den politischen und sozialen Rahmenbedingungen, zentralen Thesen und Formen muslimischer Religiosität, wissenschaftlichen Diskursen, Fallstudien junger Muslime in Deutschland und Frankreich, einer Typologie der Religiosität ("believing und belonging"), einem Vergleich der religiösen Formen zwischen den Ländern und einer Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel beleuchtet spezifische Aspekte der Thematik, von der Einführung bis zur vergleichenden Analyse und Schlussfolgerung.
Wie werden die Ergebnisse der Studie präsentiert?
Die Ergebnisse werden durch detaillierte Fallstudien junger muslimischer Männer in Deutschland und Frankreich illustriert. Diese Fallstudien verdeutlichen die Vielfalt und Komplexität religiöser Praktiken und deren Zusammenhang mit sozialem Umfeld und persönlicher Biografie. Die Ergebnisse werden zudem in einem Vergleich der religiösen Formen zwischen beiden Ländern zusammengefasst und interpretiert.
Was ist die zentrale These der Studie?
Die zentrale These ist, dass "Muslim sein" kein statisches Konzept ist, sondern sich dynamisch an die jeweiligen gesellschaftlichen Umstände anpasst. Die Studie zeigt die vielfältigen Strategien auf, mit denen junge muslimische Männer ihre Identität in diesen Kontexten gestalten.
- Citation du texte
- Angela Beyer (Auteur), 2008, Zu Nikola Tietzes "Islamische Identitäten. Formen muslimischer Religiosität junger Männer in Deutschland und Frankreich.", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124872