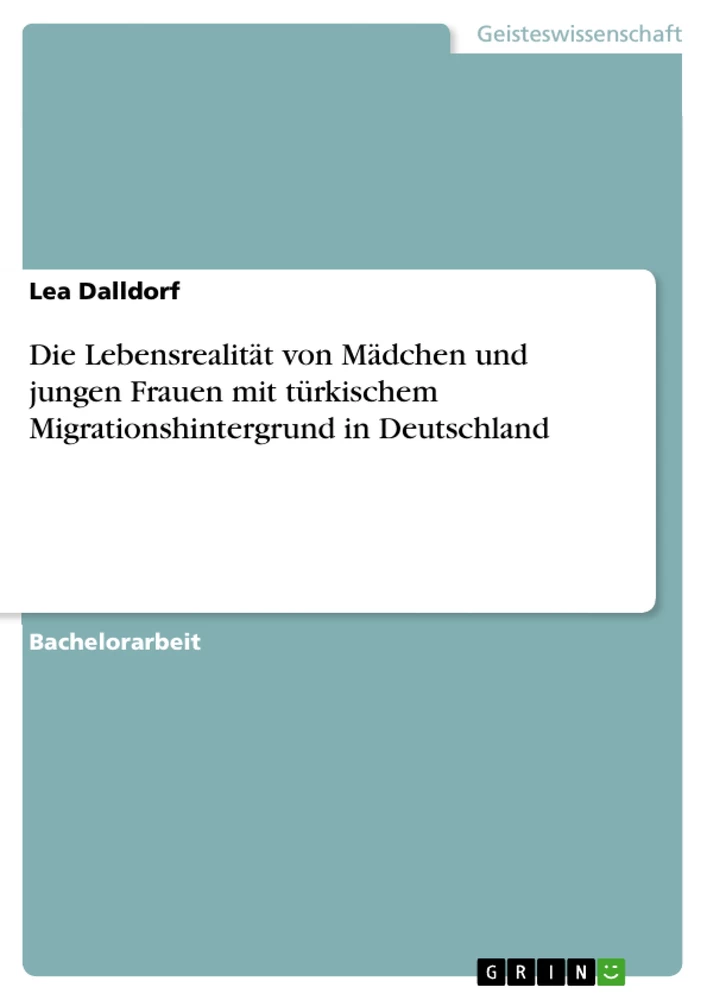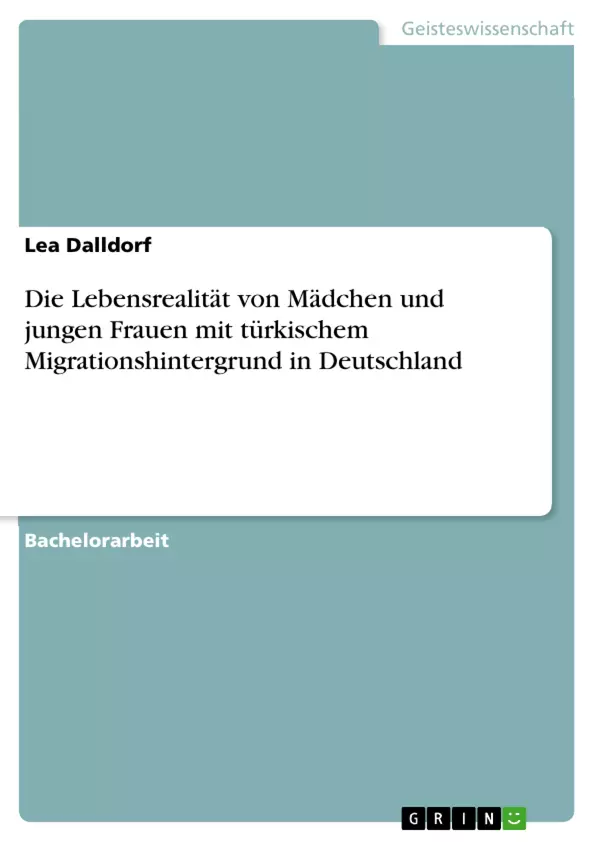Abstract
Entgegengesetzt der weit verbreiteten Annahmen, dass Frauen kaum an der aktiven Migration beteiligt sind, zeigt diese Arbeit auf, dass Frauen schon seit langer Zeit in unterschiedlichsten Formen keine ganz ungewichtige Rolle in der Migrationsbewegung spielen und das nicht nur in Zusammenhang mit dem Familiennachzug. Frauen migrieren aus unterschiedlichsten Gründen, in unterschiedlichsten Formen und tragen Sorge für ihre Familien.
Im Zuge der Anwerbung von Arbeitsmigranten seitens der Deutschen entwickelten sich die türkischen Arbeitsmigranten zu der größten Migrantengruppe in der BRD. Auch hier migrierten immer wieder türkische Frauen auf Grund von gezielter Anwerbung seitens des Aufnahmelandes. Auf Grund von beidseitigen unterschiedlichen und unerfüllten Erwartungen und Vorstellungen bezüglich des Aufenthaltes in der BRD, kam es in den Folgejahren zu unterschiedlichen Problematiken, die sich auch auf die Folgegenerationen nieder schlugen. Diese Problematiken bestehen zum Teil bis heute, welches jedoch nicht bedeuten kann, dass hier keine Unterschiede in der Lebensgestaltung von Mädchen und jungen Frauen mit türkischem Migrationshintergrund bestehen. In der Forschung bezüglich der Lebenslagen aus der Perspektive von Mädchen und jungen Frauen mit Migrationshintergrund mangelt es bisher an wissenschaftlich fundierten Arbeiten. Viele Arbeiten stützen sich immer wieder im Zusammenhang mit der bedeutenden Sozialisation eines Menschen auf den Ansatz der patriarchalischen Familienstruktur in der traditionellen türkischen Familie. Nach der aktuellen Forschungsarbeit von Boos-Nünning und Karakasoglu (2005) sehen sich Mädchen und junge Frauen mit türkischem Migrationshintergrund oft jedoch gar nicht so gebeutelt wie von der Öffentlichkeit angenommen, sondern fühlen sich im allgemeinen recht wohl in ihren Familien. Da Mädchen und junge Frauen mit türkischem Migrationshintergrund ebenso in Krisensituationen geraten können wie deutsche Mädchen, ergibt sich allein daher auf der Grundlage des KJHG ein staatlicher Auftrag für die Soziale Arbeit diese miteinzubeziehen.
Auch wenn hier sicherlich immer wieder ein Teil der bisher angenommenen Problematik besteht, ist es an der Zeit umzudenken und auch Unterschiede unter den Mädchen und jungen Frauen wahrzunehmen und anzuerkennen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Eine geschlechtsspezifische Perspektive
- 2.1 Frauen und Migration als Forschungsthema
- 2.2 Motive und Formen der Migration
- 2.3 „Abhängige“ im Unterschied zu „Unabhängiger“ Migration
- 3. Geschichtliches - Türkische Arbeitsmigranten in Deutschland -
- 3.1 Die Massenbeschäftigung von „Gastarbeitern“ in Deutschland
- 3.2 Problematiken der 1. Generation türkischer ArbeitsmigrantInnen in Deutschland
- 3.3 Die Frauen der 1. Generation
- 3.4 Ein Leben in Deutschland und die Folgegenerationen
- 4. Ein Leben zwischen oder mit zwei Welten - Mädchen und junge Frauen mit türkischem Migrationshintergrund heute -
- 4.1 Mädchen und junge Frauen mit Migrationshintergrund als Forschungsthema
- 4.2 Mädchen und jungen Frauen mit türkischem Migrationshintergrund in der BRD unter dem Aspekt der Sozialisation
- 4.2.1 Begriffsbestimmung: Sozialisation
- 4.2.2 Die Bedeutung der „türkischen Familie“ im Fokus der Öffentlichkeit
- 4.2.3 Die Bedeutung der „Familie“ und der elterlichen Erziehung für Mädchen und junge Frauen mit türkischem Migrationshintergrund
- 4.2.4 Sozialisationsinstanz Schule und die Bildung
- 4.2.5 Freizeit und Freundschaften
- 4.2.6 Die Religiosität oder der Islam und die Bedeutung des Kopftuches
- 5. Die Relevanz für die Soziale Arbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Lebensrealität von Mädchen und jungen Frauen mit türkischem Migrationshintergrund in Deutschland. Ziel ist es, ein differenziertes Bild ihrer Lebenslagen zu zeichnen und von vereinfachenden Stereotypen abzuweichen. Die Arbeit berücksichtigt dabei die geschichtliche Entwicklung der türkischen Migration nach Deutschland und die Rolle der Frauen darin.
- Die geschlechtsspezifische Perspektive auf türkische Migration
- Die Herausforderungen und Chancen der Integration für junge Frauen
- Die Rolle der Familie und der Sozialisation
- Der Einfluss von Schule und Freizeit auf die Lebensgestaltung
- Die Relevanz der Ergebnisse für die Soziale Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 dient als Einleitung. Kapitel 2 beleuchtet die Frauenrolle in der Migrationsgeschichte und analysiert verschiedene Migrationsmotive und -formen. Kapitel 3 beschreibt die Geschichte türkischer Arbeitsmigration nach Deutschland, inklusive der Herausforderungen der ersten Generation. Kapitel 4 fokussiert auf die Lebenswelten heutiger Mädchen und junger Frauen mit türkischem Migrationshintergrund, untersucht deren Sozialisationsprozesse und beleuchtet die Bedeutung von Familie, Schule, und Freizeit. Kapitel 5 diskutiert die Implikationen für die Soziale Arbeit.
Schlüsselwörter
Türkische Migration, Mädchen und junge Frauen, Migrationshintergrund, Sozialisation, Familie, Integration, Deutschland, Soziale Arbeit, Identität, Interkulturalität.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird die Rolle türkischer Frauen in der Migrationsgeschichte dargestellt?
Frauen migrierten nicht nur als "Anhänge" im Familiennachzug, sondern oft auch als eigenständig angeworbene Arbeitskräfte.
Was sind die zentralen Sozialisationsinstanzen für diese jungen Frauen?
Neben der Familie spielen die Schule, Freizeitaktivitäten, Freundschaften und die Religiosität (einschließlich der Bedeutung des Kopftuches) eine entscheidende Rolle.
Stimmt das öffentliche Bild der "gebeutelten" türkischen Mädchen?
Studien wie die von Boos-Nünning zeigen, dass sich viele Mädchen in ihren Familien wohlfühlen und das Bild der rein patriarchalisch unterdrückten Struktur oft zu einseitig ist.
Welche Relevanz hat das Thema für die Soziale Arbeit?
Auf Basis des KJHG besteht ein staatlicher Auftrag, diese Zielgruppe in Krisensituationen miteinzubeziehen und ihre spezifischen Lebensrealitäten anzuerkennen.
Was bedeutet "Leben zwischen zwei Welten"?
Es beschreibt die Herausforderung, die Erwartungen der traditionellen Herkunftskultur mit den Anforderungen der deutschen Mehrheitsgesellschaft zu vereinbaren.
- Citar trabajo
- Lea Dalldorf (Autor), 2008, Die Lebensrealität von Mädchen und jungen Frauen mit türkischem Migrationshintergrund in Deutschland, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124875