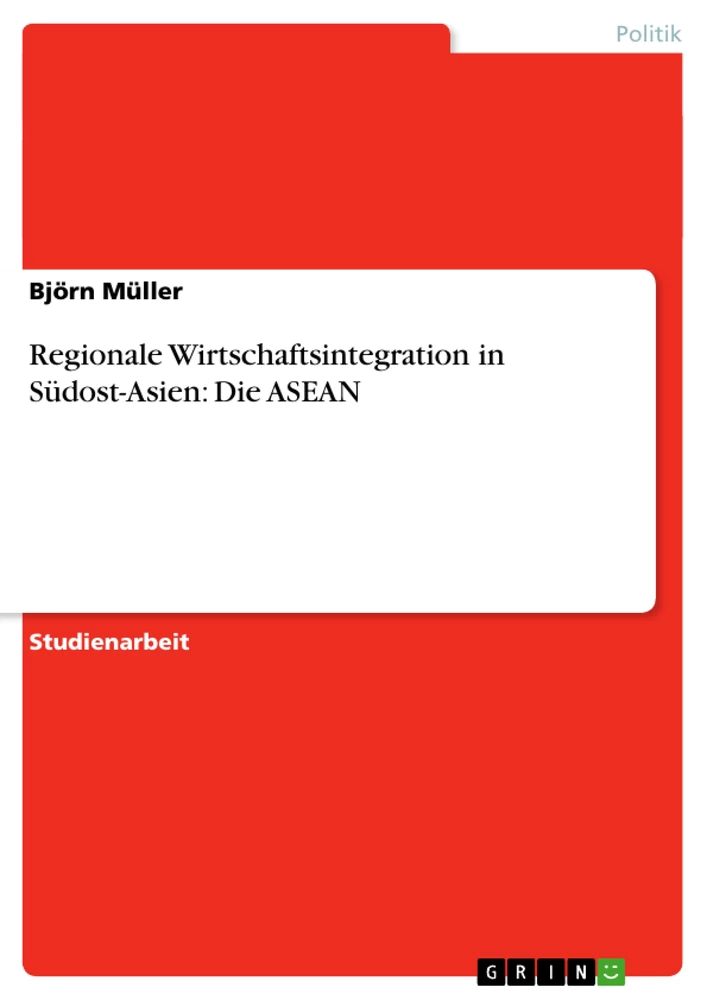421 Regionale Handelsabkommen sind zur Zeit bei der Welthandelsorganisation (WTO) gelistet (Stand Februar 2009). Vor allem Entwicklungs- u. Schwellenländer setzen auf regionale Wirtschaftsbündnisse. Bis zum Ende des Ost-West Konfliktes war dabei das positive Argument, über einen Bund mit Partnern auf Augenhöhe die eigene Ökonomie weiterzuentwickeln entscheidend. Bei dem Aufschwung solcher Wirtschaftskooperationen im Zuge des beschleunigten Globalisierungsprozess seit Anfang der 1990er Jahre war dann das negative Argument einer Gefahr der Ausgrenzung im globalen Kampf um Investitionen der ausschlaggebende Faktor. Eines der komplexesten dieser Integrationsprojekte ist die Vereinigung Südostasiatischer Länder (ASEAN). Bereits 1967 gegründet, gehören ihr heute alle wichtigen Staaten der Region an. Mit rund 560 Millionen Menschen bildet Sie einen größeren Markt als die Europäische Union. Ihr Gesamt-BIP betrug 2006 1,73 Billionen US-Dollar. 53.330 Milliarden US-Dollar flossen ein Jahr zuvor als ausländische Direktinvestionen (ADI) in das Bündnis. Durch Kooperationen mit anderen Staaten bildet die ASEAN eine wichtige Plattform zur Sicherheitspolitik in Südostasien. Obwohl alle ASEAN-Staaten Erfolge beim Aufbau ihrer Volkswirtschaften erzielten, ist das Entwicklungsniveau bis heute stark unterschiedlich. Singapur und Malaysia sind moderne Industriestaaten, während das größte Mitglied Indonesien auf der unteren Skala der Schwellenländer firmiert. Länder wie Burma und Laos sind noch auf der Stufe von Entwicklungsländern8. Entgegen dem von der ASEAN propagierten Integrationswillen, beziffert sich der interne Handel der ASEAN Staaten 2007 auf lediglich 25 Prozent, während der Außenhandel 75 Prozent ausmachte. Diesen Widersprüchen folgt die vorliegende Arbeit unter der Leitfrage, in wie weit die ASEAN zum wirtschaftlichen Erfolg ihrer Mitglieder beigetragen hat? Hierfür wird der integrationspolitische Ansatz des Bündnisses, die Entwicklungsphasen und schließlich seine Organisationsstruktur nach obiger Fragestellung untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Integrationspolitischer Ansatz
- Ausgangslage des Bündnisses
- Der „ASEAN Way“
- Die „Negative Solidarität“
- Der Integrationsprozess bis Heute
- Das „Verlorene Jahrzehnt“ - Die Jahre von 1967 bis 1976
- Die „Intensivierungsphase“ - Die Jahre 1976 bis 1992
- Die „Neue/Alte ASEAN“ - Seit 1992 bis Heute
- Institutionelle Architektur und Entscheidungsverfahren
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Beitrag der ASEAN zum wirtschaftlichen Erfolg ihrer Mitglieder. Die Analyse konzentriert sich auf den integrationspolitischen Ansatz der ASEAN, die verschiedenen Entwicklungsphasen des Bündnisses und dessen Organisationsstruktur.
- Der integrationspolitische Ansatz der ASEAN und seine Entstehungsgeschichte
- Die verschiedenen Phasen des Integrationsprozesses in Südostasien
- Die institutionelle Architektur und die Entscheidungsfindung innerhalb der ASEAN
- Das Verhältnis von innerem und äußerem Handel der ASEAN-Staaten
- Die Rolle der Sicherheitspolitik im Kontext der regionalen Wirtschaftsintegration
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die ASEAN im Kontext globaler Regionalisierung vor und skizziert die Forschungsfrage. Der Abschnitt zum integrationspolitischen Ansatz beleuchtet die Ausgangslage in Südostasien 1967, den „ASEAN Way“ und das Konzept der „negativen Solidarität“, die die Gründung der ASEAN prägten. Die Darstellung des Integrationsprozesses beschreibt die Herausforderungen und Entwicklungen in verschiedenen Phasen der ASEAN-Geschichte.
Schlüsselwörter
ASEAN, Regionale Wirtschaftsintegration, Südostasien, Wirtschaftsentwicklung, Globalisierung, Sicherheitspolitik, „ASEAN Way“, „Negative Solidarität“, Regionalismus, Entwicklungsländer, Schwellenländer.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die ASEAN und welches Ziel verfolgt sie?
Die ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) ist ein regionales Wirtschaftsbündnis in Südostasien, das die wirtschaftliche Entwicklung und Sicherheitspolitik der Mitgliedstaaten fördern will.
Was versteht man unter dem „ASEAN Way“?
Der „ASEAN Way“ beschreibt einen kooperativen Ansatz, der auf Konsensbildung, informellen Gesprächen und der Nicht-Einmischung in innere Angelegenheiten basiert.
Wie erfolgreich ist die wirtschaftliche Integration innerhalb der ASEAN?
Obwohl die ASEAN ein großer Markt ist, betrug der interne Handel 2007 nur etwa 25 Prozent, während der Außenhandel mit 75 Prozent dominierte.
Welche Länder gehören zur ASEAN und wie unterscheiden sie sich wirtschaftlich?
Zu den Mitgliedern gehören u.a. Singapur und Malaysia (Industriestaaten), Indonesien (Schwellenland) sowie Burma und Laos (Entwicklungsländer).
Was bedeutet der Begriff „Negative Solidarität“ im Kontext der ASEAN?
Er bezieht sich auf den Zusammenhalt aus der Sorge vor Ausgrenzung im globalen Wettbewerb um Investitionen und dem Wunsch nach kollektiver Sicherheit.
Welche Rolle spielt die Sicherheitspolitik für das Bündnis?
Die ASEAN dient als wichtige Plattform zur Stabilisierung der Region und zur Vermeidung von Konflikten zwischen den südostasiatischen Staaten.
- Arbeit zitieren
- Björn Müller (Autor:in), 2009, Regionale Wirtschaftsintegration in Südost-Asien: Die ASEAN, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124888