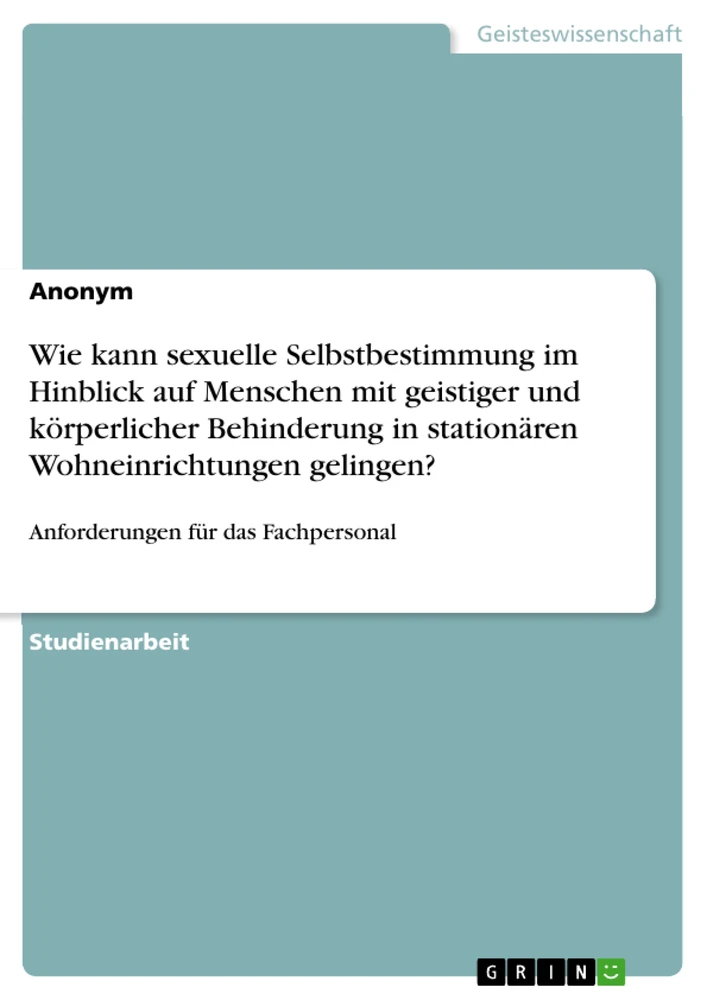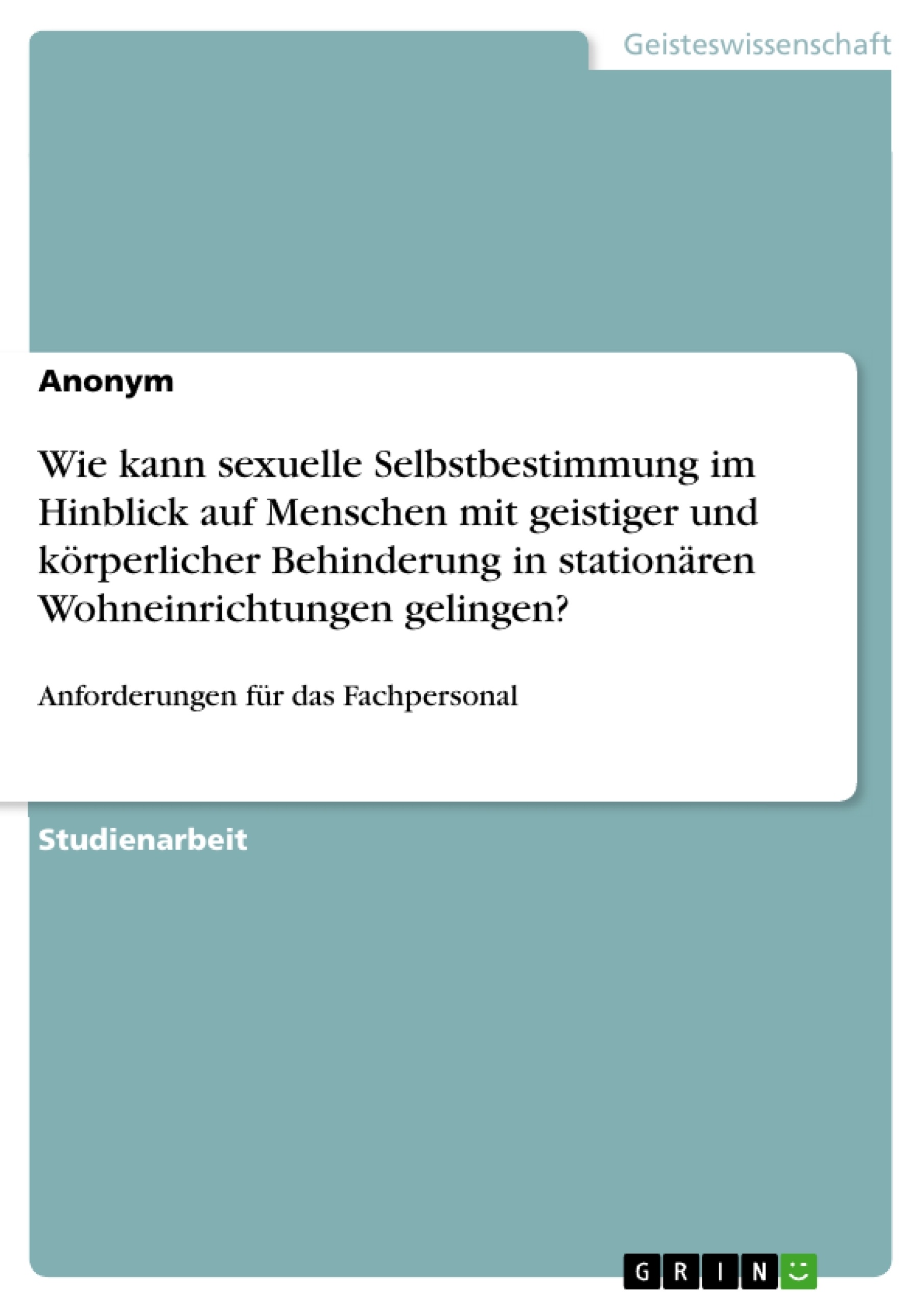In dieser Arbeit wird die sexuelle Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung aufgedeckt, indem erforscht wird, wie diese in Wohneinrichtungen gelingen kann. Dazu werden die Positionen der Organisationen sowie des Fachpersonals dargestellt, woraufhin der Versuch erfolgt, die Fragestellung zu beantworten.
Sexualität. Ein Thema, das in vielen nicht europäischen Gesellschaften ein absolutes Tabuthema ist. Bis vor einigen Jahren war dies auch in der deutschen Gesellschaft der Fall. Dass das Thema Sexualität in Gesprächen nicht aufgerollt werden darf, war ein ungeschriebenes Gesetz - bis jetzt. Die deutsche Gesellschaft geht mit dem Thema wesentlich lockerer um, indem beispielsweise in der Schule dies als ein Aufklärungsformat angeboten wird. Zudem werden viele sexuelle Orientierungen von der Gesellschaft respektiert und akzeptiert und jeder Mensch darf diese auch so ausleben, dass er/sie zufrieden ist und niemanden gegen seinen/ihren Willen belästigt. Mit dem Begriff "jeder Mensch" wird keiner ausgeschlossen. Jeder Mensch - unabhängig von der Nationalität, der Hautfarbe, dem Geschlecht und der Religion - hat ein Recht sein/ihr sexuelles Leben auszuleben. Doch was ist mit den Menschen, die eine geistige und/oder eine körperliche Behinderung haben? Haben diese Menschen ein Recht auf Sex? Die Spekulationen, ob diese betroffenen Personen überhaupt Geschlechtsverkehr haben, ist immer vorhanden, da diese Menschen "behindert" sind. Und dieser Begriff beinhaltet eine negative Konnotation.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorie der Fragestellung
- Definition der sexuellen Selbstbestimmung
- Was ist eine Behinderung?
- Das Problem der sexuellen Selbstbestimmung und der Behinderung
- Organisation der Wohneinrichtung
- Adressaten und Adressatinnen im Kontext der sexuellen Selbstbestimmung
- Position der Wohneinrichtung hinsichtlich sexueller Selbstbestimmung
- Wie geht das Fachpersonal mit der Selbstbestimmung um?
- Fazit
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die sexuelle Selbstbestimmung von Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen in stationären Wohneinrichtungen. Sie analysiert, welche Anforderungen sich aus dem Anspruch auf sexuelle Selbstbestimmung für das pädagogische Fachpersonal ergeben.
- Definition und Bedeutung der sexuellen Selbstbestimmung
- Spezifische Herausforderungen der sexuellen Selbstbestimmung im Kontext von Behinderung
- Rolle und Aufgaben des pädagogischen Fachpersonals in Bezug auf sexuelle Selbstbestimmung
- Analyse der Positionen von Wohneinrichtungen hinsichtlich sexueller Selbstbestimmung
- Potentiale und Grenzen der Förderung sexueller Selbstbestimmung in Wohneinrichtungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der sexuellen Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung in den Kontext der gesellschaftlichen Debatte und führt die Relevanz der Fragestellung für die Praxis der Sozialen Arbeit heraus.
Das zweite Kapitel definiert den Begriff der sexuellen Selbstbestimmung und erläutert den Begriff der Behinderung anhand des Sozialgesetzbuches. Es wird das Problem der sexuellen Selbstbestimmung im Kontext der Behinderung aufgezeigt.
Das dritte Kapitel beleuchtet die Organisation der Wohneinrichtung und stellt die Adressaten und Adressatinnen im Kontext der sexuellen Selbstbestimmung vor. Es werden die Position der Wohneinrichtung hinsichtlich sexueller Selbstbestimmung sowie die Herangehensweise des Fachpersonals an die Selbstbestimmung der Bewohnerinnen und Bewohner diskutiert.
Schlüsselwörter
Sexuelle Selbstbestimmung, Behinderung, geistige Behinderung, körperliche Behinderung, Wohneinrichtungen, Fachpersonal, soziale Arbeit, Inklusion, Partizipation, Empowerment, Recht auf Selbstbestimmung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet sexuelle Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderung?
Es bedeutet das Recht, die eigene Sexualität frei und nach eigenen Wünschen auszuleben, unabhängig von körperlichen oder geistigen Einschränkungen, solange dies konsensual geschieht.
Welche Rolle spielt das Fachpersonal in Wohneinrichtungen dabei?
Pädagogische Fachkräfte müssen den Spagat zwischen Schutzauftrag und der Förderung von Autonomie bewältigen. Sie sollten Bewohner unterstützen, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und auszudrücken.
Warum wird das Thema Sexualität bei Behinderung oft tabuisiert?
Oftmals haften dem Begriff "behindert" negative Konnotationen an, die dazu führen, dass Betroffenen sexuelle Bedürfnisse abgesprochen oder diese als problematisch angesehen werden.
Welche gesetzlichen Grundlagen stützen das Recht auf Sexualität?
Das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung ist ein Menschenrecht und wird in Deutschland unter anderem durch das Sozialgesetzbuch (SGB) im Kontext der Teilhabe und Inklusion gestützt.
Wie können Wohneinrichtungen die Selbstbestimmung fördern?
Durch klare Konzepte, die Bereitstellung von Rückzugsräumen, Aufklärungsangebote und eine offene, vorurteilsfreie Haltung des Personals.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2022, Wie kann sexuelle Selbstbestimmung im Hinblick auf Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung in stationären Wohneinrichtungen gelingen?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1248959