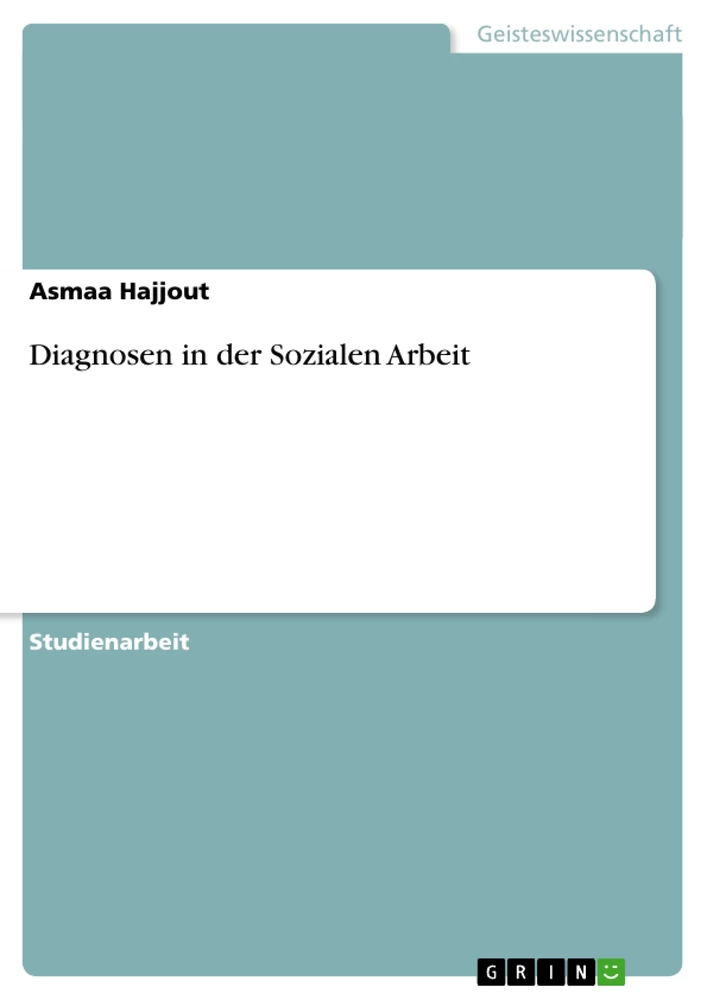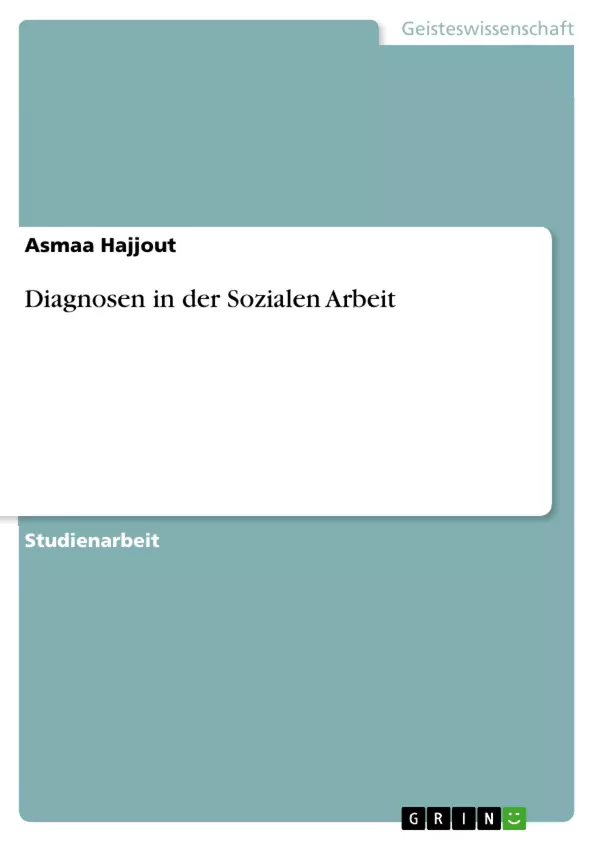Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Thematik Diagnosen in der Sozialen Arbeit. Zentrale Fragestellung ist, inwiefern sich soziale Diagnosen von der damaligen Zeit bis heute entwickeln und etablieren konnten. So gilt es zunächst einmal die historische Entwicklung der Diagnosen in der Sozialen Arbeit darzustellen. Wer war der Vorreiter dieses Modells und welcher Hintergrundgedanke führte dazu, dass das Arbeiten mit Diagnosen als wichtiges Instrumentarium der Sozialen Arbeit zu definieren ist. Durch das Herausarbeiten der historischen Entwicklung soll dem Leser die anknüpfende Entwicklung in der heutigen Zeit verständlich gemacht werden. Somit werden auch Gemeinsamkeiten und Verknüpfungen in den Grundüberlegungen festgestellt. Vorallendingen taucht die Frage auf, ob das Arbeiten mit Diagnosen eine Voraussetzung für eine „Professionalisierung“ der Sozialen Arbeit ist. In den nachfolgenden Punkten werden wichtige Merkmale der vorherrschenden Diagnoseformen in der Sozialen Arbeit erläutert, um Unterschiede und eventuelle Gemeinsamkeiten auf zu zeigen. Anschließend beantwortet Punkt 5 die Frage, welchen Nutzen man aus dem Arbeiten mit Diagnosen ziehen kann, wo liegen die Vorteile der sozialpädagogischen und psychsozialen Diagosen und vorallem wird der Frage nachgegangen, in welcher Form die Diagnosen eine Unterstützung für die Soziale Arbeit dargestellt. Abschließend werden die Problemfelder aufgezeigt, die nicht vermeidbar sind, wenn man beschließt Diagnosen als Arbeitsweise zu nutzen. Diese Arbeit soll einen kurzen Gesamtüberblick über diese Thematik geben, welches sich breit fächert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffserklärung Diagnose
- Historische Entwicklung der Diagnose
- Diagnoseformen in der Sozialen Arbeit
- Sozialpädagogische Diagnose
- Psychosoziale Diagnose
- Nutzen von Diagnosen in der Sozialen Arbeit
- Kritikpunkte für das Arbeiten mit Diagnosen in der Sozialen Arbeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung und Etablierung sozialer Diagnosen in der Sozialen Arbeit. Sie beleuchtet die historische Entwicklung, untersucht verschiedene Diagnoseformen und deren Nutzen, und schließlich analysiert sie kritische Aspekte des Einsatzes von Diagnosen.
- Historische Entwicklung sozialer Diagnosen
- Vergleichende Analyse verschiedener Diagnoseformen in der Sozialen Arbeit
- Nutzen und Vorteile von Diagnosen
- Kritische Auseinandersetzung mit dem Einsatz von Diagnosen
- Bedeutung von Diagnosen für die Professionalisierung der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: die Entwicklung und Etablierung sozialer Diagnosen. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die zu behandelnden Aspekte.
Kapitel 2: Begriffserklärung Diagnose: Dieses Kapitel klärt den Begriff „Diagnose“ und definiert ihn im Kontext der Sozialen Arbeit. Verschiedene Definitionen werden vorgestellt und miteinander verglichen.
Kapitel 3: Historische Entwicklung der Diagnose: Hier wird die Entwicklung sozialer Diagnosen nachgezeichnet, wobei Alice Salomon und Mary Richmond als wichtige Wegbereiterinnen genannt werden. Die Grundidee und die fünf Schritte der sozialen Diagnose nach Salomon werden erläutert.
Kapitel 4: Diagnoseformen in der Sozialen Arbeit: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Diagnoseformen in der Sozialen Arbeit, darunter die sozialpädagogische und die psychosoziale Diagnose. Unterschiede und Gemeinsamkeiten werden herausgearbeitet.
Schlüsselwörter
Soziale Diagnose, Professionalisierung der Sozialen Arbeit, Alice Salomon, Mary Richmond, sozialpädagogische Diagnose, psychosoziale Diagnose, Hilfeprozess, methodische Erforschung, Ist- und Sollzustand1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
- Citar trabajo
- Asmaa Hajjout (Autor), 2009, Diagnosen in der Sozialen Arbeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125000