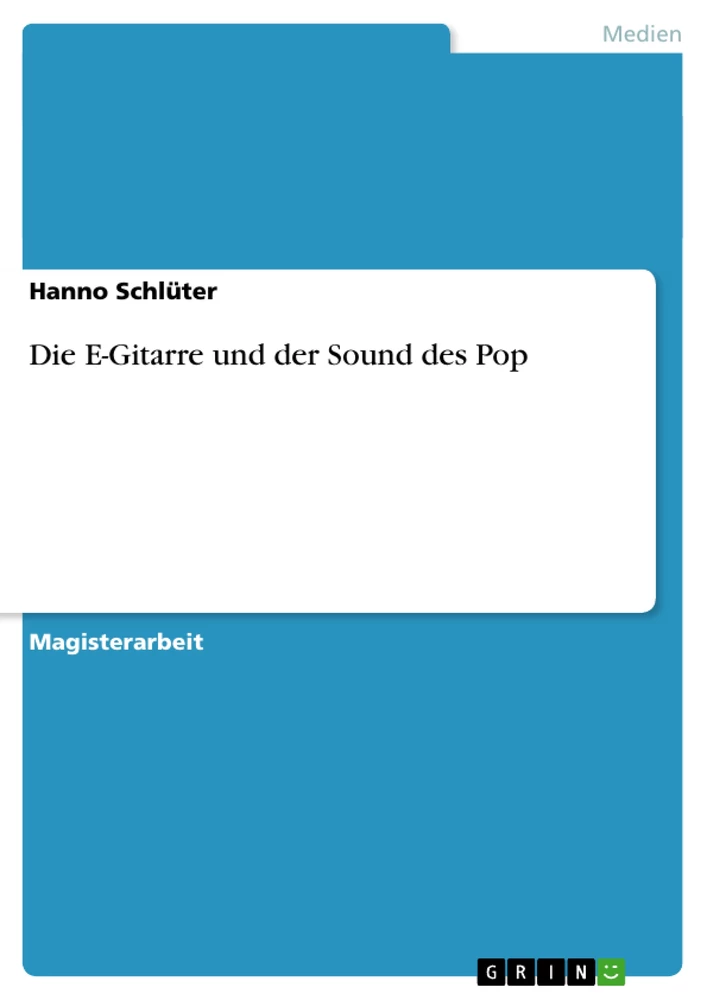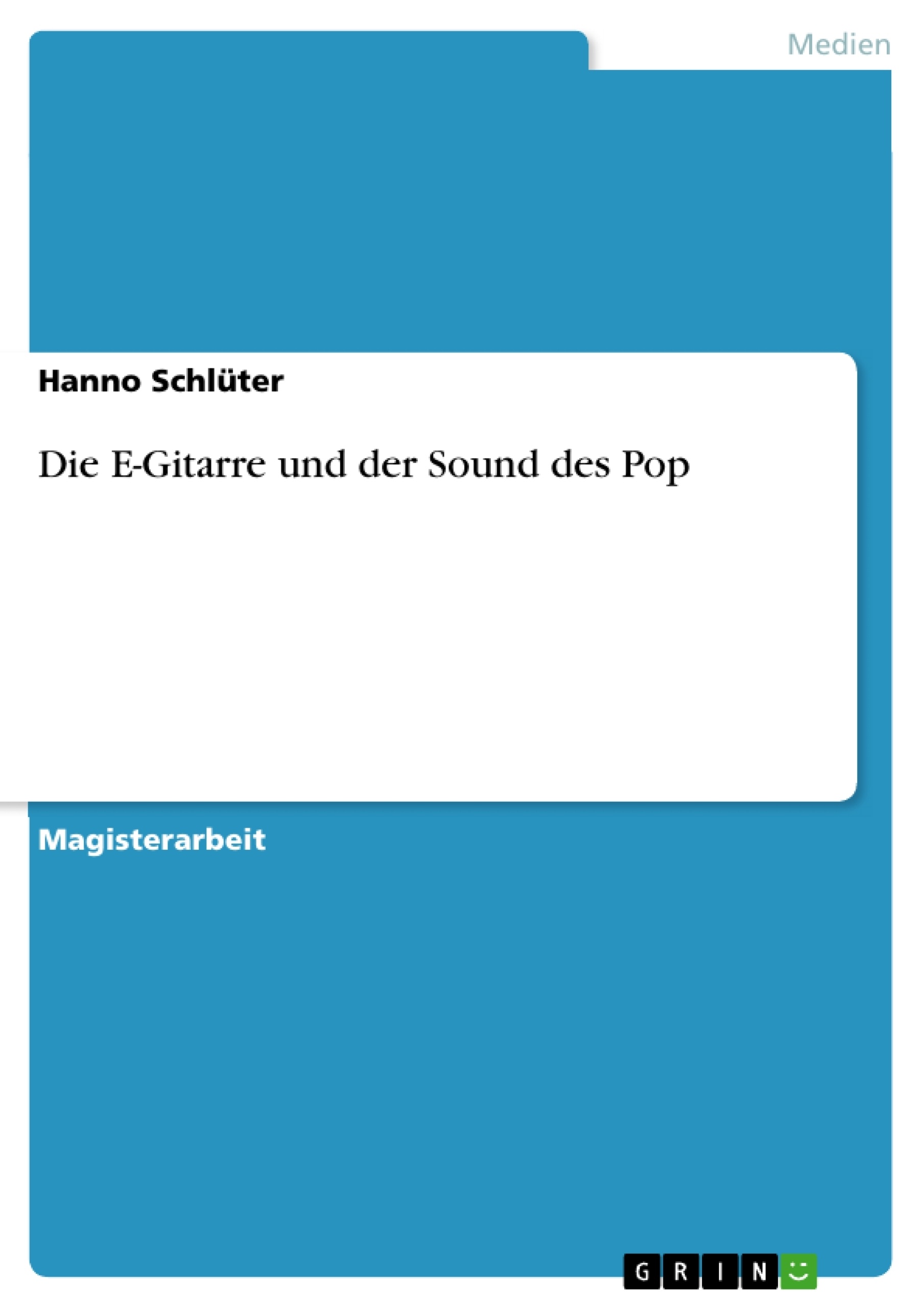Von Ludwig van Beethoven ist ein Ausspruch überliefert, den er in prophetischer Vorsehung geäußert haben soll: „Wenn ein Instrument das Orchester im Kleinen nachzuahmen imstande ist, dann ist es nur die Gitarre.“ [zit. n. Schiffner 1994, S.74] Ich möchte in dieser Arbeit darstellen, welchen Einfluss die elektrische Gitarre auf die Evolution des Sounds der Popmusik hatte und wie sich dieser Einfluss retrospektiv bewerten lässt.
Dazu stelle ich im folgenden Kapitel die Grundlagen des Instrumentenbaus und der Funktionsweise der E-Gitarre vor. Die technischen Details, die in diesem Abschnitt thematisiert werden, sollen ein tieferes Verständnis der darauf folgenden Kapitel ermöglichen. Das dritte Kapitel ist dem Begriff Sound und seinen Interpretationsmöglichkeiten gewidmet. Grundlegend ist auch hier das Verständnis für die Entwicklung des Konzepts Sound durch die Erzeugnisse der Tonaufzeichnungstechnik. Es folgt eine Übersicht über die vorliegenden Studien zum Thema Sound und eine Bewertung der dargestellten Konzepte für den Sound-Begriff in dieser Arbeit. Kapitel Nummer vier setzt sich mit den Problemen eines analytischen Zugriffs auf populäre Musikformen kritisch auseinander und präsentiert eine Methode, die der Analyse von Popmusik dienlich sein kann. Im fünften Kapitel geht es um die Anwendung der vorgestellten Analysemethode. Dabei wird anhand von zehn Beispielsongs die Bedeutung der E-Gitarre für den jeweiligen Song plausibel gemacht. Hierauf folgt stets eine kurze Einordnung in den pophistorischen Gesamtkontext. Das sechste Kapitel thematisiert den Status der E-Gitarre in einem zunehmend digitalen Umfeld, sowohl in Hinsicht auf das Design des Instruments als auch mit Rücksicht auf produktionstechnische Aspekte.
Der Arbeit unterliegen die erkenntnisleitenden Fragen nach
1. dem Einfluss der E-Gitarre auf die Evolution der Popmusik
2. der Bedeutung unterschiedlicher Konzepte von Sound
3. der Zukunftsfähigkeit des Sounds der elektrischen Gitarre.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die elektrische Gitarre
- 2.1 Historische Grundlagen
- 2.2 Die E-Gitarre - Instrumentenbau und Funktionsweise
- 2.2.1 Die Tonabnehmer
- 2.2.2 Die Saiten
- 2.2.3 Der Korpus
- 2.2.4 Der Gitarrenverstärker
- 2.2.5 Die Lautsprecher
- 3. Der Sound des Pop
- 3.1 Vom Ton zum Sound
- 3.2 Sound auf Platte
- 3.3 Sound in der Wissenschaft
- 4. Die Analyse von Popmusik
- 4.1 Das Problem des Materials
- 4.2 Analysemethode nach Alan F. Moore
- 5. Der Sound der E-Gitarre in der Popmusik
- 5.1 Les Paul & Mary Ford - How high the moon
- 5.2 Bill Haley and His Comets - Rock around the clock
- 5.3 The Beatles - She loves you
- 5.4 Jimi Hendrix - Voodoo Child (Slight Return)
- 5.5 The Rolling Stones – Brown Sugar
- 5.6 Isaac Hayes - Theme from "Shaft"
- 5.7 The Eagles - Hotel California
- 5.8 Van Halen – Jump
- 5.9 Nirvana Smells like teen spirit
- 5.10 Nickelback – How you remind me
- 6. Die Gitarre im Zeitalter ihrer digitalen Produzierbarkeit
- 7. Fazit & Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht den Einfluss der elektrischen Gitarre auf die Entwicklung des Sounds in der Popmusik. Ziel ist es, diesen Einfluss zu beleuchten und retrospektiv zu bewerten. Die Arbeit befasst sich sowohl mit technischen Aspekten des Instruments als auch mit der Entwicklung des Sound-Begriffs selbst.
- Der Einfluss der E-Gitarre auf die Evolution der Popmusik
- Die Bedeutung unterschiedlicher Konzepte von "Sound"
- Die historische Entwicklung der E-Gitarre
- Analysemethoden für populäre Musik
- Die E-Gitarre im digitalen Zeitalter
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss der E-Gitarre auf die Popmusikentwicklung sowie die Bedeutung verschiedener Soundkonzepte und die Zukunftsfähigkeit des Gitarrensounds in den Mittelpunkt. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und die methodischen Ansätze.
2. Die elektrische Gitarre: Dieses Kapitel behandelt die Geschichte und die Funktionsweise der E-Gitarre. Es beleuchtet die historischen Wurzeln des Instruments, beginnend mit frühen gitarrenähnlichen Instrumenten bis hin zur Elektrifizierung im 20. Jahrhundert. Der Fokus liegt auf den technischen Details des Instrumentenbaus und der Funktionsweise, um ein Verständnis für die folgenden Kapitel zu schaffen. Die Entwicklung von der akustischen zur elektrischen Gitarre wird detailliert nachvollzogen, inklusive der Entwicklung von Tonabnehmern, Saiten, Korpus und Verstärkern.
3. Der Sound des Pop: Dieses Kapitel widmet sich dem Begriff "Sound" und seinen verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten. Es analysiert die Entwicklung des Sound-Konzepts im Kontext der Tonaufzeichnungstechnik. Weiterhin werden existierende wissenschaftliche Studien zum Thema Sound vorgestellt und für die vorliegende Arbeit bewertet. Der Abschnitt legt den Grundstein für die anschließende Analyse der Popmusik, indem er verschiedene Definitionen und Perspektiven auf den Soundbegriff beleuchtet und deren Bedeutung für die Musikproduktion und -rezeption erörtert.
4. Die Analyse von Popmusik: Das Kapitel setzt sich kritisch mit den Herausforderungen auseinander, die bei der Analyse von Popmusik auftreten. Es präsentiert eine geeignete Analysemethode (nach Alan F. Moore), die im weiteren Verlauf der Arbeit zur Untersuchung der Rolle der E-Gitarre in ausgewählten Songs eingesetzt wird. Die kritische Auseinandersetzung mit der Methodik der populärmusikalischen Analyse bildet die Grundlage für die Anwendung der gewählten Methode in den folgenden Kapiteln.
5. Der Sound der E-Gitarre in der Popmusik: In diesem Kapitel wird die gewählte Analysemethode auf zehn ausgewählte Popsongs angewendet, um die Bedeutung der E-Gitarre für den jeweiligen Song nachzuweisen und in den pophistorischen Kontext einzuordnen. Die detaillierte Analyse jedes Songs zeigt die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und den Einfluss der E-Gitarre auf den jeweiligen Sound.
6. Die Gitarre im Zeitalter ihrer digitalen Produzierbarkeit: Dieses Kapitel beleuchtet den Einfluss der digitalen Technologien auf die E-Gitarre, sowohl in Bezug auf ihr Design als auch auf die Produktionsprozesse. Es untersucht, wie die Digitalisierung die Möglichkeiten der Klanggestaltung und -produktion verändert hat und wie sich diese Veränderungen auf den Sound der E-Gitarre auswirken. Der Abschnitt beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, die sich für die E-Gitarre im digitalen Zeitalter ergeben.
Schlüsselwörter
E-Gitarre, Popmusik, Sound, Instrumentenbau, Funktionsweise, Tonaufzeichnung, Musikproduktion, Analysemethoden, Popgeschichte, digitale Technologien, Klanggestaltung.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: Der Sound der E-Gitarre in der Popmusik
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht den Einfluss der elektrischen Gitarre auf die Entwicklung des Sounds in der Popmusik. Sie beleuchtet diesen Einfluss retrospektiv und betrachtet sowohl technische Aspekte des Instruments als auch die Entwicklung des Sound-Begriffs selbst.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung der E-Gitarre, verschiedene Konzepte von "Sound", Analysemethoden für populäre Musik, die Rolle der E-Gitarre in ausgewählten Popsongs, und den Einfluss digitaler Technologien auf die E-Gitarre.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Die elektrische Gitarre, Der Sound des Pop, Die Analyse von Popmusik, Der Sound der E-Gitarre in der Popmusik, Die Gitarre im Zeitalter ihrer digitalen Produzierbarkeit und Fazit & Ausblick. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz erläutert. Es folgen Kapitel, die die E-Gitarre, den Soundbegriff und Analysemethoden detailliert beschreiben. Der Kern der Arbeit liegt in der Analyse von zehn ausgewählten Popsongs, gefolgt von einem Kapitel über den Einfluss digitaler Technologien und einem abschließenden Fazit.
Welche Analysemethode wird verwendet?
Die Arbeit verwendet eine Analysemethode nach Alan F. Moore, um die Rolle der E-Gitarre in ausgewählten Popsongs zu untersuchen. Die Wahl der Methode wird begründet und kritisch reflektiert.
Welche Songs werden analysiert?
Die Arbeit analysiert zehn Popsongs, darunter "How high the moon" von Les Paul & Mary Ford, "Rock around the clock" von Bill Haley and His Comets, "She loves you" von den Beatles, "Voodoo Child (Slight Return)" von Jimi Hendrix, "Brown Sugar" von den Rolling Stones, "Theme from "Shaft"" von Isaac Hayes, "Hotel California" von den Eagles, "Jump" von Van Halen, "Smells like teen spirit" von Nirvana und "How you remind me" von Nickelback.
Wie wird der Begriff "Sound" in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit analysiert den Begriff "Sound" und seine verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten im Kontext der Tonaufzeichnungstechnik und bestehender wissenschaftlicher Studien. Die verschiedenen Definitionen und Perspektiven werden erörtert und deren Bedeutung für Musikproduktion und -rezeption herausgearbeitet.
Welchen Einfluss haben digitale Technologien auf die E-Gitarre?
Die Arbeit beleuchtet den Einfluss digitaler Technologien auf das Design der E-Gitarre und die Produktionsprozesse. Sie untersucht, wie die Digitalisierung die Klanggestaltung und -produktion verändert hat und welche Herausforderungen und Chancen sich daraus ergeben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: E-Gitarre, Popmusik, Sound, Instrumentenbau, Funktionsweise, Tonaufzeichnung, Musikproduktion, Analysemethoden, Popgeschichte, digitale Technologien, Klanggestaltung.
Wo finde ich weitere Informationen?
Die vollständige Magisterarbeit enthält detaillierte Informationen zu allen Aspekten des Themas. (Hinweis: Hier müsste der Zugriff auf die vollständige Arbeit angegeben werden).
- Quote paper
- Magister Artium Hanno Schlüter (Author), 2008, Die E-Gitarre und der Sound des Pop, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125002