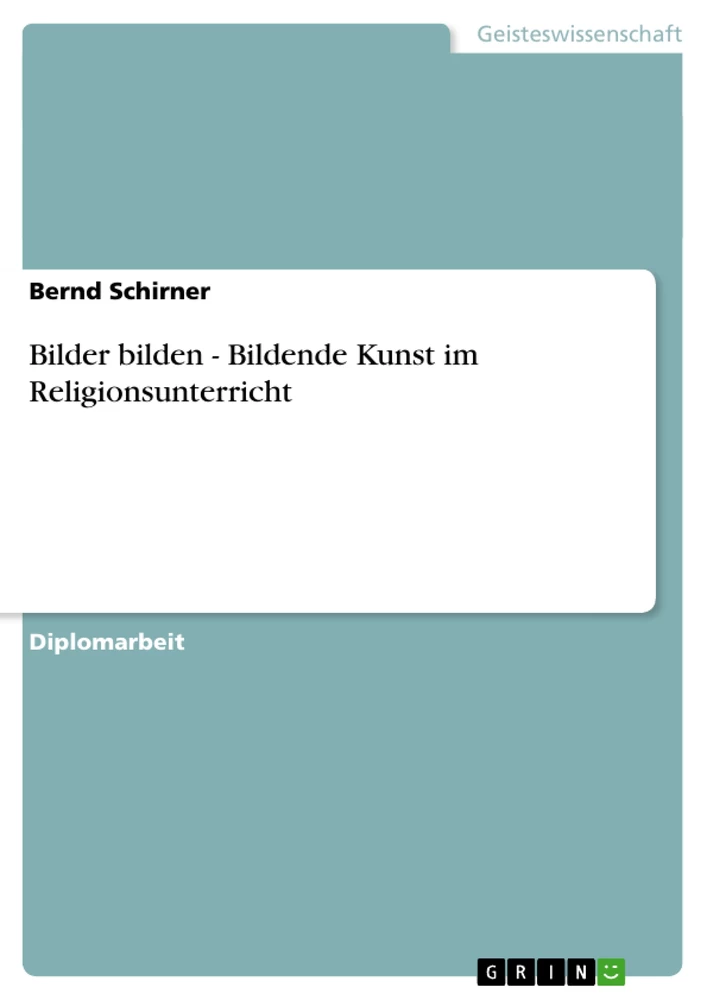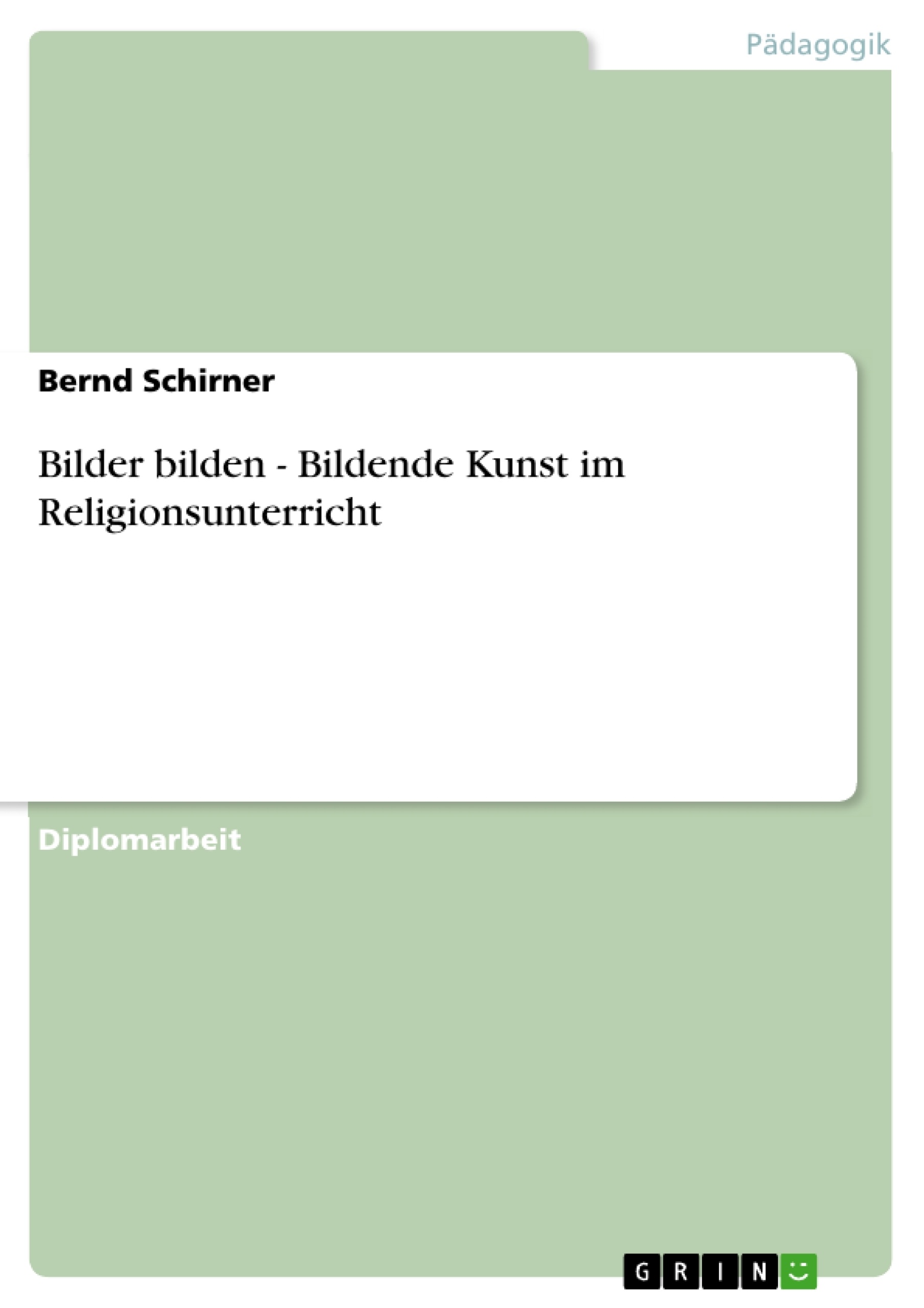Herr Schirner hat eine außerordentlich schöne und umfangreiche Diplomarbeit eingereicht. Beim Durchblättern fallen der Bilderreichtum, die Buntheit und das gediegene Layout der Arbeit sofort auf.
Wer sich genauer in die Arbeit vertieft, merkt zusätzlich neben der äußerlichen Schönheit die tiefere Auseinandersetzung mit folgenden Fragen:
• Wie bilden Bilder? Was kann von Bildern erhofft werden, wenn ihre Wahrnehmung subjektiv abhängig ist von Vorwissen, emotionaler Befindlichkeit und Lebensumständen?
• Bilden Bilder im Religionsunterricht? Wenn ja, wie müssen diese Bilder gestaltet sein?
• Wie lassen sich Bilder von Salvador Dali sinnvoll im Religionsunterricht verwenden? Ist mehr erreichbar als nur Bekanntschaft mit einem großen Künstler, wie sie im Zeichenunterricht auch erfolgen könnte?
Die Auseinandersetzung mit Fragen dieser Art erfolgt auf dreifache Weise:
• Psychologisch wird das Phänomen der Wahrnehmung und der subjektiven Bildaneignung sowohl durch Betrachten als auch durch kindliches Zeichnen beschrieben.
• Empirisch wird erforscht, welche Möglichkeiten der Religionsunterricht bietet, sinnvoll und passend zum Lehrplan drei verschiedene Dali-Bilder einzusetzen. Ergebnisse der kindlichen Beschäftigung mit diesen Bildern werden gesammelt und kritisch analysiert.
• Sehr persönlich werden jeweils Zugänge zu den drei Bildern hergestellt und zwar durch eigenständige Bildmeditationen des Verfassers und durch eigene lyrische Verarbeitungen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Sehen – Wahrnehmen – Erkennen
- Das Auge als Sinnesorgan
- Was verstehen wir unter Wahrnehmung?
- Wahrnehmung geschieht auf dem breiten Spektrum aller Sinne
- Tabelle: Die Sinnesorgane
- Schlussfolgerungen
- Das Erkennen von Objekten
- Rückschlüsse auf die Wahrnehmung Bildender Kunst
- Was geschieht beim Betrachten eines Kunstwerkes?
- Bilder bilden
- Geschichtliche Beobachtungen
- Rückschlüsse daraus
- Wie können wir sehen lernen?
- Kinderzeichnungen, ein Zugang zum Sehenlernen
- Entwicklungsschritte
- Naiver Realismus
- Kritischer Realismus
- Jugendalter
- Fazit in Bezug auf eine Bilddidaktik
- Das Bild gefällt mir
- Bilder prägen unsere Psyche
- Welche Bilder eignen sich am besten für den Bildungsprozess?
- These von Hubertus Halbfass
- These von Christian Kalloch
- Schlussfolgerungen
- Persönliche Bildgeschichte
- Faszinierende Bilder – vielfältiges Sehen
- Verschiedene Bilder mit unterschiedlichen didaktischen Möglichkeiten
- Bilder sind mehrdeutig!
- Bilder vermitteln emotionale Bewegung!
- Bilder der Kunst haben ihre eigenen Aussagen!
- Schlüsse für den Religionsunterricht
- Kunst – Unterricht – SchülerInnen
- Projekt: Begegnung mit einem Künstler
- Beweggründe, Bildende Kunst im Religionsunterricht einzusetzen
- Kulturauftrag
- Spiegel unserer Gesellschaft
- Begegnung mit konträren Aussagen und Gefühlen
- Erfahrungen sammeln um kritisch und selbständig Denken und Fühlen zu lernen
- Anregung für die eigenen Kreativität
- Lernen, wie Gefühle und Emotionen ausgedrückt werden können
- Salvador Dalí
- Warum habe ich Dalí zur Konkretisierung gewählt?
- Salvador Dalí, ein vielschichtiger Künstler
- Der Surrealismus
- Dalís Werke
- Dalís Hinwendung zum Katholizismus
- Umgang mit surrealistischen Bildern
- Begegnung und Ganzheitliches Sehen
- Dokumentation mehrer Projekte
- A Surrealistische Bilder als Einstieg und Impuls
- B Begegnung mit Dalís Bild: „Geopolitisches Kind beobachtet die Geburt des neuen Menschen“
- C Erleben und Erschließen eines abstrakten Bildes
- D Begegnung und Wege mit und zu Dalís Bild, „Geburt von einer neuen Welt“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht den Einsatz bildender Kunst, insbesondere der Werke Salvador Dalís, im Religionsunterricht. Ziel ist es, theoretische und empirische Grundlagen für eine sinnvolle und effektive Bilddidaktik zu entwickeln, die die verschiedenen Entwicklungsstufen der SchülerInnen berücksichtigt und ihre Kreativität fördert.
- Wahrnehmung und Interpretation von Bildern
- Entwicklungspsychologische Aspekte der Bildwahrnehmung
- Bilddidaktische Ansätze im Religionsunterricht
- Der Surrealismus und die Werke Salvador Dalís
- Ganzheitliches Sehen und Erleben im Umgang mit Kunst
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Die Arbeit entstand aus einem Bildimpuls während einer Klausur und der darauffolgenden Beschäftigung mit Dalís Werk. Der Autor beschreibt seine Motivation, sowohl theoretische als auch empirische Methoden zu verwenden, um den Umgang mit Dalís Bildern im Religionsunterricht zu untersuchen und didaktische Konsequenzen daraus abzuleiten. Der Vorwort betont die Bedeutung von Kunst als Impulsgeber für Reflexion und neue Einsichten.
Sehen – Wahrnehmen – Erkennen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der visuellen Wahrnehmung und deren Einfluss auf die Interpretation von Bildern dar. Es beleuchtet die Rolle der Sinnesorgane, die Selektivität und Konstruktivität von Wahrnehmungsprozessen, sowie die Bedeutung des Kontextes und individueller Faktoren. Die Kapitel analysiert die Mustererkennung und deren Relevanz für den Umgang mit Kunst, insbesondere die subjektiven und objektiven Aspekte von Bildbetrachtungen.
Bilder bilden: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Bedeutung von Bildern, von den frühmenschlichen Darstellungen bis zur Entwicklung der Schrift. Es unterstreicht die prägende Kraft von Bildern auf unsere Wahrnehmung und unser Bewusstsein und kritisiert den heutigen Bilderkonsum als hinderlich für das wirkliche Sehen. Der Kapitel beleuchtet Kinderzeichnungen als natürlichen Zugang zum Sehenlernen und deren Entwicklungsphasen, mit Betonung auf dem Übergang vom naiven zum kritischen Realismus.
Entwicklungsschritte: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklungsstufen der Bildwahrnehmung von Kindern und Jugendlichen, beginnend mit dem naiven Realismus im frühen Kindesalter über den kritischen Realismus bis zum formal-operatorischen Denken im Jugendalter. Die unterschiedlichen Zugänge zu Bildern in den verschiedenen Phasen werden diskutiert und für die Bilddidaktik relevant gesetzt.
Das Bild gefällt mir: Dieses Kapitel diskutiert kontroverse Positionen zur Auswahl geeigneter Bilder für den Bildungsprozess. Es vergleicht die These von Hubertus Halbfass, der für die Verwendung anspruchsvoller Kunstwerke plädiert, mit der These von Christian Kalloch, der das ästhetische Urteil der Kinder betont. Der Kapitel kommt zu dem Schluss, dass eine Kombination beider Ansätze sinnvoll ist.
Persönliche Bildgeschichte: Der Autor schildert seine persönliche Beziehung zu einem Bild von Rembrandt, das ihn schon in seiner Kindheit nachhaltig beeindruckte, und seine persönlichen Erfahrungen mit Bildern. Es wird deutlich, wie eigene emotionale Erfahrungen die Wahrnehmung und Interpretation von Bildern prägen können.
Faszinierende Bilder – vielfältiges Sehen: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene didaktische Möglichkeiten des Einsatzes von Bildern im Religionsunterricht und klassifiziert Bilder nach unterschiedlichen Funktionen (Informationsbilder, Impulsbilder, Erzählbilder, Deutebilder, Karikaturen). Es unterstreicht die Mehrdeutigkeit von Bildern und ihre Fähigkeit, emotionale Bewegung zu vermitteln.
Kunst – Unterricht – SchülerInnen: Dieses Kapitel beschreibt ein Projekt, in dem SchülerInnen mit Werken Salvador Dalís konfrontiert wurden. Es diskutiert die Beweggründe für den Einsatz bildender Kunst im Religionsunterricht (Kulturauftrag, Spiegel der Gesellschaft, Begegnung mit konträren Aussagen und Gefühlen) und die damit verbundenen Lernziele (Förderung von kritischem Denken, Kreativität und emotionaler Bildung).
Salvador Dalí: Dieses Kapitel konzentriert sich auf den Künstler Salvador Dalí, seine vielschichtige Persönlichkeit, seine Verbindung zum Surrealismus, seine Hinwendung zum Katholizismus, sowie seinen Umgang mit Symbolen und seine künstlerischen Techniken. Es wird die Wahl Dalís als Künstler für diese Arbeit begründet.
Schlüsselwörter
Bildende Kunst, Religionsunterricht, Bilddidaktik, Wahrnehmung, Interpretation, Entwicklungspsychologie, Salvador Dalí, Surrealismus, Kreativität, Emotion, Ganzheitliches Sehen, Symbol, Didaktik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: "Bildende Kunst im Religionsunterricht - Am Beispiel Salvador Dalís"
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Arbeit untersucht den Einsatz bildender Kunst, insbesondere der Werke Salvador Dalís, im Religionsunterricht. Ziel ist die Entwicklung theoretischer und empirischer Grundlagen für eine sinnvolle und effektive Bilddidaktik, die die verschiedenen Entwicklungsstufen der Schüler*innen berücksichtigt und ihre Kreativität fördert.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Themen wie visuelle Wahrnehmung und Interpretation von Bildern, entwicklungspsychologische Aspekte der Bildwahrnehmung, bilddidaktische Ansätze im Religionsunterricht, den Surrealismus und die Werke Salvador Dalís sowie ganzheitliches Sehen und Erleben im Umgang mit Kunst.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu folgenden Themen: Vorwort, Sehen – Wahrnehmen – Erkennen, Bilder bilden, Entwicklungsschritte, Das Bild gefällt mir, Persönliche Bildgeschichte, Faszinierende Bilder – vielfältiges Sehen, Kunst – Unterricht – Schüler*innen, Salvador Dalí, Begegnung und Ganzheitliches Sehen und Dokumentation mehrerer Projekte. Jedes Kapitel wird im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgeschlüsselt.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit verwendet sowohl theoretische als auch empirische Methoden. Der Autor kombiniert theoretische Analysen der visuellen Wahrnehmung und der Bilddidaktik mit der Beschreibung und Auswertung von praktischen Projekten im Religionsunterricht, die den Umgang mit Dalís Bildern untersuchen.
Warum wurde Salvador Dalí als Künstler ausgewählt?
Die Wahl Dalís begründet sich in der vielschichtigen Persönlichkeit des Künstlers, seiner Verbindung zum Surrealismus, seiner Hinwendung zum Katholizismus und seinem Umgang mit Symbolen und künstlerischen Techniken. Seine Werke bieten vielseitige Anknüpfungspunkte für die Auseinandersetzung mit Fragen der Wahrnehmung, Interpretation und des ganzheitlichen Erlebens im Religionsunterricht.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, eine fundierte Grundlage für den Einsatz bildender Kunst im Religionsunterricht zu schaffen. Sie soll Lehrer*innen dabei unterstützen, Bilder sinnvoll und effektiv im Unterricht einzusetzen und die Kreativität und das kritische Denken der Schüler*innen zu fördern.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bildende Kunst, Religionsunterricht, Bilddidaktik, Wahrnehmung, Interpretation, Entwicklungspsychologie, Salvador Dalí, Surrealismus, Kreativität, Emotion, Ganzheitliches Sehen, Symbol, Didaktik.
Wie werden die Entwicklungsstufen der Schüler*innen berücksichtigt?
Die Arbeit beschreibt die Entwicklungsstufen der Bildwahrnehmung von Kindern und Jugendlichen (naiver Realismus, kritischer Realismus etc.) und diskutiert die unterschiedlichen Zugänge zu Bildern in den verschiedenen Phasen. Diese Erkenntnisse werden für die Bilddidaktik relevant gesetzt.
Welche kontroversen Positionen zur Auswahl von Bildern werden diskutiert?
Die Arbeit vergleicht die Thesen von Hubertus Halbfass (Verwendung anspruchsvoller Kunstwerke) und Christian Kalloch (Betonung des ästhetischen Urteils der Kinder) und kommt zu dem Schluss, dass eine Kombination beider Ansätze sinnvoll ist.
Wie wird der persönliche Bezug des Autors zur Thematik dargestellt?
Der Autor schildert seine persönliche Beziehung zu einem Bild von Rembrandt und seine persönlichen Erfahrungen mit Bildern, um zu zeigen, wie eigene emotionale Erfahrungen die Wahrnehmung und Interpretation von Bildern prägen können.
- Citar trabajo
- Dipl. Päd. Bernd Schirner (Autor), 2004, Bilder bilden - Bildende Kunst im Religionsunterricht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125172