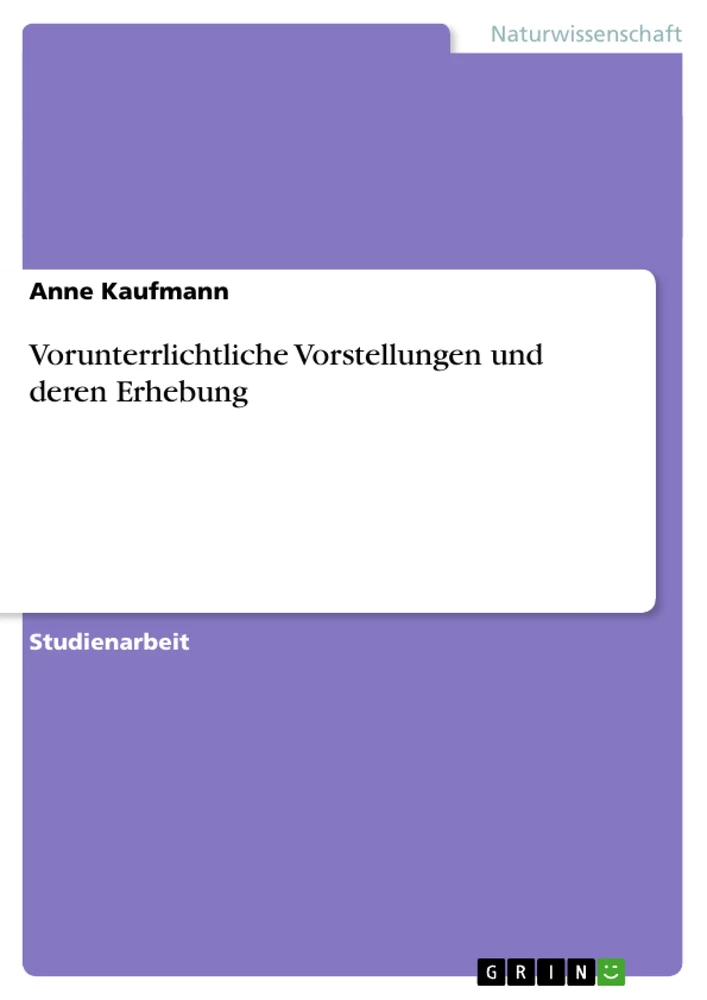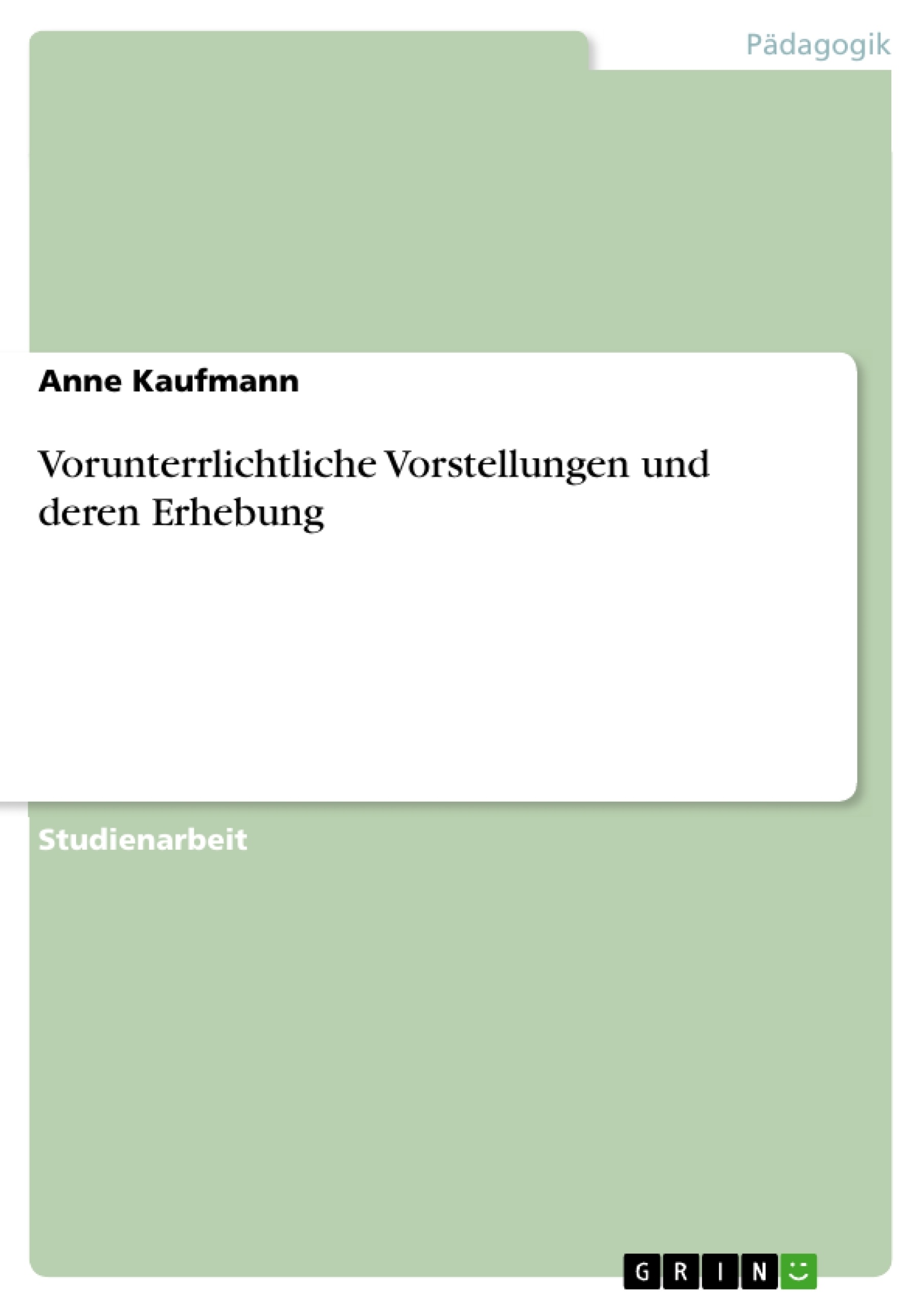Unter vorunterrichtlichen Vorstellungen versteht man das Wissen der Kinder, das bereits vor dem ersten Kontakt mit Schule und Lernen besteht. Diese Vorstellungen sind durch Alltagserfahrungen gefestigt und stimmen meist nicht mit den naturwissenschaftlichen Erklärungen überein. Das bedeutet, dass sich bei den Schülern bereits festgefahrene Denkstrukturen gebildet haben, welchen hartnäckig vertreten werden.
Die Sichtweisen, die sich in einem Langwierigen Anpassungsprozess an Lebenssituationen stabilisiert haben und bei der Anwendung auf den Alltag meistens als richtig erwiesen haben . Diese Vorstellungen entstehen durch ein zufällig aufsteigendes Interesse des Kindes an einem gewissen, meist neuen Zusammenhang.
Die Vorstellungen der Kinder meist lokal begrenzt und beruhen auf simplen Schlussfolgerungen aus bereits bekanntem Wissen, z.B. dass ein Stein herunter fällt, weil er schwer ist. Die Erdanziehungskraft wird dabei, wie auch andere Faktoren, nicht berücksichtigt .
Allerdings sind nicht alle Vorstellungen gleich. Verankerte und sogenannte Ad- hoc- Vorstellungen gilt es hierbei zu unterscheiden. Ad- hoc- Vorstellungen entstehen, wenn Schüler mit etwas konfrontiert werden, zu dem sie sich noch keinerlei Wissen angeeignet haben. Die allgemeinen Vorstellungen hingegen haben sich tief verankert und einen Verbrauchscharakter angenommen. Dies bedeutet, dass sie sich in Alltagssituationen bereits bewiesen haben und somit schwieriger zu ändern sind.
Da die vorunterrichtlichen Vorstellungen eine Auslegung von neuen Aspekten überhaupt erst ermöglichen, geschieht es häufig dass Schüler das zu Lernende falsch verstehen und so Lernschwierigkeiten entstehen können. Daher ist es wichtig zu wissen, woher die Vorstellungen stammen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Sachanalyse
- 1.1 Was sind vorunterrichtliche Vorstellungen?
- 1.2 Woher stammen die vorunterrichtlichen Vorstellungen?
- 1.3 Was versteht man unter Lernen?
- 1.4 Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Vorstellungen und dem Lernen?
- 1.5 Wie kann man vorunterrichtliche Vorstellungen erheben?
- II. Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht vorunterrichtliche Vorstellungen von Kindern im Bereich der Naturwissenschaften. Ziel ist es, die Herkunft, den Einfluss auf den Lernprozess und Methoden zu ihrer Erhebung zu analysieren. Der Fokus liegt auf dem Verständnis, wie diese Vorstellungen mit dem formalen Lernen interagieren und wie ein effektiver Unterricht gestaltet werden kann, der diese berücksichtigt.
- Vorunterrichtliche Vorstellungen und ihre Entstehung
- Der Lernprozess und die Rolle des Gedächtnisses
- Zusammenhang zwischen Vorstellungen und Lernerfolg
- Methoden zur Erhebung vorunterrichtlicher Vorstellungen
- Konzeptwechsel im Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
I. Sachanalyse 1.1: Dieser Abschnitt definiert vorunterrichtliche Vorstellungen als das Wissen, das Kinder vor dem schulischen Unterricht besitzen. Diese Vorstellungen, geformt durch Alltagserfahrungen, weichen oft von naturwissenschaftlichen Erklärungen ab und können zu Lernschwierigkeiten führen. Es wird zwischen verankerten und Ad-hoc-Vorstellungen unterschieden.
I. Sachanalyse 1.2: Hier werden die Quellen vorunterrichtlicher Vorstellungen untersucht, darunter Alltagserfahrungen, Medienkonsum und frühere Lernerfahrungen. Der Prozess der Wissensbildung durch Beobachtung und Vergleich wird beschrieben, wobei der Einfluss von Emotionen und dem sozialen Umfeld hervorgehoben wird.
I. Sachanalyse 1.3: Dieser Abschnitt erläutert verschiedene Aspekte des Lernens, insbesondere die Rolle des Kurzzeit- und Langzeitgedächtnisses. Prozedurales und deklaratives Wissen werden unterschieden, sowie der Aufbau von Wissensnetzen und die Bedeutung von Lernstrategien.
I. Sachanalyse 1.4: Der Abschnitt beleuchtet den Zusammenhang zwischen vorunterrichtlichen Vorstellungen und dem Lernprozess. Es wird betont, dass diese Vorstellungen nicht einfach ignoriert werden sollten, sondern als Ausgangspunkt für den Unterricht dienen. Ein vierstufiges Modell des Theoriewandels wird vorgestellt. Der Abschnitt diskutiert die Herausforderungen beim Wissenstransfer auf neue Bereiche.
I. Sachanalyse 1.5: Hier werden verschiedene Methoden zur Erhebung vorunterrichtlicher Vorstellungen diskutiert, einschließlich des Ausradierungsversuchs und der Konfrontation. Der Abschnitt betont, dass ein vollständiger Konzeptwechsel selten ist und dass Alltagswissen und wissenschaftliches Wissen oft parallel existieren. Der "learning-cycle" von Piaget und das fünf-Phasen-Modell von Stebler werden als Beispiele für Unterrichtsstrategien genannt.
Schlüsselwörter
Vorunterrichtliche Vorstellungen, Lernen, Gedächtnis, Wissensnetze, Konzeptwechsel, Alltagserfahrungen, naturwissenschaftliches Wissen, Unterrichtsmethoden, kognitive Entwicklung, Piaget, Akkomodation, Assimilation.
- Citation du texte
- Anne Kaufmann (Auteur), 2002, Vorunterrlichtliche Vorstellungen und deren Erhebung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125188