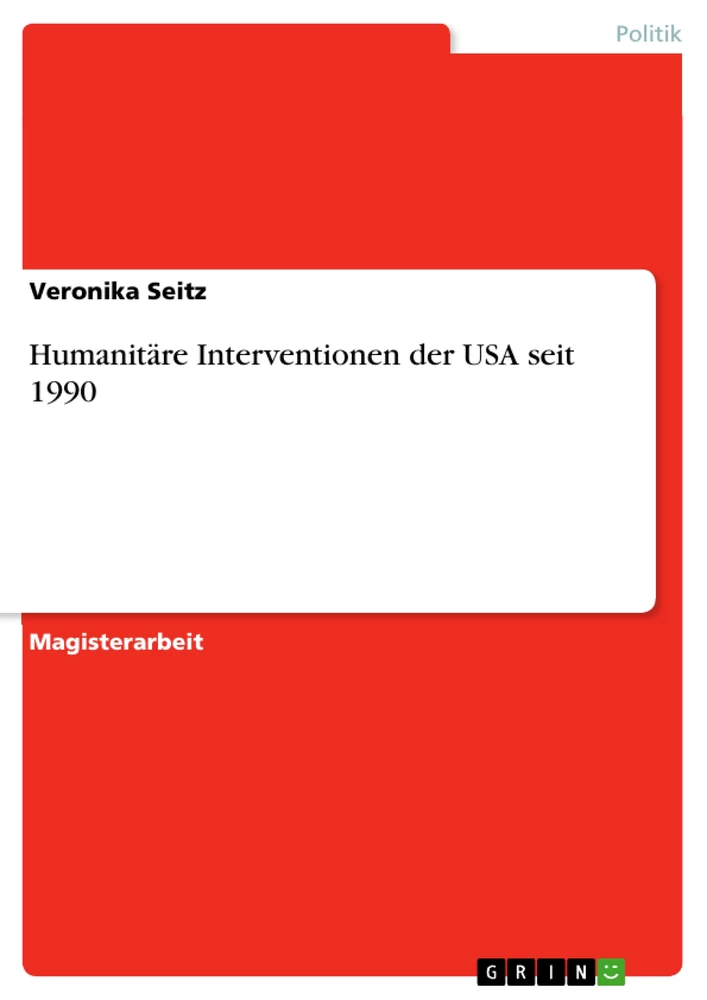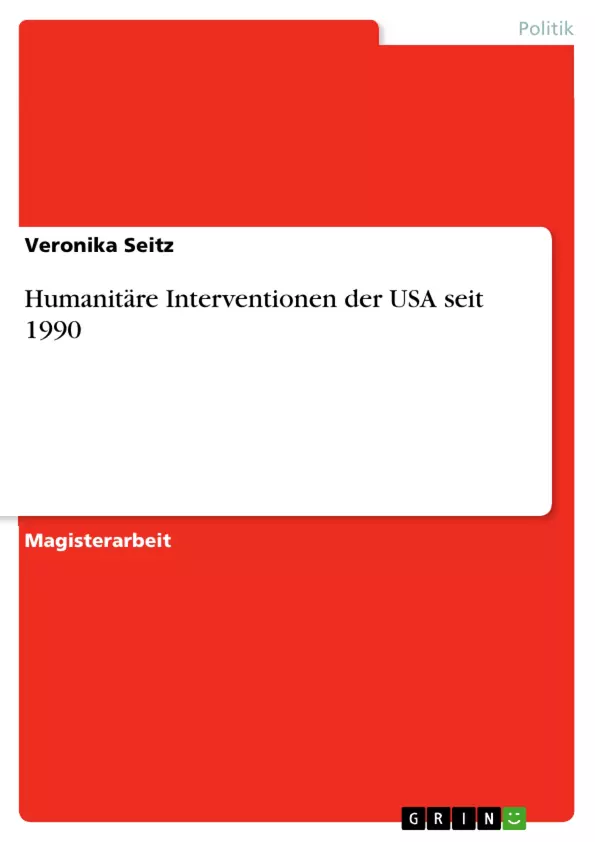Am Abend des 25. Dezember 1991 wehte die rote Hammer-und-Sichel-Flagge der Sowjetunion nach 69 Jahren zum letzten Mal über dem Kreml. Die Selbstauflösung der UdSSR markierte den Ausgangspunkt für einen weitreichenden Wandel in der Struktur des internationalen Systems. Die Bipolarität, welche seit Ende des Zweiten Weltkrieges die weltpolitische Bühne mit den beiden Großmächten – den Vereinigten Staaten von Amerika und der Sowjetunion – dominierte, wich der Unipolarität mit den USA als einzig verbleibende Hegemonialmacht.
Der Zusammenbruch der Sowjetunion bot somit die einmalige Gelegenheit, das internationale System neu zu strukturieren, um somit eine neue, friedliche Weltordnung zu schaffen. Die Umsetzung des Konzepts der „new world order“, so der damalige US-Präsident George Bush, sollte mittels Kooperation in Form von internationalen und regionalen Organisationen erreicht werden und auf den gemeinsamen Normen Demokratie, Marktwirtschaft, Menschenrechte sowie Freiheit basieren.
Die Hoffnung zahlreicher Experten und Politiker, dass kriegerische Auseinandersetzungen künftig nicht mehr stattfinden und sich die Erwartung auf dauerhaften Frieden erfüllen würden, hat sich jedoch nicht erfüllt. Zwar ging die Epoche der klassischen zwischenstaatlichen Kriege zu Ende, doch an deren Stelle traten nationale, inner¬staatliche Auseinandersetzungen. Auslöser dieser sogenannten „neuen Kriege“ war das Auf¬brechen von alten Konfliktpotenzialen, die während des Kalten Krieges von den beiden Supermächten unterdrückt wurden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1. Hinführung zum Thema
- 2. Problemstellung
- 3. Fragestellung und Untersuchungszeitraum
- 4. Forschungsstand und Quellenlage
- 5. Forschungsdesign und methodisches Vorgehen
- 6. Definitionen
- 6. 1 Der Begriff der humanitären Intervention
- 6. 2 Der Begriff der ‚nationalen Interessen’ der USA
- 6. 3 Der Policy Cycle
- 6. 4 Die Theorie des neoklassischen Realismus’
- 6. 4. 1 Der Waltz`sche Neorealismus als theoretische Grundlage zur Analyse von außenpolitischem Verhalten
- 6. 4. 2 Der Einfluss von innerstaatlichen Determinanten als „intervening variables“
- 6. 4. 3 Perzeption als intervenierende Variable
- II. Eine „neue Weltordnung“ – Die humanitäre Intervention als Instrument der US-Außen- und Sicherheitspolitik
- 1. Die humanitäre Intervention in Somalia 1993
- 1. 1 Hintergrund
- 1. 2 Die Hungersnot in Somalia auf der politischen Agenda der USA
- 1. 3 Der innenpolitische Entscheidungsprozess innerhalb der Bush-Regierung im November 1992
- 2. Die humanitäre Intervention in Haiti 1994
- 2. 1 Hintergrund
- 2. 2 Die innere Entwicklung Haitis auf der politischen Agenda der USA
- 2. 3 Der innenpolitische Prozess zur Interventionsentscheidung
- 3. Die humanitäre Intervention im Kosovo 1999
- 3. 1 Hintergrund
- 3. 2 Der Kosovo-Konflikt auf der politischen Agenda der USA
- 3. 3 Die innenpolitische Entscheidung zur humanitären Intervention im Kosovo
- 1. Die humanitäre Intervention in Somalia 1993
- III. Humanitäre Katastrophen jenseits der US-amerikanischen Interventionspolitik
- 1. Der Völkermord in Ruanda 1994
- 1. 1 Hintergrund
- 1. 2 Der Völkermord in Ruanda auf der politischen Agenda der USA
- 1. 3 Das Debakel in Somalia im Oktober 1993 und dessen Auswirkung auf den Entscheidungsprozess zur Nicht-Intervention in Ruanda im Jahre 1994
- 2. Die humanitäre Katastrophe in der Demokratischen Republik Kongo
- 2. 1 Hintergrund
- 2. 2 Die DR Kongo auf der politischen Agenda der USA
- 2. 3 Militärische Unterstützung für Uganda und Ruanda – Die neue Strategie der USA für den Schwarzen Kontinent
- 3. Die humanitäre Katastrophe in Burma
- 3. 1 Hintergrund
- 3. 2 Burma auf der politischen Tagesordnung der USA
- 3. 3 Der ‚große Bruder’ China
- 1. Der Völkermord in Ruanda 1994
- IV. Kriterien für US-amerikanische Interventionen in humanitäre Katastrophen
- 1. Innenpolitischer Druck ausgelöst durch die Präsenz der humanitären Katastrophe in der Öffentlichkeit
- 2. Bedrohung nationaler Interessen des intervenierenden Staates
- 3. Bewahrung der eigenen Glaubwürdigkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Interventionspolitik der USA in humanitären Krisen seit 1990. Das zentrale Ziel ist die Analyse der Faktoren, die die Entscheidung der USA für oder gegen ein militärisches Eingreifen beeinflussen.
- Analyse der humanitären Interventionen der USA in Somalia, Haiti und Kosovo.
- Untersuchung der Nicht-Interventionen in Ruanda, der Demokratischen Republik Kongo und Burma.
- Identifizierung von Kriterien für US-amerikanische Interventionen, basierend auf innenpolitischem Druck, Bedrohung nationaler Interessen und Glaubwürdigkeitsaspekten.
- Anwendung des neoklassischen Realismus als theoretischer Rahmen.
- Prognose einer möglichen Intervention im Sudan.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein, beschreibt die Problemstellung, formuliert Forschungsfragen und erläutert das methodische Vorgehen. Kapitel II analysiert die Interventionen in Somalia, Haiti und Kosovo, wobei jeweils der Hintergrund, die politische Agenda der USA und der innenpolitische Entscheidungsprozess untersucht werden. Kapitel III befasst sich mit den Nicht-Interventionen in Ruanda, der Demokratischen Republik Kongo und Burma, wiederum unter Berücksichtigung der genannten Aspekte. Kapitel IV entwickelt einen Kriterienkatalog basierend auf den analysierten Fällen.
Schlüsselwörter
Humanitäre Intervention, US-Außenpolitik, nationale Interessen, neoklassischer Realismus, Somalia, Haiti, Kosovo, Ruanda, Demokratische Republik Kongo, Burma, Policy Cycle, innenpolitischer Druck, Agenda-Setting, Glaubwürdigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Welche humanitären Interventionen der USA werden analysiert?
Die Arbeit untersucht detailliert die US-Interventionen in Somalia (1993), Haiti (1994) und im Kosovo (1999).
Welche Fälle von Nicht-Intervention werden betrachtet?
Es werden die Krisen in Ruanda (1994), der Demokratischen Republik Kongo und Burma analysiert, in denen die USA trotz humanitärer Katastrophen nicht militärisch eingriffen.
Welcher theoretische Rahmen wird für die Analyse genutzt?
Die Arbeit verwendet die Theorie des neoklassischen Realismus, um das außenpolitische Verhalten der USA zu erklären.
Welche Faktoren beeinflussen die Entscheidung für eine Intervention?
Zentrale Kriterien sind der innenpolitische Druck (Agenda-Setting), die Bedrohung nationaler Interessen und die Wahrung der eigenen Glaubwürdigkeit.
Was verstand George Bush unter der „New World Order“?
Nach dem Zusammenbruch der UdSSR sollte eine friedliche Weltordnung auf Basis von Demokratie, Marktwirtschaft und Menschenrechten durch internationale Kooperation geschaffen werden.
Welche Rolle spielt der „Policy Cycle“ in der Arbeit?
Der Begriff dient als methodisches Werkzeug, um den politischen Entscheidungsprozess innerhalb der US-Regierung nachzuvollziehen.
- Quote paper
- Veronika Seitz (Author), 2008, Humanitäre Interventionen der USA seit 1990, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125291