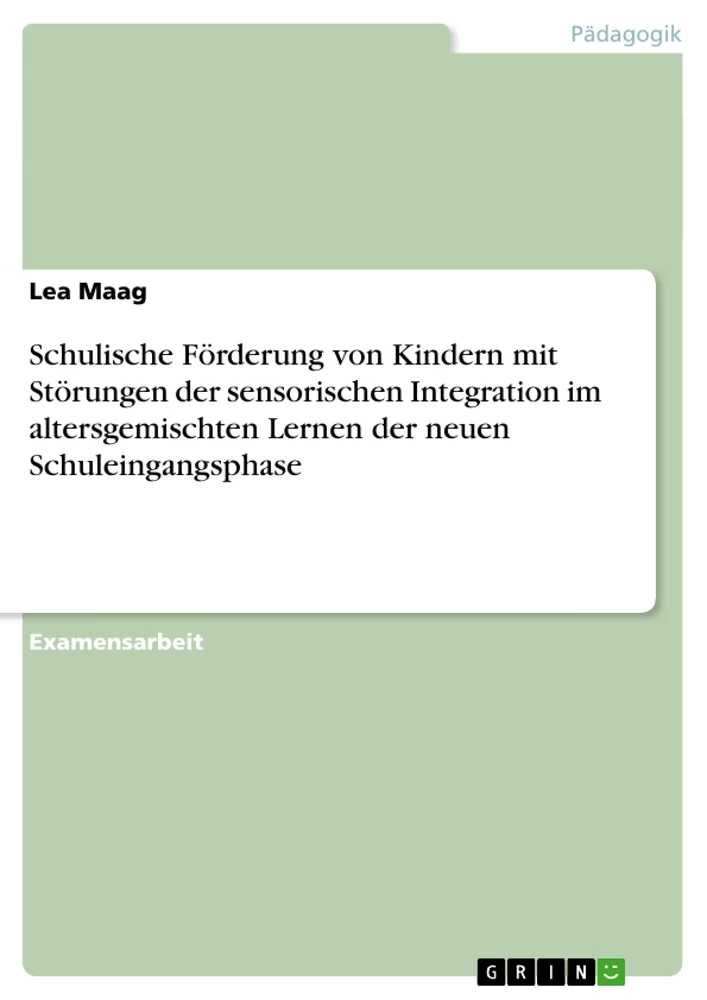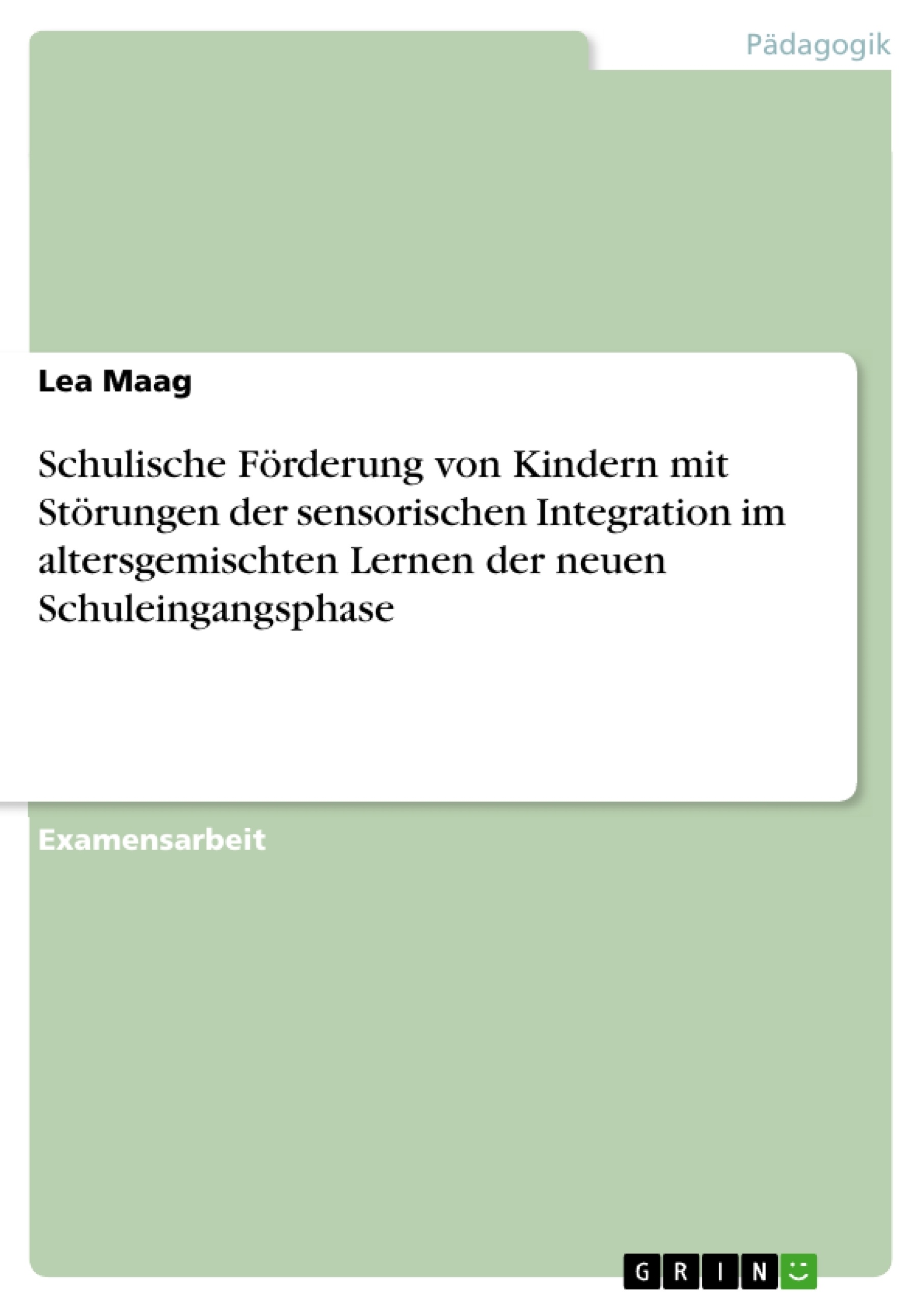Jedes Kind ist anders. Jedes hat seine Stärken und individuellen Schwächen. In den ersten Lebensjahren bis zum Schuleintritt lernen aufmerksame Eltern und Erzieherinnen die Eigenheiten und eben auch die starken und die schwachen Seiten der ihnen anvertrauten Kinder im alltäglichen Geschehen kennen. Spricht ein Kind auffallend schlecht oder steht es in seiner motorischen Entwicklung hinter seinen gleichaltrigen Spielkameraden im Kindergarten augenscheinlich zurück, so werden im Idealfall therapeutische Maßnahmen eingeleitet, die diese Defizite bis zur Einschulung aufarbeiten und manchmal sogar beheben.
Oft treten aber erst mit Schulbeginn oder in höheren Schuljahren bei zuvor scheinbar unauffälligen Kindern Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens, Schreibens und Rechnens auf, die dem betroffenen Mädchen oder Jungen ein Mithalten im Gleichschritt der jahrgangshomogenen Lerngruppe schier unmöglich machen. Trotz verstärkter Mühen und Anstrengungen des Kindes bleiben die Leistungen im betroffenen Fach schlecht und verstärken sich oft sogar noch. Nicht nur das Kind leidet, oft fühlen sich die Eltern mitschuldig, suchen die Ursachen in ihrer Erziehung und
nehmen viele Kosten und Mühen auf sich, um ihrem Kind eine möglichst wirksame Therapie zukommen zu lassen. Die PISA- und IGLU-Studien zeigen, dass Probleme im Bereich des Lernens keine Seltenheit sind. Bei diesen internationalen Vergleichsstudien erreichten 10% der bundesdeutschen 15-jährigen Schüler nicht einmal die niedrigste Kompetenzstufe im Lesen. Besonders Kinder mit Migrationshintergrund fallen durch unterdurchschnittliche Schulleistungen negativ auf.
Diese Hausarbeit verfolgt die Fragestellung, wie eine Förderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf in den Kernfächern Deutsch und Mathematik in den Eingangsklassen der neuen Schuleingangsphase mit jahrgangsgemischten Lerngruppen aussehen kann.
Bei der Erarbeitung eines möglichen Themas für die schriftliche Hausarbeit war mir ein direkter Vergleich zwischen Erkenntnissen und Forderungen der Wissenschaftler und den Umsetzungsmöglichkeiten in der Schule besonders wichtig.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Zur persönlichen Themenfindung
- 1.2 Zum Aufbau der Arbeit
- 1.3 Anmerkung zur Vertiefung der Themen
- 2 Literaturlage
- 2.1 Lernschwierigkeiten
- 2.2 Die neue Schuleingangsphase
- 2.3 Förderung im Schulalltag – Anleitungen für die Praxis
- 3 Lernschwierigkeiten
- 3.1 Hinführung zur Problematik: Lernschwierigkeiten allgemein
- 3.2 Unterteilung von Lernschwierigkeiten
- 3.3 Die Frage nach der „Schuld“ – Ursachenforschung bei Lernschwierigkeiten
- 4 Betrachtung von Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten und Rechenproblemen als Störungen der sensorischen Integration
- 4.1 Sensorische Integrationsstörung: Lese-Rechtschreibschwierigkeiten
- 4.1.1 Zum Erscheinungsbild von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten
- 4.1.2 Kennzeichen von Lesestörungen
- 4.1.3 Kennzeichen von Rechtschreibschwierigkeiten
- 4.2 Sensorische Integrationsstörung: Rechenschwierigkeiten
- 4.2.1 Zum Erscheinungsbild von Rechenschwierigkeiten
- 4.2.2 Wann liegt eine Rechenstörung vor?
- 4.3 Auswirkungen und mögliche Folgen von Lernschwierigkeiten (LRS & Rechenprobleme)
- 4.4 Die langfristigen Entwicklung von Kindern mit Lernschwierigkeiten
- 4.5 Wissenschaftliche Anforderungen an Förderkonzepte
- 4.5.1 Diagnostische Erhebungsverfahren
- 4.5.2 Wissenschaftliche Erkenntnisse der LRS-Förderung
- 4.5.3 Wissenschaftliche Erkenntnisse der Rechenförderung
- 5 Die neuen Schuleingangsphase mit jahrgangsübergreifenden Lerngruppen
- 5.1 Einführung in die Thematik der neuen Schuleingangsphase mit jahrgangsübergreifenden Lerngruppen
- 5.2 Zur Entwicklung der Altershomogenität in deutschen Schulklassen
- 5.3 Feststellung der Schulfähigkeit
- 5.4 Empfehlungen zum Schulanfang durch die Kultusministerkonferenz
- 5.5 Was ist die neue Schuleingangsphase?
- 5.6 Ziele und Begründung zur neuen Schuleingangsphase
- 5.7 Rhythmisierung des Schultages
- 5.8 Gegenargumente zur neuen Schuleingangsphase
- 5.9 Empirische Vergleichsuntersuchungen zu altersgemischten Schulklassen
- 5.10 Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten in der neuen Schuleingangsphase
- 6 Schulische Förderung von Kindern mit Störungen der sensorischen Integration im jahrgangsgemischten Lernen der neuen Schuleingangsstufe – Erfahrungen aus der Praxis
- 6.1 Zu den Rahmenbedingungen
- 6.1.1 Motivation für das Praktikum
- 6.1.2 Auswahl der Schule
- 6.1.3 Organisation und Kontaktaufnahme mit der Hospitationsschule
- 6.2 Auswahl und Vorstellung der methodischen Instrumente
- 6.3 Durchführung von Datenerhebungen
- 6.3.1 Unterrichtsbeobachtungen
- 6.3.2 Ergebnisse der Unterrichtsbeobachtungen
- 6.3.3 Zusammenfassung des Leitfadeninterviews mit der Klassenlehrerin Frau XXXXXX
- 6.4 Schulische Förderstrategien – Einsatz, Möglichkeiten, Grenzen
- 6.4.1 Förderung in der Hospitationsklasse
- 6.4.1.1 Fördermöglichkeiten für den Schreibanfang
- 6.4.1.2 Silbensegmentierung am Beispiel der Bananendampfer und der Parkplatzwörter
- 6.4.1.3 „Vier Mal rot und zwei Mal blau heisst schlau!“ – Das Lernen in Bewegung bringen – Ein Trainingskonzept von Maike Hülsmann
- 6.4.1.4 Förderungen von Kindern mit Rechenschwierigkeiten
- 6.4.2 Auswertung der vorgestellten Förderansätze
- 7 Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Förderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf in Deutsch und Mathematik in Eingangsklassen der neuen Schuleingangsphase mit jahrgangsgemischten Lerngruppen. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse.
- Lernschwierigkeiten (LRS und Rechenstörungen) als Störungen der sensorischen Integration
- Diagnostik und Förderansätze für Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten und Rechenstörungen
- Die neue Schuleingangsphase und jahrgangsübergreifendes Lernen
- Empirische Befunde zum jahrgangsübergreifenden Unterricht
- Praktische Erfahrungen aus einem Hospitationspraktikum in einer Berliner Grundschule
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beschreibt die persönliche Motivation und den Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 behandelt die relevanten Literaturquellen. Kapitel 3 definiert Lernschwierigkeiten und diskutiert deren Ursachen. Kapitel 4 betrachtet Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten und Rechenstörungen als sensorische Integrationsstörungen. Kapitel 5 beschreibt die neue Schuleingangsphase und den jahrgangsübergreifenden Unterricht, einschließlich empirischer Untersuchungen. Kapitel 6 präsentiert die Ergebnisse eines Hospitationspraktikums, inklusive der verwendeten Fördermethoden.
Schlüsselwörter
Lernschwierigkeiten, Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (LRS), Rechenstörungen, sensorische Integrationsstörung, Förderdiagnostik, Schuleingangsphase, jahrgangsübergreifender Unterricht, Binnendifferenzierung, empirische Forschung.
- Quote paper
- Lea Maag (Author), 2008, Schulische Förderung von Kindern mit Störungen der sensorischen Integration im altersgemischten Lernen der neuen Schuleingangsphase, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125308