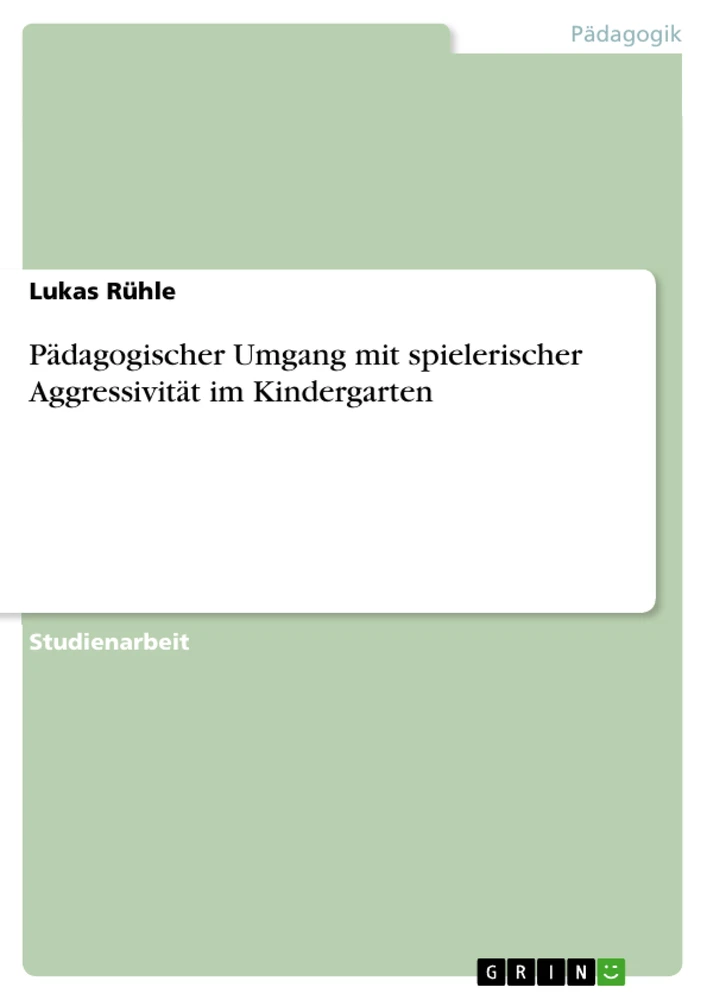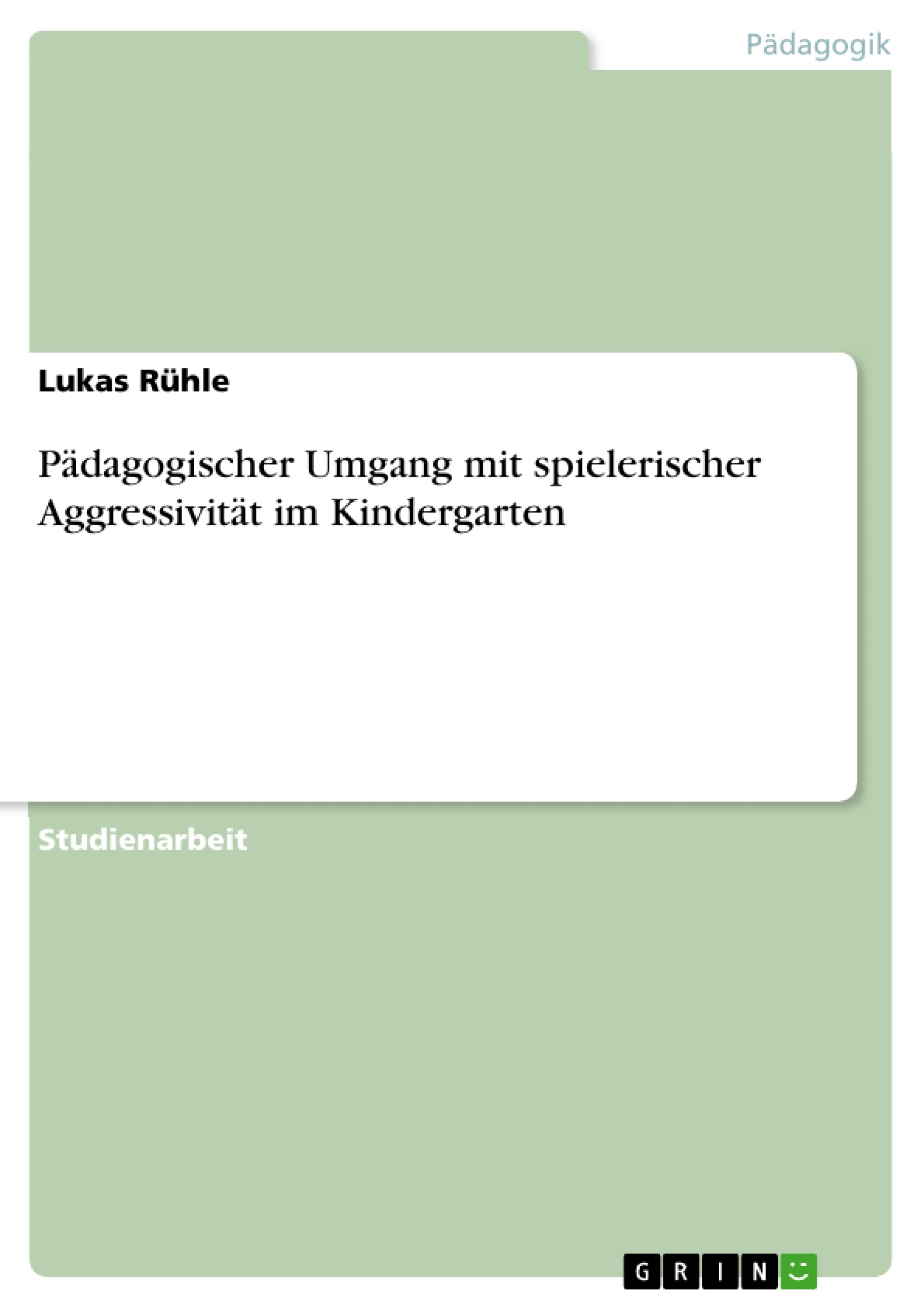Diese Arbeit beschäftigt sich mit spielimmanenter Aggressivität im Freispiel und mit dem angemessenen pädagogischen Umgang dieser im Kindergarten.
Bereits im letzten Jahrhundert wurden von Kindern Spiele mit aggressiven und gewalttätigen Inhalten gespielt. Schon damals wurde ein gespielter Kampf als vollwertiges Spiel angesehen. In der heutigen Zeit ist es allerdings immer öfter der Fall, dass kindliche Spiele, die einen gespielten Kampf beinhalten, von vorneherein verurteilt und verboten werden.
Häufig schauen pädagogische Fachkräfte bei Spielen, die aggressive Inhalte aufweisen, entweder einfach weg oder sie intervenieren sofort. Dass das nicht die Lösung des Problems sein kann, scheint klar. Aber handelt es sich hierbei überhaupt um ein Problem? Und wenn ja – was genau ist das Problem?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aggressivität und Gewalt
- Aggressivität und Gewalt im Allgemeinen
- Aggressivität und Gewalt im Kindergarten
- Spielimmanente Aggressivität
- Spielimmanente und spielexterne Aggressivität
- Kinder spielen gerne Gewalt
- Auswirkungen von spielimmanenter Aggressivität
- Das Freispiel
- Die Freispielzeit
- Die pädagogische Bedeutung des Freispiels
- Die Rolle der pädagogischen Fachkraft im Freispiel
- Umsetzung im Kindergarten
- Die professionelle pädagogische Haltung zu spielimmanenter Aggressivität
- Beobachtung von spielimmanenter Aggressivität
- Direkter Umgang mit spielimmanenter Aggressivität am Kind
- Reflexion mit den Kindern
- Resümee und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Umgang mit spielimmanenter Aggressivität im Kindergarten-Freispiel. Ziel ist es, ein besseres Verständnis für dieses Phänomen zu entwickeln und pädagogische Fachkräfte mit angemessenen Handlungsansätzen auszustatten.
- Abgrenzung von Aggressivität und Gewalt
- Analyse spielimmanenter Aggressivität im Kontext des Kinderspiels
- Pädagogische Bedeutung des Freispiels und die Rolle der Erzieherin/des Erziehers
- Entwicklung eines professionellen Umgangs mit spielimmanenter Aggressivität
- Reflexion des eigenen Umgangs mit solchen Situationen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der spielimmanenten Aggressivität im Kinderspiel ein und beschreibt die persönliche Motivation des Autors, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Sie beleuchtet den Widerspruch zwischen der häufigen Verurteilung und dem Verbot von kindlichen Spielen mit aggressiven Inhalten und der Notwendigkeit eines differenzierten Blicks auf dieses Phänomen. Die Arbeit skizziert den weiteren Aufbau und die Zielsetzung der Untersuchung, welche darin besteht, einen angemessenen Umgang mit spielimmanenter Aggressivität im Freispiel zu finden.
Aggressivität und Gewalt: Dieses Kapitel beginnt mit einer Abgrenzung der Begriffe Aggressivität und Gewalt. Es werden klassische Entstehungstheorien zur Aggressivität vorgestellt, insbesondere die Frustrations-Aggressions-Theorie und die Triebtheorie von Lorenz. Die Theorie von Dollard und Miller wird kritisch beleuchtet und ihre Grenzen aufgezeigt. Der Fokus liegt auf der Unterscheidung zwischen Aggression als bewusstem Schadenszufügung und Selbstbehauptung. Das Kapitel bildet die theoretische Grundlage für die spätere Auseinandersetzung mit spielimmanenter Aggressivität im Spiel.
Das Freispiel: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Freispiel als methodischem Ansatz im Kindergarten. Es beschreibt die Bedeutung des Freispiels für die kindliche Entwicklung und die Rolle der pädagogischen Fachkraft bei der Gestaltung und Begleitung des Freispiels. Es wird herausgestellt, dass das Freispiel ein wichtiger Kontext für die Beobachtung und den Umgang mit spielimmanenter Aggressivität ist, da gerade hier solche Verhaltensweisen am häufigsten auftreten.
Umsetzung im Kindergarten: Dieses Kapitel präsentiert einen konkreten Ansatz für den Umgang mit spielimmanenter Aggressivität im Kindergarten. Es beschreibt verschiedene pädagogische Haltungen zu diesem Thema und vergleicht diese miteinander. Im Mittelpunkt steht ein dreistufiger Prozess: Beobachtung, Handlung und Reflexion. Es wird detailliert erklärt, wie pädagogische Fachkräfte spielimmanente Aggressionen beobachten, wie sie angemessen eingreifen können und wie sie anschließend mit den Kindern die Situation reflektieren und verarbeiten können. Dieses Kapitel bietet konkrete Handlungsanweisungen für die Praxis.
Schlüsselwörter
Spielimmanente Aggressivität, Gewalt, Aggression, Freispiel, Kindergarten, Pädagogik, Beobachtung, Intervention, Reflexion, kindliche Entwicklung, Frustrations-Aggressions-Theorie, Triebtheorie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Spielimmanente Aggressivität im Kindergarten-Freispiel"
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit dem Umgang mit spielimmanenter Aggressivität im Kindergarten-Freispiel. Sie untersucht dieses Phänomen, um ein besseres Verständnis zu entwickeln und pädagogische Fachkräfte mit angemessenen Handlungsansätzen auszustatten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Aggressivität und Gewalt, Das Freispiel, Umsetzung im Kindergarten und Resümee und Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas, beginnend mit einer Abgrenzung der Begriffe Aggressivität und Gewalt und endend mit konkreten Handlungsempfehlungen für den Kindergartenalltag.
Wie wird Aggressivität von Gewalt abgegrenzt?
Die Arbeit unterscheidet klar zwischen Aggression und Gewalt. Aggression wird als bewusstes Schadenszufügung definiert, während Gewalt eher mit dem Missbrauch von Macht und dem bewussten Schädigen verbunden ist. Es wird betont, dass die Abgrenzung nicht immer einfach ist und im Kontext des Kinderspiels besonders differenziert betrachtet werden muss.
Welche Rolle spielt das Freispiel?
Das Freispiel wird als wichtiger Kontext für die Beobachtung und den Umgang mit spielimmanenter Aggressivität dargestellt. Es wird die pädagogische Bedeutung des Freispiels für die kindliche Entwicklung betont und die Rolle der Erzieherin/des Erziehers bei der Gestaltung und Begleitung des Freispiels hervorgehoben. Gerade im Freispiel treten spielimmanente aggressive Verhaltensweisen häufig auf.
Welche Handlungsansätze werden für den Kindergarten vorgeschlagen?
Die Arbeit schlägt einen dreistufigen Prozess für den Umgang mit spielimmanenter Aggressivität vor: Beobachtung, Handlung und Reflexion. Es werden konkrete Handlungsanweisungen für die Praxis gegeben, wie pädagogische Fachkräfte spielimmanente Aggressionen beobachten, angemessen eingreifen und anschließend mit den Kindern die Situation reflektieren und verarbeiten können.
Welche Theorien werden behandelt?
Die Arbeit behandelt klassische Entstehungstheorien zur Aggressivität, darunter die Frustrations-Aggressions-Theorie und die Triebtheorie von Lorenz. Die Theorie von Dollard und Miller wird kritisch beleuchtet und ihre Grenzen aufgezeigt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Spielimmanente Aggressivität, Gewalt, Aggression, Freispiel, Kindergarten, Pädagogik, Beobachtung, Intervention, Reflexion, kindliche Entwicklung, Frustrations-Aggressions-Theorie, Triebtheorie.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, ein besseres Verständnis für spielimmanente Aggressivität im Kindergarten-Freispiel zu entwickeln und pädagogische Fachkräfte mit angemessenen Handlungsansätzen auszustatten. Es geht darum, einen differenzierten Blick auf dieses Phänomen zu ermöglichen und den Umgang damit im pädagogischen Kontext zu verbessern.
- Quote paper
- Lukas Rühle (Author), 2022, Pädagogischer Umgang mit spielerischer Aggressivität im Kindergarten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1254017