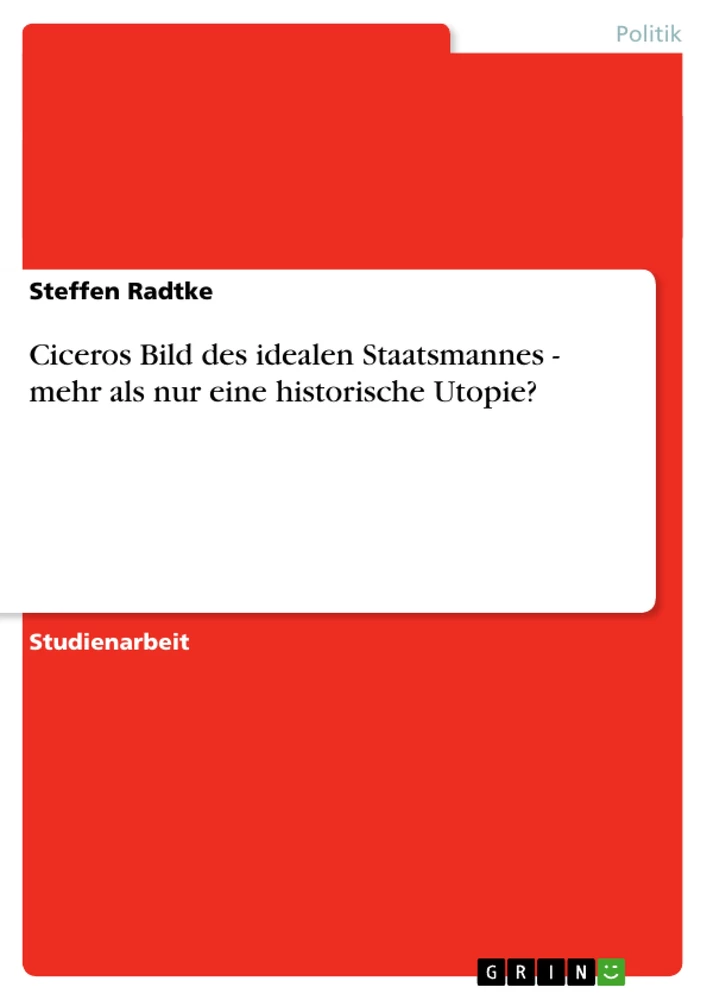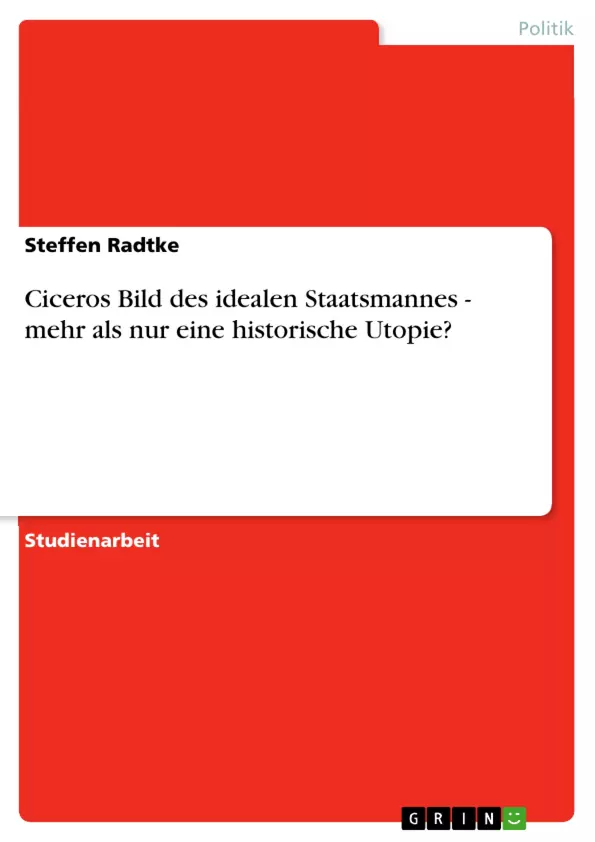Wer ein stabiles Wertefundament hat, projiziert dies konsequenterweise in seiner Erwartungshaltung auf andere Personen. Gerade Politiker, die im Fokus der Öffentlichkeit stehen und die Staatsführung innehaben, sollten in Wertfragen ein Vorbild sein. Als Konsequenz dessen setzt die politische Tätigkeit in gewissem Grad eine philosophische Fundierung voraus, und unter den Klassikern des politischen Denkens gibt es nur wenige, die quasi Zeit ihres Lebens beides in einem personifizierten.
Einer von ihnen ist der römische Redner, Staatsmann und Philosoph Marcus Tullius Cicero. Wenn sich sogar ein politisches Magazin nach ihm benennt, muss es in dessen Denken etwas Klassisches geben, was heute noch als Synonym für vollkommen vorbildliche politische Kultur gelten kann.
Aus diesem Grund soll es das Anliegen der Arbeit sein, anhand Ciceros Schriften sein Bild des idealen Staatsmannes darzustellen und aufzuzeigen, welche Werte ein Politiker im Sinne Ciceros unbedingt verkörpern muss, um für das Wohl des Gemeinwesens sorgen zu können. Ein Schwerpunkt liegt daher in der Auseinandersetzung mit dessen staatsphilosophischen Originaltexten „De re publica“, „De officiis“ und „De legibus“, ferner werden aber auch die eher moralphilosophischen Werke „De finibus bonorum et malorum“ sowie die „Tusculanae disputatiuones“ eine Rolle spielen. Angesichts der historischen Zeitumstände - die Römische Republik befindet sich im Verfallsprozess – stellt sich zunächst jedoch die Frage, inwiefern die Werte und Ideale Ciceros realistisch sind oder ob seine Gedanken nicht eher eine historische Utopie darlegen. Alle einflussreichen Protagonisten Roms verkörpern geradezu das Gegenteil der ciceronischen Ideale wie Einsatz für das Gemeinwohl, Vernunft und Tugend und so offenbart sich im Zuge der geschichtlichen Fallstudie die Dekadenz der römischen Republik. In diesem Zusammenhang soll ein Abriss darüber, wie sich Cicero dagegen stemmte, zum einen bereits Grundzüge seines staatsmännischen Denkens aufzeigen, zum anderen aber auch die Frage nach der historischen Utopie bejahen.
Das bedeutet jedoch keinesfalls, dass Ciceros Erwartungsbild an den idealen Staatsmann deswegen an Aktualität verloren hat. Das Gegenteil ist der Fall und daher zeigt die Arbeit im Schlussteil auf, dass die antiken Gedanken weit über ihre unmittelbare Gegenwart hinausreichen, indem es Cicero gelingt, einen zeitlos gültigen moralischen Leitfaden für politische Tugendhaftigkeit zu entwerfen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. „O Tempora, o mores!“
- 2.1 Die Dekadenz der römischen Republik
- 2.2 Der Fels in der Brandung
- 3. Der ideale Staatsmann
- 3.1 Gedanken in „De re publica“
- 3.1.1 Der Einsatz für den Staat
- 3.1.2 Gerechtigkeit als Fundament des Staates
- 3.1.3 Der Somnium Scipionis – eine kosmische Vision
- 3.2 Gedanken in „De officiis“
- 3.2.1 Die vier stoischen Kardinaltugenden
- 3.2.2 Themistokles und die Ehrenhaftigkeit
- 3.3 Antigone und das höhere Gebot
- 3.4 Rhetorik und Politik
- 3.5 Philosophie und Politik
- 4. Das Erhabene und das Lächerliche
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Ciceros Bild des idealen Staatsmannes anhand seiner Schriften. Ziel ist es, die von Cicero vertretenen Werte und Ideale aufzuzeigen und zu analysieren, inwiefern diese für das Wohl des Gemeinwesens relevant sind. Es wird geprüft, ob Ciceros Vorstellungen eine realistische Beschreibung politischen Handelns darstellen oder eher eine historische Utopie.
- Ciceros Vorstellung des idealen Staatsmannes
- Die Rolle von Gerechtigkeit und Naturrecht in Ciceros Denken
- Die Bedeutung der stoischen Kardinaltugenden für den politischen Akteur
- Der Einfluss von Philosophie und Rhetorik auf Ciceros staatsmännische Konzeption
- Der Vergleich zwischen Ciceros Idealen und der Realität der römischen Republik
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 (Einleitung): Die Einleitung thematisiert die zunehmende Politikverdrossenheit und stellt die Frage nach den Voraussetzungen für politisches Vertrauen. Cicero wird als Beispiel eines Politikers vorgestellt, dessen Denken auch heute noch relevant ist. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, Ciceros Bild des idealen Staatsmannes darzustellen.
Kapitel 2 („O Tempora, o mores!“): Dieses Kapitel beschreibt den Niedergang der römischen Republik, die Dekadenz der herrschenden Elite und die zunehmende politische Instabilität. Es wird gezeigt, wie Cicero versuchte, sich gegen diesen Verfallsprozess zu stemmen. Der Abschnitt erläutert die Reformunfähigkeit des Staates und die Spaltung der Führungsschicht in Optimaten und Popularen. Die militärischen Bedrohungen und die daraus resultierenden Machtkämpfe werden ebenfalls thematisiert.
Kapitel 3 (Der ideale Staatsmann): Dieses Kapitel analysiert Ciceros Schriften „De re publica“, „De officiis“ und andere Werke, um seine Vorstellungen vom idealen Staatsmann zu ergründen. Es wird auf den Einsatz für den Staat, die Bedeutung von Gerechtigkeit und Naturrecht, die stoischen Kardinaltugenden, sowie das Verhältnis von Rhetorik und Philosophie eingegangen. Der Somnium Scipionis als kosmische Vision wird ebenfalls diskutiert.
Schlüsselwörter
Cicero, idealer Staatsmann, römische Republik, Dekadenz, Gerechtigkeit, Naturrecht, stoische Kardinaltugenden, Weisheit, Tapferkeit, Mäßigung, Rhetorik, Philosophie, res publica, Gemeinwohl, politische Tugendhaftigkeit, historische Utopie.
- Arbeit zitieren
- Steffen Radtke (Autor:in), 2008, Ciceros Bild des idealen Staatsmannes - mehr als nur eine historische Utopie?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125462