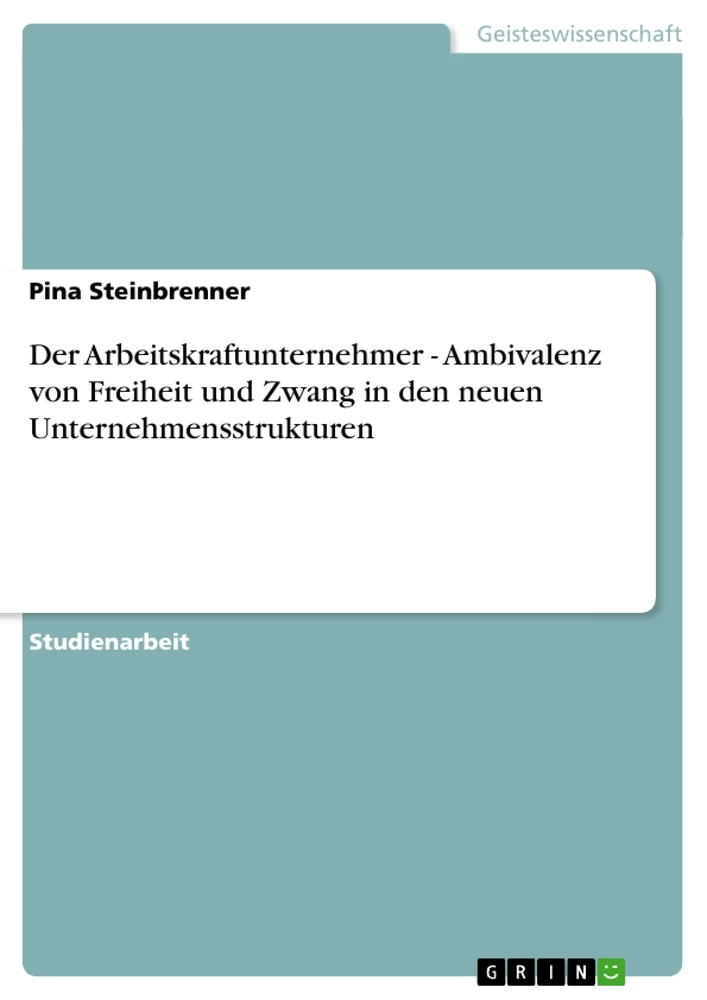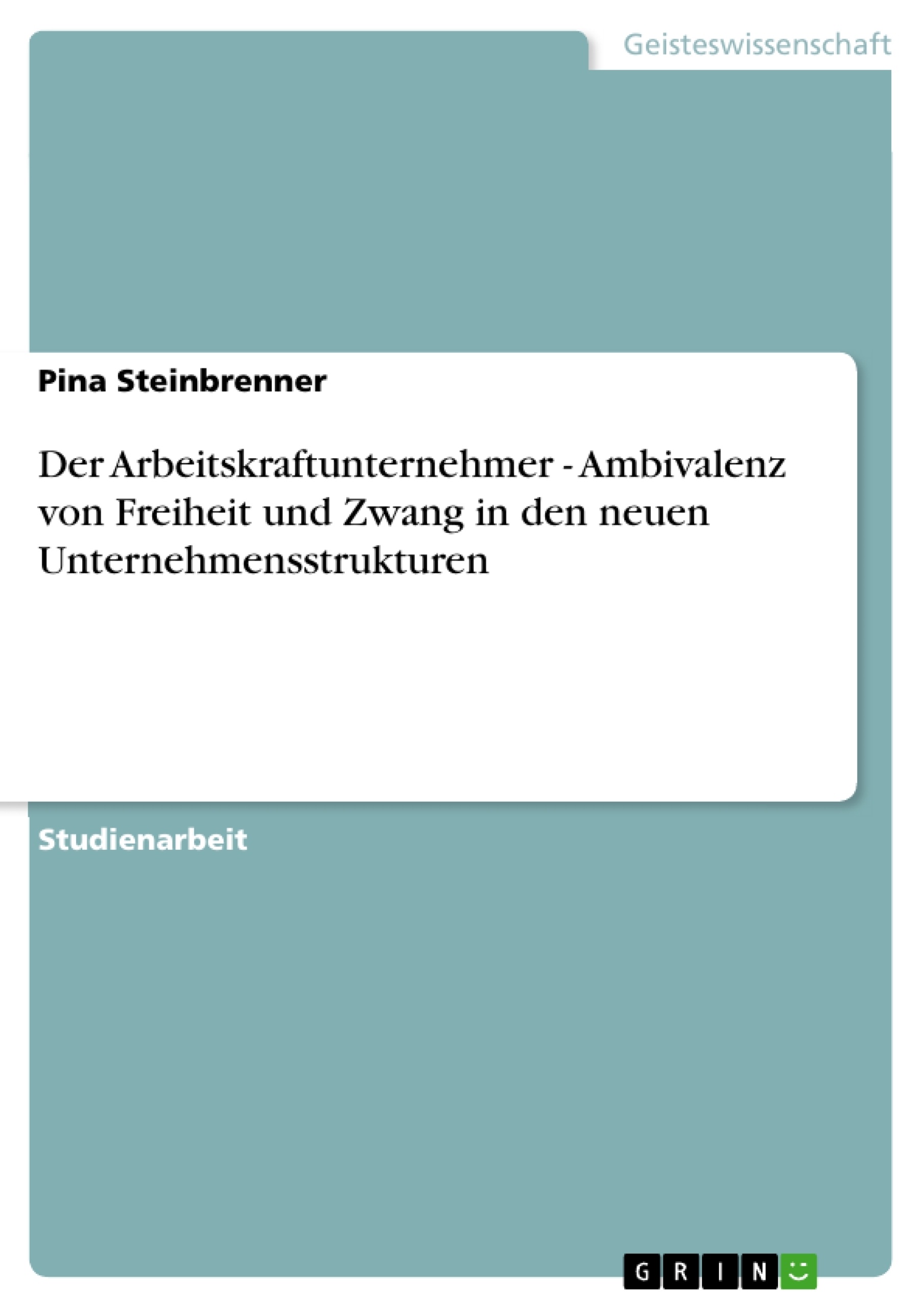Überstunden, Urlaub, der nicht in Anspruch genommen wird, Arbeiten
nach Feierabend am heimischen Computer für die Firma – das ist heute
Alltag vieler Berufstätiger. Ist es eine neue Dimension der Arbeitsmoral,
dass sich die Menschen aus Pflichtgefühl und Engagement über die
vertraglich geregelte Arbeitszeit hinaus ihrer Arbeit widmen?
Nein - höher, schneller, besser, davon ist unsere heutige Gesellschaft
getrieben. Unternehmen müssen im internationalen Vergleich mithalten
können, das Klima ist rauer geworden mit der Folge, dass ein kühlerer
Wind auch durch die Flure der Unternehmen weht. Um konkurrenzfähig zu
bleiben, sind Unternehmen gezwungen, sich durch Restrukturierungen
ihrer betrieblichen Organisation diesen Temperaturen anzupassen. In der
Konsequenz bedeutet dies, dass der unflexible Arbeitnehmer immer mehr
von einem selbstgesteuerten, selbstorganisierten Mitarbeiter abgelöst
wird, der auf dem Markt, im eigenen (oder eingekauften) Unternehmen
agiert.
Der „Arbeitskraftunternehmer“ – eine Wortfindung der beiden Soziologen
Günther Voß und Hans J. Pongratz (vgl. Voß/Pongratz 2004: 9ff), die sich
in den Ohren heute noch etwas seltsam anhören mag, aber vielleicht in
nicht all zu langer Zeit zum gängigen Wortschatz gehören wird. So wie der
Lohnarbeiter vom Arbeitnehmer abgelöst wurde, könnte der
„Arbeitskraftunternehmer“ der neue Arbeitskrafttypus unserer Zeit werden.
Was ist ein „Arbeitskraftunternehmer“ und wie wird er charakterisiert?
Um diesen neuen Typus einordnen zu können, wird im ersten Teil dieser
Arbeit die geschichtliche Entwicklung der Arbeitskraft beschrieben. Der
darauf folgende Teil beschäftigt sich zunächst mit der Darstellung der
neuen Strukturen, die erst die Voraussetzungen schaffen, dass eine neue
Form des Arbeitnehmers entstehen kann.
Welche Konsequenzen dieser Wandel der Arbeitsanforderungen für den
einzelnen bedeuten und inwiefern eine Anpassung an die neuen
Gegebenheiten nötig ist, soll abschließend in dieser Arbeit thematisiert
werden.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Arbeitswelt im Wandel
- Historische Entwicklung der Arbeitskraft
- Der proletarisierte Lohnarbeiter der Frühindustrialisierung
- Der verberuflichte Arbeitnehmer im Fordismus
- Neue Steuerungssysteme im Unternehmen
- Restrukturierung der Unternehmen
- Voraussetzungen für die Entstehung des „Arbeitskraftunternehmers“
- Der „Arbeitskraftunternehmer“ und seine idealtypischen Merkmale
- Das Transformationsproblem wird auf den Arbeitnehmer übertragen
- Die Selbstkontrolle
- Die Selbstökonomisierung
- Die Selbstrationalisierung
- Die Doppelrolle des neuen Arbeitnehmertypus
- Die neue Arbeitnehmer-„Freiheit“ ist die Unternehmer-Unfreiheit
- Der „Arbeitskraftunternehmer“ - gefangen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und die Charakteristika des „Arbeitskraftunternehmers“, ein neuer Arbeitnehmertypus, der durch den Wandel der Arbeitswelt hervorgerufen wird. Sie analysiert die geschichtliche Entwicklung der Arbeitskraft und die neuen Steuerungssysteme in Unternehmen, die diese Transformation ermöglichen.
- Historische Entwicklung der Arbeitskraft (vom proletarisierten Lohnarbeiter zum verberuflichten Arbeitnehmer)
- Restrukturierung von Unternehmen und neue Arbeitsformen
- Kennzeichen des „Arbeitskraftunternehmers“ (Selbstkontrolle, Selbstökonomisierung, Selbstrationalisierung)
- Die Ambivalenz der neuen Arbeitnehmerrolle: Freiheit und Unfreiheit
- Anpassung an die veränderten Arbeitsanforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit und stellt die zentrale Frage nach dem „Arbeitskraftunternehmer“. Kapitel 1 beleuchtet den fundamentalen Wandel der Arbeitswelt und die steigende Autonomie der Arbeitnehmer. Kapitel 2 analysiert die historische Entwicklung der Arbeitskraft, beginnend mit dem proletarisierten Lohnarbeiter der Frühindustrialisierung und der Entwicklung zum verberuflichten Arbeitnehmer im Fordismus. Kapitel 3 fokussiert auf die Restrukturierung von Unternehmen und die neuen Steuerungssysteme, die die Entstehung des „Arbeitskraftunternehmers“ ermöglichen. Kapitel 4 beschreibt die idealtypischen Merkmale dieses neuen Arbeitnehmertypus, einschließlich Selbstkontrolle, Selbstökonomisierung und Selbstrationalisierung. Kapitel 5 diskutiert die ambivalente Rolle des „Arbeitskraftunternehmers“, der zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberrollen gefangen sein kann.
Schlüsselwörter
Arbeitskraftunternehmer, Arbeitsweltwandel, Restrukturierung, Fordismus, Postfordismus, Selbstorganisation, Selbstkontrolle, Autonomie, Flexibilisierung, Arbeitnehmer, Arbeitgeber.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein „Arbeitskraftunternehmer“?
Ein Begriff der Soziologen Voß und Pongratz für einen neuen Arbeitnehmertypus, der sich selbst wie ein Unternehmen steuert und organisiert.
Was bedeutet Selbstökonomisierung?
Es bedeutet, dass der Arbeitnehmer seine eigenen Fähigkeiten und seine Zeit aktiv vermarktet und ständig an seiner eigenen Marktfähigkeit arbeitet.
Warum entsteht eine Ambivalenz zwischen Freiheit und Zwang?
Die neue Autonomie bietet zwar Freiheit in der Gestaltung, führt aber oft zu Selbstausbeutung und dem Zwang zur ständigen Selbstrationalisierung.
Wie hat sich die Arbeitskraft historisch entwickelt?
Die Entwicklung verlief vom proletarisierten Lohnarbeiter der Frühindustrialisierung über den verberuflichten Arbeitnehmer im Fordismus bis zum heutigen Arbeitskraftunternehmer.
Was ist Selbstrationalisierung?
Der Arbeitnehmer optimiert seine eigenen Arbeitsabläufe und sein Privatleben konsequent, um den steigenden Anforderungen der Arbeitswelt gerecht zu werden.
- Citar trabajo
- Pina Steinbrenner (Autor), 2008, Der Arbeitskraftunternehmer - Ambivalenz von Freiheit und Zwang in den neuen Unternehmensstrukturen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125561