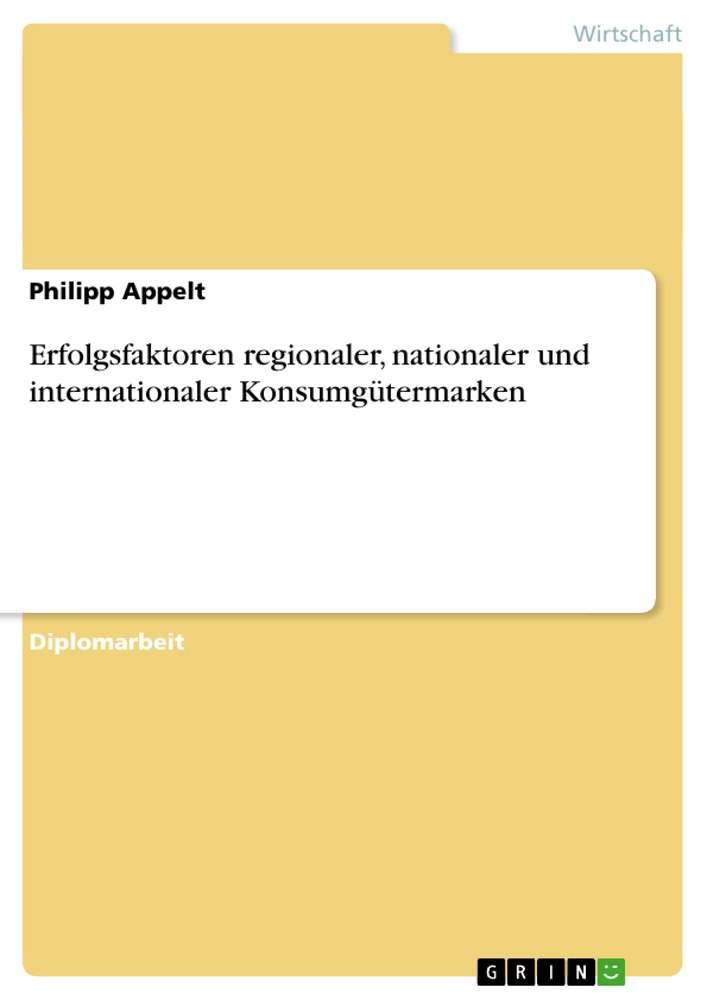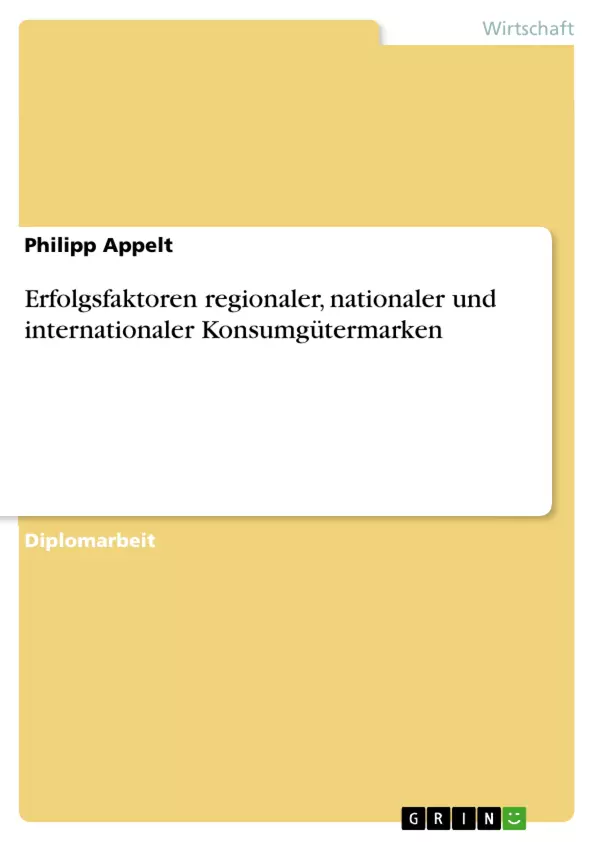„Unternehmerischer Mehrwert entsteht immer mehr an dem Platz, den ein Unternehmen in den Köpfen der Verbraucher besetzt.“ (Hassmann, 2006, S. 10)
Dieser Ausspruch verdeutlicht in Zeiten gesättigter Märkte den Wandel vom produktgetriebenen zum kundenzentrierten Management, in dem die Marke den entscheidenden Wettbewerbsvorteil darstellt. Ihr Aufbau und strategisches, sowie operatives Management gilt heute als entscheidender Erfolgsfaktor. Des Weiteren ist damit ein Trend zum Kommunikationswettbewerb verbunden, dem der Grundgedanke obliegt, dass die Markendifferenzierung primär durch Kommunikationsmaßnahmen erfolgt (vgl. Esch, Wicke, Rempel, 2005). Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf Konsumgütermarken von Herstellern, vor allem Consumer Packaged Goods (CPG) des Lebensmittel- und Getränkebereichs. Sie sind von besonderem wirtschaftlichem Interesse, da mit ihnen enorme Umsätze erzielt werden und Marktforschungsinstitute hochqualitative Marketingdaten im Rahmen regionaler oder nationaler Handelspanel sammeln und bereitstellen. Die für viele CPG-Kategorien charakteristische, schwache physische Produktdifferenzierung lässt zudem den Rückschluss zu, dass sich ergebende Marktstrukturen größtenteils auf Marketingaktivitäten zurückführen sind (vgl. Bronnenberg, Dhar, Dubé, 2005). Konsumenten sind beim Gang durch den Supermarkt einer Vielzahl von Marken ausgesetzt. Diese lassen sich nach ihrer distributorischen Reichweite in regionale, nationale und internationale Marken unterteilen. In vielen Produktkategorien existieren sie nebeneinander. Selbst große Konsumgüterhersteller wie Nestlé, Unilever oder Inbev halten regionale, nationale und internationale Marken derselben Kategorie in ihrem Portfolio.
Entscheiden sich Endverbraucher dabei bewusst für einen der
vorgestellten Markentypen? Wie lässt sich die jeweilige Markenperformance steigern oder ist die Koexistenz gar durch die fortschreitende Globalisierung der Märkte bedroht? Ökonomische Ziele wie Marktanteils- oder Rentabilitätssteigerungen lassen sich dabei über die Erfüllung von Sub-Zielen wie beispielsweise hohe Markenbekanntheit erreichen.
Die vorliegende Arbeit klärt diese Fragen zum einen mit Blick auf die jeweiligen Vorteile, den die unterschiedlichen Typen sowohl Herstellern, als auch Konsumenten bieten. Zum anderen werden kritische Erfolgsfaktoren abgeleitet und artgerecht eingeordnet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2. Marken im Konsumgüterbereich
- 2.1 Die Marke
- 2.2 Besonderheiten im Marketing von Konsumgütermarken
- 2.3 Country/Region of Origin-Effekt
- 3. Regionale Marken
- 3.1 Die Region - Einflussgebiet regionaler Marken
- 3.2 Gründe für die Existenz regionaler Marken
- 3.3 Vorteile regionaler Marken
- 3.4 Erfolgsfaktoren regionaler Marken
- 3.4.1 Kommunikationspolitik regionaler Marken
- 3.4.2 Das Spannungsfeld zwischen Tradition und Innovation
- 3.4.3 Exogene Erfolgsfaktoren
- 3.5 Erfolgsfaktoren geographischer Ausdehnung - Nationalisierung
- 4. Nationale Marken
- 4.1 Problematik im Untersuchungsfeld „Nationale Marken“
- 4.2 Vorteile nationaler Marken
- 4.3 Erfolgsfaktoren nationaler Marken
- 4.3.1 Kulturbedingte Ausgestaltung der Markenidentität
- 4.3.2 Distribution und Beziehungen zum Einzelhandel
- 4.3.3 Lokalvorteile und differenzierte Marketing-Mix Gestaltung
- 4.3.4 Ersteintrittsvorteil und dessen Bewahrung
- 4.3.5 Markenerweiterungen nationaler Marken
- 4.4 Internationalisierung als erfolgreiche markenstrategische Option
- 5. Internationale Marken
- 5.1 Internationale Marke, Internationales Branding und Marketing
- 5.2 Der Standardisierungsgrad
- 5.3 Vorteile internationaler Marken
- 5.4 Erfolgsfaktoren internationaler Marken
- 5.4.1 Auswahl geeigneter Auslandsmärkte
- 5.4.2 Grenzüberschreitende Segmentierung
- 5.4.3 Kommunikationspolitik internationaler Marken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Erfolgsfaktoren regionaler, nationaler und internationaler Konsumgütermarken. Ziel ist es, die jeweiligen Vorteile der verschiedenen Markentypen aufzuzeigen und zu analysieren, wie die Markenperformance gesteigert werden kann. Die Arbeit beleuchtet die Zusammenhänge zwischen Markengröße, Marketingstrategien und wirtschaftlichem Erfolg.
- Vorteile und Herausforderungen regionaler, nationaler und internationaler Marken
- Einfluss von Kommunikationsstrategien auf den Markterfolg
- Rolle kultureller Faktoren bei der Markenbildung und -positionierung
- Bedeutung von Distribution und Einzelhandelsbeziehungen
- Internationalisierung als strategische Option für nationale Marken
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Problemstellung ein und beschreibt den Wandel vom produkt- zum kundenzentrierten Management. Kapitel 2 definiert den Begriff Marke im Kontext von Konsumgütern und beleuchtet Besonderheiten des Marketings. Kapitel 3 analysiert regionale Marken, ihre Vorteile und Erfolgsfaktoren, insbesondere die Kommunikationspolitik und das Spannungsfeld zwischen Tradition und Innovation. Kapitel 4 befasst sich mit nationalen Marken, ihren Vorteilen und den Herausforderungen durch Handelsmarken. Kapitel 5 untersucht internationale Marken, den Standardisierungsgrad und die Erfolgsfaktoren internationaler Markenstrategien.
Schlüsselwörter
Regionale Marken, Nationale Marken, Internationale Marken, Konsumgütermarketing, Markenidentität, Kommunikationspolitik, Distribution, Internationalisierung, Markenperformance, Kulturfaktoren, Handelmarken.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Erfolgsfaktoren regionaler Marken?
Regionale Marken punkten oft durch Tradition, Authentizität und den "Region of Origin"-Effekt, der Vertrauen bei Konsumenten schafft, die Wert auf lokale Herkunft legen.
Wie unterscheiden sich nationale von internationalen Marken?
Nationale Marken sind auf die Kultur und Distribution eines Landes zugeschnitten, während internationale Marken auf Standardisierung und grenzüberschreitende Segmentierung setzen.
Warum ist die Markenkommunikation heute so wichtig?
In gesättigten Märkten mit geringer physischer Produktdifferenzierung entsteht der Mehrwert primär in den Köpfen der Verbraucher durch gezielte Marketingaktivitäten.
Was ist der „Country of Origin“-Effekt?
Dies beschreibt den Einfluss des Herstellungslandes auf die Qualitätswahrnehmung und Kaufentscheidung der Konsumenten (z.B. "Made in Germany").
Ist die Koexistenz verschiedener Markentypen durch Globalisierung bedroht?
Die Arbeit untersucht, ob regionale Marken trotz globaler Player bestehen können, indem sie Nischen besetzen und emotionale Bindungen stärken.
- Citar trabajo
- Philipp Appelt (Autor), 2007, Erfolgsfaktoren regionaler, nationaler und internationaler Konsumgütermarken, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125562