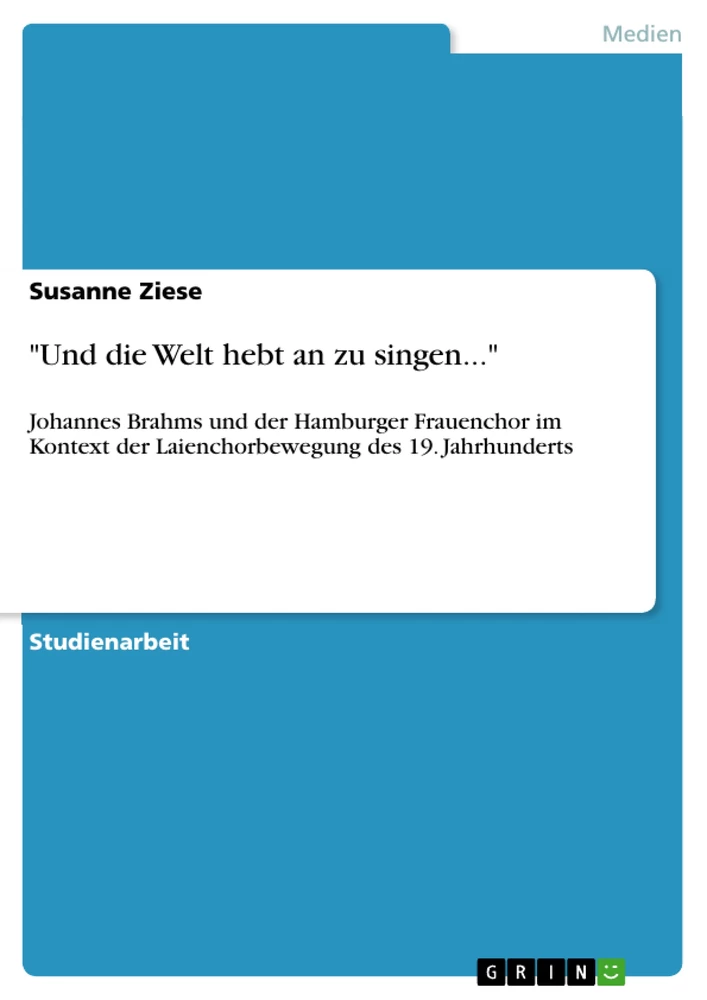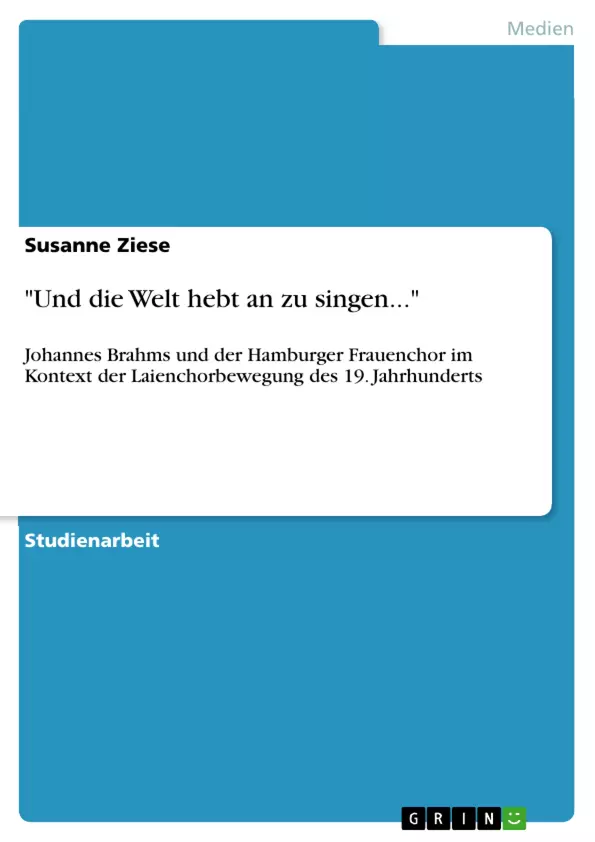Die Arbeit widmet sich der These, dass die Laienchorbewegung am Ende des 18. und zu Beginn des darauf folgenden Jahrhunderts durchaus Professionalisierungstendenzen aufweist, wenngleich in verschieden starker Ausprägung und unter verschiedenen Bedingungen.
Schwerpunkt der Betrachtungen sollen jene Bedingungen oder Faktoren sein, welche Einfluss auf den Prozess der Professionalisierung haben können. Hierzu wird zunächst die Entwicklung des Chorwesens von seinen Anfängen im 18. Jahrhundert an, einschließlich der verschiedenen Chormodelle wie der Singakademie oder den Liederkränzen, beleuchtet werden. Anschließend soll als eine Art Sonderfall innerhalb dieser Entwicklung auf den Frauenchor unter der Leitung von Johannes BRAHMS eingegangen werden.
Zum Abschluss werden die ermittelten Faktoren einander gegenübergestellt und hinsichtlich ihrer Art und Wirkung auf die Professionalität bewertet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Entwicklung des Chorwesens vom Ende des 18. Jahrhunderts an
- Kurze Begriffgeschichte des Dilettantismus
- Zeig mir deinen Singverein und ich sage dir, wer du bist!
- Johannes Brahms und die Damenchöre
- Ein Damenkränzchen in der Heimatstadt
- Entstehung und Entwicklung des Hamburger Frauenchors
- Erst die Arbeit - dann das Vergnügen?
- Folgeentwicklungen
- Der Aspekt der Professionalisierung in der Entwicklung des Chorwesens
- Was macht Professionalität aus?
- Volksbildung vs. Elite
- Früchte der Geselligkeit
- Abschlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die These, dass die Laienchorbewegung des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts Professionalisierungstendenzen aufwies. Der Fokus liegt auf den Faktoren, die diesen Prozess beeinflussten.
- Entwicklung des Chorwesens im 18. und 19. Jahrhundert
- Der Begriff des Dilettantismus und seine Bedeutung
- Der Frauenchor im Kontext der Laienchorbewegung
- Johannes Brahms und seine Arbeit mit Damenchören
- Professionalisierung im Laienchorwesen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Professionalisierung im Kontext der Musik ein und stellt die zentrale These der Arbeit vor. Kapitel 2 beleuchtet die Entwicklung des Chorwesens um 1800, inklusive einer Begriffsbestimmung des "Dilettantismus" und der Rolle der Frau im gesellschaftlichen Gefüge. Kapitel 3 konzentriert sich auf Johannes Brahms und seine Arbeit mit Damenchören, einschließlich der Entstehung und Entwicklung des Hamburger Frauenchors. Kapitel 4 untersucht verschiedene Aspekte der Professionalisierung im Chorwesen.
Schlüsselwörter
Laienchorbewegung, Professionalisierung, Dilettantismus, Frauenchor, Johannes Brahms, Hamburger Frauenchor, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, Musikgeschichte, Chormusik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale These der Arbeit zur Laienchorbewegung?
Die Arbeit untersucht die These, dass die Laienchorbewegung am Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts deutliche Professionalisierungstendenzen aufwies.
Welche Chormodelle werden in der Untersuchung beleuchtet?
Es werden verschiedene Modelle wie die Singakademien, die Liederkränze und spezielle Damenchöre betrachtet.
Welche Rolle spielte Johannes Brahms für das Chorwesen?
Die Arbeit geht detailliert auf den von Johannes Brahms geleiteten Hamburger Frauenchor ein und analysiert diesen als Sonderfall der Professionalisierung.
Was bedeutete der Begriff "Dilettantismus" im 18. Jahrhundert?
Die Arbeit bietet eine Begriffsgeschichte des Dilettantismus, der damals oft eine andere, weniger negative Konnotation als heute hatte und eng mit der bürgerlichen Musikkultur verknüpft war.
Welche Faktoren beeinflussten die Professionalisierung der Chöre?
Einflussfaktoren waren unter anderem die soziale Zusammensetzung der Vereine, die musikalische Leitung sowie das Spannungsfeld zwischen Volksbildung und elitärem Anspruch.
Wie wirkte sich die Geselligkeit auf die Qualität der Chöre aus?
Die Arbeit untersucht, inwieweit die "Früchte der Geselligkeit" und der soziale Rahmen der Singvereine die musikalische Professionalität förderten oder behinderten.
- Citation du texte
- Susanne Ziese (Auteur), 2006, "Und die Welt hebt an zu singen..." , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125625