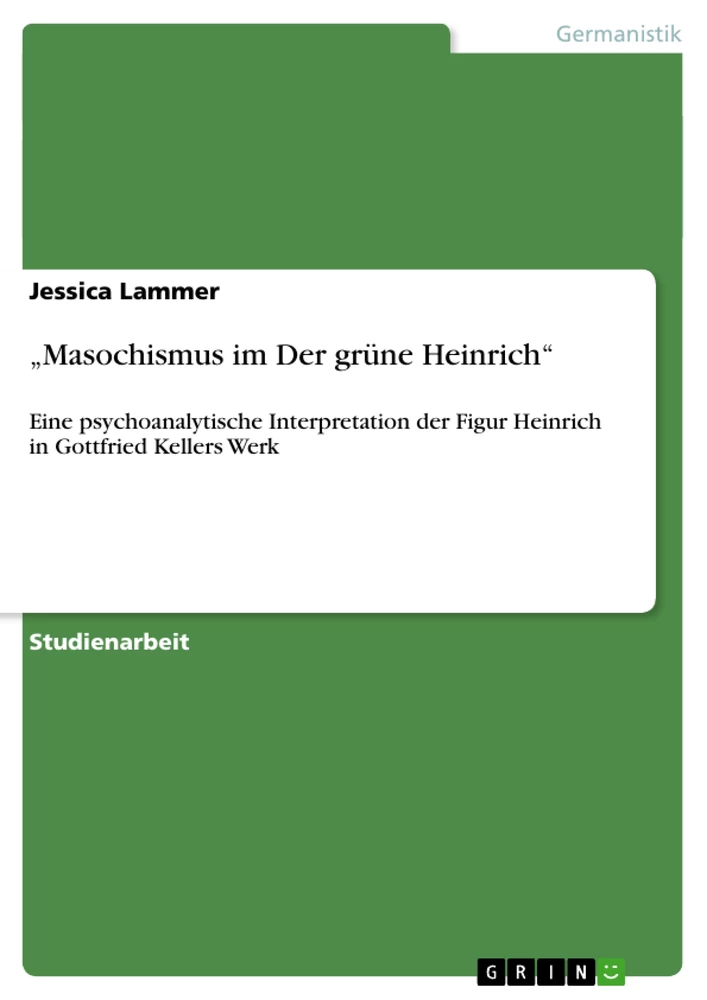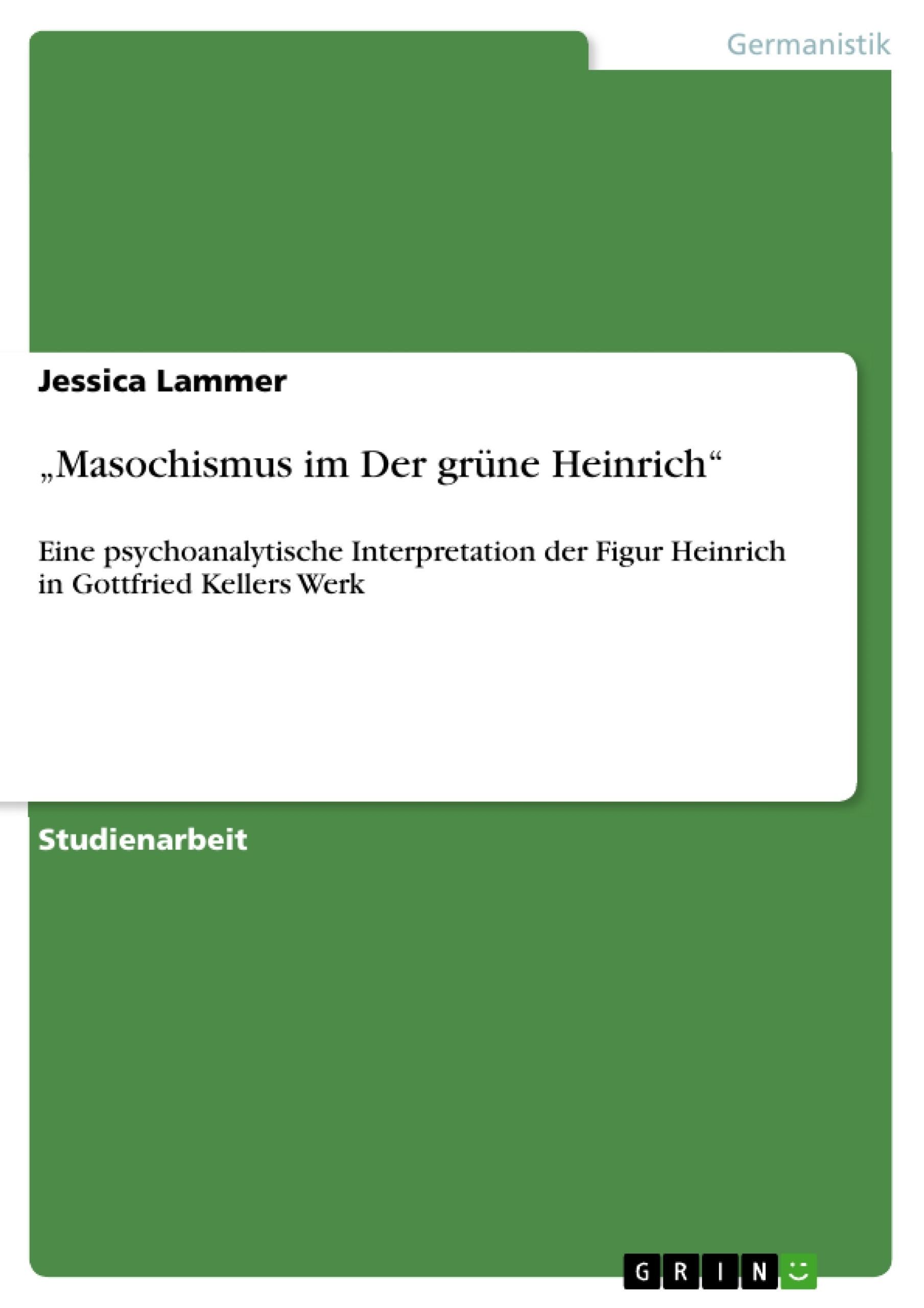„The masochist projects his superego and arranges for the environment to ´punish´ him […]”
Masochismus – insbesondere der gesellschaftliche Masochismus ist in literarischen Werken so allgegenwärtig wie er auch versteckt wüten kann. Mit Erika Kohut beispielsweise – auch Die Klavierspielerin (1983) genannt – hat Elfride Jelinek eine Charakterfigur geschaffen die offensichtlich ihre Umwelt dazu nötigt sie zu bestrafen. Die junge Frau, ausgebildete Klavierprofessorin, gescheitere Pianistin, lebt allein mit ihrer Mutter. Nach dem Tod ihres Vaters, scheint diese die Rolle des Ehemanns übernommen zu haben um sich der Mutter zu unterwerfen. Zwischen beiden besteht seit jeher eine Art Hassliebe. Die Mutter kontrolliert Erika aufs genaueste; lässt ihrer Tochter keine Freiräume. Die Zeit am Wiener Konservatorium, wo Erika arbeitet, ist die einzige Möglichkeit ohne Mutter zu sein. Und wie das genannte Zitat über den Masochisten bereits ausdrückt, projeziert auch Erika, aufgrund der familiären Konstellation, die kontrollierende Instanz auf ihre Mutter:
„Doch das Kind will sie immer, und sie will immer wissen, wo man das Kind notfalls erreichen kann, wenn der Mama der Herzinfarkt droht“ Die Mutter macht Erika zu ihrem „Besitz“ dass „möglichst unbeweglich an einem Ort zu fixieren“ ist – und Erika lässt dies zu, indem sie bei ihr wohnt und gar mit ihr im Ehebett nächtigt. Erika liebt sie auf eine ganz eigene Art, indem sie sich unterwirft und Hass provoziert. An einer Stelle, als Erika mal wieder zu spät nach Hause kommt, da sie verbotener Weise Kleider kauft, bricht ein Streit aus.
„Du Luder, du Luder, brüllt Erika, wütend die ihr übergeordnete Instanz an und verkrallt sich in ihrer Mutter dunkelblond gefärbten Haaren, die an den Wurzeln grau nachstoßen.[...] Sie reißt wütend daran. Die Mutter heult.“
Diese Szene zeigt, dass die gegenseitige körperliche Gewalt nicht ausgeschlossen wird. Das Verhältnis basiert somit auf einem sadomasochistischen Verhältnis.
Eine Liebesbeziehung ist für Erika unvorstellbar. Um sich einem Mann zu unterwerfen? Wenn baut auch diese Beziehung auf Hass, Macht und Manipulation auf. Der Klavierschüler Walter Klemmer der sich in sie verliebt, muss sich an Regeln halten, um Erikas Partner zu werden. Nach dem ersten Treffen zu Hause zieht sie Knebel, Handschellen und anderes Folterhandwerk heraus. An anderer Stelle legt Erika einer Nebenbuhlerin „die sich duch innige Anbiederungsversuche an Walter Klemmer, der [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- „Der grüne Heinrich“ und seine Entwicklung zur masochistischen Persönlichkeit
- Kindheit und Jugend bei Heinrich
- Masochistische Charaktereigenschaften nach Theodor Reik bei Heinrich
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Figur Heinrich in Gottfried Kellers „Der grüne Heinrich“ unter dem Aspekt des Masochismus. Ziel ist es, anhand einer psychoanalytischen Interpretation zu analysieren, inwiefern Heinrichs familiäre Konstellation und die daraus resultierenden psychischen Konflikte zu einer masochistischen Lebenshaltung beitragen. Die Arbeit konzentriert sich auf eine werkimmanente Betrachtung, ohne Kellers Biografie heranzuziehen.
- Heinrichs Entwicklung einer masochistischen Persönlichkeit
- Der Einfluss von Kindheit und Jugend auf Heinrichs Charakter
- Psychoanalytische Interpretation von Heinrichs Verhalten
- Vergleich mit masochistischen Theorien nach Theodor Reik
- Die Rolle des "Vaterverlusts" in Heinrichs Persönlichkeitsentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Masochismus in der Literatur ein und benennt die Forschungsfrage: Inwiefern ist Heinrich in Gottfried Kellers „Der grüne Heinrich“ als Masochist zu betrachten? Es wird der Fokus auf den „gesellschaftlichen“ Masochismus gelegt und die Methodik der werkimmanenten Analyse erläutert. Die Arbeit stützt sich auf psychoanalytische Theorien, insbesondere die von Theodor Reik, und untersucht die Entstehung von masochistischen Tendenzen bei Heinrich ausgehend von seiner familiären Konstellation und den damit verbundenen psychischen Konflikten.
„Der grüne Heinrich“ und seine Entwicklung zur masochistischen Persönlichkeit: Dieses Kapitel untersucht, ob Kellers Roman als Entwicklungsroman bezeichnet werden kann. Im Gegensatz zu klassischen Entwicklungsromanen wie Goethes „Wilhelm Meister“, zeigt „Der grüne Heinrich“ das Scheitern eines Menschen an seiner Außenwelt und die Entstehung einer Persönlichkeitskrise. Heinrichs Wunsch, Künstler zu werden, scheitert, und er endet psychisch zerrüttet. Das Kapitel stellt die Frage nach den Ursachen dieser „fehlgelenkten“ Identitätsentwicklung und der Entstehung einer masochistischen, teilweise sadomasochistischen Persönlichkeit, wobei die Kindheit und Jugend Heinrichs im Mittelpunkt stehen.
Kindheit und Jugend bei Heinrich: Dieser Abschnitt analysiert den frühen Lebensabschnitt Heinrichs, wobei der Vaterverlust im fünften Lebensjahr als prägendes Ereignis hervorgehoben wird. Der fehlende Vater als maßgebende Autoritätsperson beeinflusst die Entwicklung von Heinrichs Ich- und Über-Ich-Instanz. Die Abwesenheit einer starken väterlichen Figur wird als potenzieller Auslöser für die Entwicklung masochistischer Tendenzen betrachtet.
Schlüsselwörter
Masochismus, Gottfried Keller, Der grüne Heinrich, Psychoanalyse, Theodor Reik, Identitätsentwicklung, Vaterverlust, Persönlichkeitskrise, Werkinterpretation, Gesellschaftlicher Masochismus
Häufig gestellte Fragen zu "Der grüne Heinrich" - Masochismusanalyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert die Figur Heinrich in Gottfried Kellers Roman "Der grüne Heinrich" unter dem Aspekt des Masochismus. Der Fokus liegt auf der Frage, inwiefern Heinrichs familiäre Konstellation und daraus resultierende psychische Konflikte zu seiner masochistischen Lebenshaltung beitragen.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Analyse verwendet eine werkimmanente Methode, d.h. sie konzentriert sich auf den Text selbst und bezieht Kellers Biografie nicht mit ein. Die Interpretation stützt sich auf psychoanalytische Theorien, insbesondere die von Theodor Reik.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Zentrale Themen sind Heinrichs Entwicklung einer masochistischen Persönlichkeit, der Einfluss seiner Kindheit und Jugend, eine psychoanalytische Interpretation seines Verhaltens, ein Vergleich mit masochistischen Theorien nach Theodor Reik und die Rolle des "Vaterverlusts" in seiner Persönlichkeitsentwicklung. Die Arbeit untersucht auch, ob "Der grüne Heinrich" als Entwicklungsroman klassifiziert werden kann und analysiert Heinrichs "fehlgelenkte" Identitätsentwicklung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel ("Der grüne Heinrich" und seine Entwicklung zur masochistischen Persönlichkeit" mit den Unterkapiteln "Kindheit und Jugend bei Heinrich" und "Masochistische Charaktereigenschaften nach Theodor Reik bei Heinrich") und einen Schluss. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und Methodik vor, das Hauptkapitel analysiert Heinrichs Entwicklung und das Schlusscapitel fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Rolle spielt der Vaterverlust?
Der Vaterverlust im fünften Lebensjahr Heinrichs wird als prägendes Ereignis betrachtet, welches die Entwicklung seines Ichs und Über-Ichs maßgeblich beeinflusst und als potenzieller Auslöser für die Entwicklung masochistischer Tendenzen angesehen wird.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Masochismus, Gottfried Keller, Der grüne Heinrich, Psychoanalyse, Theodor Reik, Identitätsentwicklung, Vaterverlust, Persönlichkeitskrise, Werkinterpretation und Gesellschaftlicher Masochismus.
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Inwiefern ist Heinrich in Gottfried Kellers „Der grüne Heinrich“ als Masochist zu betrachten?
- Arbeit zitieren
- Jessica Lammer (Autor:in), 2009, „Masochismus im Der grüne Heinrich“ , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125763