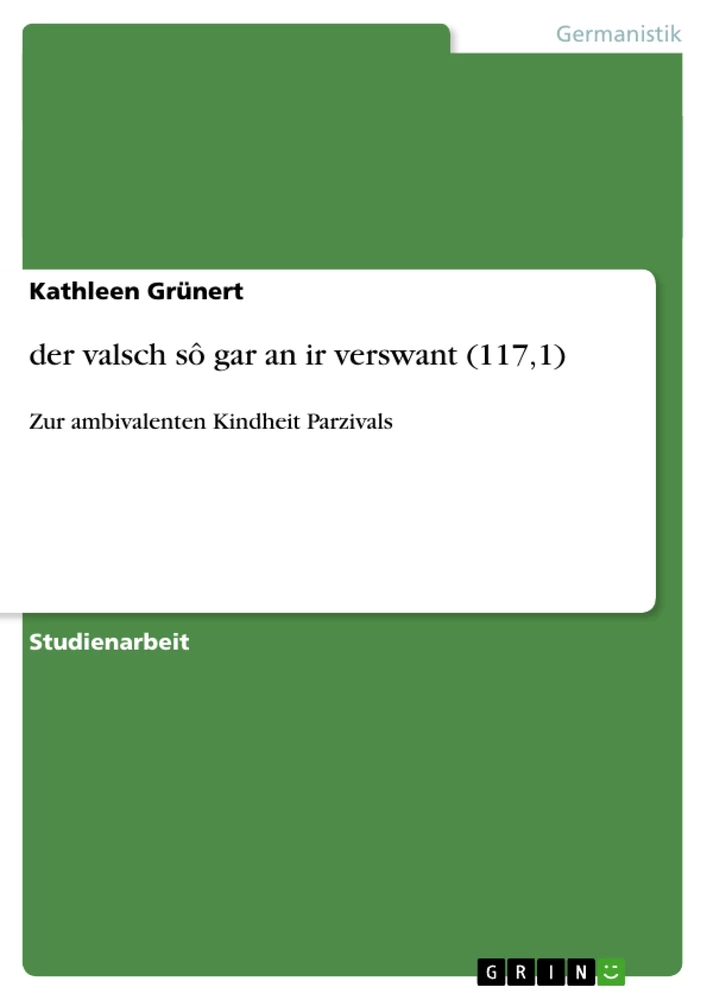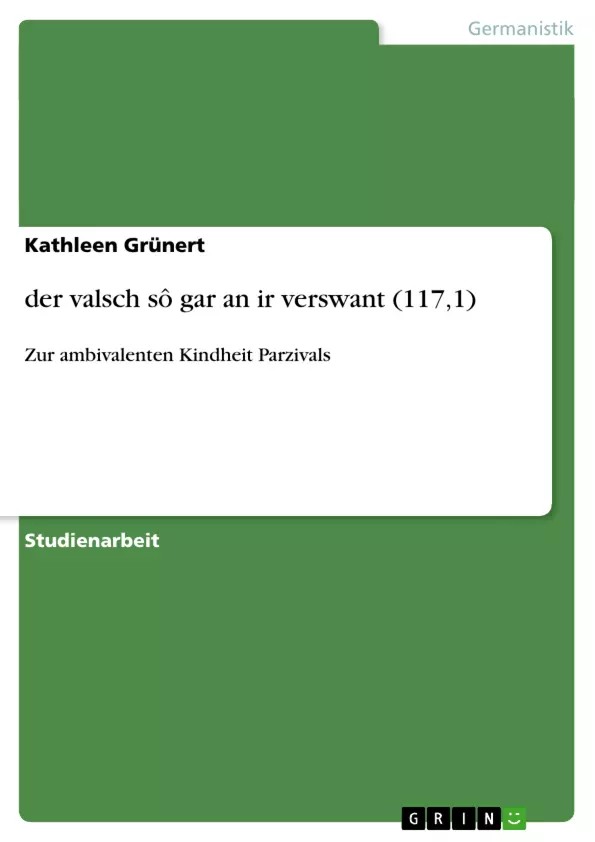Entgegen den Helden anderer Werke der mittelalterlichen Literatur, so zum Beispiel Gregorius oder Tristan, kennzeichnet sich Parzivals Kindheit durch eine Ferne zu höfischer Gesellschaft und Erziehung. In der Nicht-Welt von Soltâne unbekannt für die Außenwelt und unbekannt für sich selbst, da durch seine Mutter seiner Identität verheimlicht, scheint sich Parzival einem unbekümmerten Leben hinzugeben bis durch eine Begegnung mit vier Rittern seine ritterliche art geweckt wird und er Soltâne und seine Mutter verlässt.
So eindeutig wie auf den ersten Blick ist Parzivals Kindheit aber nicht zu bewerten. Bei genauerer Betrachtung ergeben sich verschiedene Ambivalenzen in der Mutter-Sohn-Beziehung. Hierbei ist schon der Ort Soltâne selbst gekennzeichnet durch widersprüchliche Strukturen. Hinzu kommen noch Herzeloyde selbst und ihre Motivation für den Rückzug nach Soltâne, Parzivals Verhalten und die Lehren Herzeloydes vor Parzivals Aufbruch.
Mit der vorliegenden Arbeit sollen diese Ambivalenzen erarbeitet und genauer betrachtet werden. Zunächst wird dazu der Ort Soltâne im Mittelpunkt stehen. Danach wird zu klären sein, wie Herzeloydes Motivation für ihren Rückzug zu bewerten ist, da sich hier zwischen Erzählerbewertung und Textdarstellung eine Ambivalenz entwickelt. Im weiteren Verlauf der Arbeit steht dann die Beziehung zwischen Mutter und Sohn im Vordergrund, die anhand ausgewählter prägender Ereignisse wie der Vogelepisode oder den Lehren Herzeloydes sowie der Identitätsproblematik Parzivals deren Ambivalenz verdeutlichen soll, woran sich die Betrachtung der Begegnung mit den Rittern als Initialereignis für den Aufbruch Parzivals anschließt. In einer abschließenden Zusammenfassung sollen dann noch einmal die wichtigsten Erkenntnisse zusammengetragen und bewertet werden.
Es wird also zu zeigen sein, inwiefern sich Parzivals Kindheit durch Ambivalenzen auszeichnet und was diese für die Beziehung zu seiner Mutter und das Handeln innerhalb Soltânes bedeuten.
Die Versangaben beziehen sich im Folgenden auf die Ausgabe des Deutschen Klassiker Verlages von 2006. Zu Vergleichen werden jedoch alle drei Texte der Primärliteratur herangezogen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Soltâne als ambivalenter Raum
3. Herzeloydes Rückzug nach Soltâne
3.1 Aussagen des Erzählers zu Beginn des dritten Buches
3.2 Aussagen des weiterführenden Textes
4. Ambivalenz der Mutter-Sohn-Beziehung
4.1 Ambivalenz Parzivals
4.2 Die Vogelepisode (118,7-119,15)
4.3 Ambivalenz der Lehren
5. Ein Ende der Erstarrung und Ausgrenzung – Parzivals Begegnung mit den Rittern
6. Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Entgegen den Helden anderer Werke der mittelalterlichen Literatur, so zum Beispiel Gregorius oder Tristan, kennzeichnet sich Parzivals Kindheit durch eine Ferne zu höfischer Gesellschaft und Erziehung.1 In der Nicht-Welt von Soltâne unbekannt für die Außenwelt und unbekannt für sich selbst, da durch seine Mutter seiner Identität verheimlicht, scheint sich Parzival einem unbekümmerten Leben hinzugeben bis durch eine Begegnung mit vier Rittern seine ritterliche art geweckt wird und er Soltâne und seine Mutter verlässt.
So eindeutig wie auf den ersten Blick ist Parzivals Kindheit aber nicht zu bewerten. Bei genauerer Betrachtung ergeben sich verschiedene Ambivalenzen in der Mutter-Sohn-Beziehung. Hierbei ist schon der Ort Soltâne selbst gekennzeichnet durch widersprüchliche Strukturen. Hinzu kommen noch Herzeloyde selbst und ihre Motivation für den Rückzug nach Soltâne, Parzivals Verhalten und die Lehren Herzeloydes vor Parzivals Aufbruch.
Mit der vorliegenden Arbeit sollen diese Ambivalenzen erarbeitet und genauer betrachtet werden. Zunächst wird dazu der Ort Soltâne im Mittelpunkt stehen. Danach wird zu klären sein, wie Herzeloydes Motivation für ihren Rückzug zu bewerten ist, da sich hier zwischen Erzählerbewertung und Textdarstellung eine Ambivalenz entwickelt. Im weiteren Verlauf der Arbeit steht dann die Beziehung zwischen Mutter und Sohn im Vordergrund, die anhand ausgewählter prägender Ereignisse wie der Vogelepisode oder den Lehren Herzeloydes sowie der Identitätsproblematik Parzivals deren Ambivalenz verdeutlichen soll, woran sich die Betrachtung der Begegnung mit den Rittern als Initialereignis für den Aufbruch Parzivals anschließt. In einer abschließenden Zusammenfassung sollen dann noch einmal die wichtigsten Erkenntnisse zusammengetragen und bewertet werden.
Es wird also zu zeigen sein, inwiefern sich Parzivals Kindheit durch Ambivalenzen auszeichnet und was diese für die Beziehung zu seiner Mutter und das Handeln innerhalb Soltânes bedeuten.
Die Versangaben beziehen sich im Folgenden auf die Ausgabe des Deutschen Klassiker Verlages von 2006. Zu Vergleichen werden jedoch alle drei Texte der Primärliteratur herangezogen.
2. Soltâne als ambivalenter Raum
Mit der Beschreibung Soltânes als walt (117,8) und waste (117,9) eröffnet der Erzähler einen Gegenraum zum bisherigen höfischen Leben Herzeloydes in Kanvoleiz. Die waste im Sinne einer ungastlichen, unbewohnbaren, unkultivierten und wilden Gegend2 bildet einen ungeordneten Naturraum ab, in dem weder ritterliches Leben, Tugenden des Rittertums noch Burgen, Turniere und das Minnespiel einen Platz finden.3 Als Ort außerhalb des höfischen Daseins, der keine gesellschaftlichen Regeln und soziale Lenkung kennt, wird Soltâne der Wirklichkeit entzogen und stellt zunächst einen irrealen Raum dar, der als Nicht-Ort für ein Einsiedlerleben typisch ist. Hierin besteht nun aber die erste Ambivalenz, denn auch wenn es zunächst so aussieht, begibt sich Herzeloyde keineswegs in ein Einsiedlerleben. Indem sie ihren Sohn Parzival und unbestimmte liute (117,16) mit sich führt und die liute das Land bûwen und riuten (117,17) lässt, bricht sie zum einen den ungeordneten und unkultivierten Charakter der waste auf und zum anderen führt sie eine gewisse feudale Hierarchie in den eigentlichen antihöfischen Raum wieder ein. Deutlich wird dies durch einen Vergleich zum Iwein Hartmann von Aues, der durch den Verlust seiner höfischen Identität ein wirkliches Einsiedlertum in der Wildnis nahe dem Wahnsinn verlebt. Anders als er entscheidet sich Herzeloyde jedoch bewusst für eine Abkehr vom Hof und legt auch ihren Namen nicht ab. Sie verzichtet zwar auf die bisherigen höfischen Lebensstandards und ihre Traurigkeit lässt sie die Blumen der Wiesen nicht beachten (117,10-117,12), doch kommt ihr Rückzug vielmehr einem Versuch gleich einen neuen Hof ohne Ritterschaft aufzubauen. Die Hierarchieordnung wird dann sichtbar, wenn sie den liuten durch ihren höheren Rang verbietet Parzival nur ein Wort über Ritterschaft preiszugeben (117,22f.).
Hier schließt sich nun eine weitere Doppelwertigkeit an, denn die armuot (116,15) in die sich Herzeloyde begibt ist für sie keine Armut im eigentlichen Wortsinn.4 Sie besitzt zwar nach dem Rückzug nach Soltâne in eine bäuerliche Einsamkeit keine
Länder sowie keinen Hofstaat mit dem dazugehörigen materiellen Reichtum mehr und muss auch ohne Ehemann zurechtkommen, dennoch sieht sie die selbst gewählte Armut eher als Schutz. Schutz zum einen für Parzival vor den Gefahren des Rittertums und damit verbunden als Schutz für sich selbst vor weiterer Trauer durch Verlust des Gatten und des Sohnes. Die negativ konnotierte armuot, die dem Raum Soltâne als waste also eigentlich eingeschrieben ist, wandelt sich durch Herzeloyde zu einer positiven armuot, die ihr laut Erzähler das helleviur (117,18) erspart.
Ein dritter und vierter Aspekt wenden sich dem Raum Soltâne direkt zu. Zum einen betrifft dies die Darstellung der Einöde selbst. Noch bei Iwein wird die Wildnis als dunkler, gefährlicher Ort beschrieben, in dem schreckliche Kreaturen wohnen und der eine Gefahr für jeden normalen Menschen darstellt. Im Parzival gleicht diese Wildnis aber eher einem locus amoenus. Bluomen ûf die plâne (117,10), cranz (117,12 ), rôt oder val (117,13) sowie vogelsanc (118,15) lassen ein eher paradiesisches Bild entstehen, das wiederum erst durch das Eindringen der Kultur in Form von Herzeloyde und ihrem Gefolge gestört wird. Der andere Punkt ist der der Abgeschlossenheit des Raumes von der Außenwelt. Sieht es zunächst so aus als existiere dieser Ort fern von Zeit und Raum, so wird dieser Eindruck durch das Erscheinen der Ritter durchbrochen und eine Nähe zum angrenzenden Wald Brizljâns verstärkt dies zusätzlich.
Es wird demnach deutlich, dass Soltâne ein Ort voller Widersprüche und Unvereinbarkeiten ist. Der waste als gefährliche Wildnis stellt sich ein paradiesisch-idyllisches Erscheinungsbild gegenüber, das Einsiedlertum Herzeloydes ist ein eigentlicher Rückzug zum Schutze ihres kleinen Hofstaates, der zwar scheinbar keine höfische Erziehung beinhaltet aber wichtige Grundstrukturen wie die Rangordnung beibehält, die armuot wird umfunktionalisiert und innerhalb der ungeordneten, unkultivierten Natur baut sich Herzeloyde eine eigene in gewisser Weise kultivierte, geordnete und strukturierte Kultur auf, die ihrerseits auf der Basis der Verheimlichung Parzivals Identität gründet. Soltâne zeichnet sich demnach durch eine Ambivalenz zu sich selbst als waste aus und zum anderen besteht eine Ambivalenz zwischen der Erscheinung Soltânes als paradiesische Idylle mit blumenreichen Wiesen und Vogelgesang und dem Handeln der Personen in ihr, das aus Lüge, Anmaßung, Intrige und Verheimlichung besteht.
3. Herzeloydes Rückzug nach Soltane
Im vorliegenden Kapitel soll die Ambivalenz des Rückzugs Herzeloydes nach Soltâne herausgearbeitet werden. Kontrastierend stehen sich hier die Aussagen des Erzählers zu Beginn des dritten Buches sowie im Textverlauf darauf folgende Aussagen gegenüber. Ältere Forschungsliteratur geht dabei eher mit der Erzählermeinung einher und stellt besonders die triuwe Herzeloydes und ihre Nähe zur Gottesmutter heraus5, während die neuere Forschungsmeinung verstärkt ihr zwiespältiges Wesen, das sich aus den Textaussagen ableitet, hervorhebt.6
3.1 Aussagen des Erzählers zu Beginn des dritten Buches
Mit einem Exkurs über das Wesen der wîpheit (116,13) leitet der Erzähler seine Charakterisierung Herzeloydes ein. Hierbei unterscheidet er zwischen zwei Arten von Frauen, wobei für ihn nur die den Namen wîp tragen sollten, die sich durch den Wesenszug der triuwe auszeichnen und um ihretwillen auch armuot ertragen (116,15-18). Herzeloyde ist dabei für ihn ein Vorbild an triuwe, da sie aus Treue zu ihrem Sohn und Gatten ihre drei Länder zurücklässt und zum Schutze des Kindes die Einsamkeit materiellen Besitztümern vorzieht und auf sich nimmt, was sie später vor dem Höllenfeuer bewahren soll. Dadurch dass sie der freuden mangels last (116,30) auf sich nimmt, ist auch kein valsch (117,1) an ihr zu finden. Sie ist für den Erzähler makellos und vorbildlich in ihrem umsichtigen und klugen Verhalten. Ihren Rückzug sieht der Erzähler nicht als egoistische Tat, um Parzival von etwas abzuhalten, vielmehr ist dieser aus Trauer um Gahmuret geschehen (117,6) und aus Angst vor den Feinden ihrer einstigen Länder und einem damit einhergehenden möglichen Verlust Parzivals. Der Ammendienst (113,5-12), den sie dabei selbst übernimmt, zeigt ihr bedingungsloses Aufzehren für Parzival als ihren einzigen Sohn, sodass
diese mariologischen Muster die triuwe zudem betonen. Und eben diese Aufopferung ohne an ihre Bedürfnisse zu denken, bescheren ihr laut Erzähler das ewige Seelenheil. Durch diese Darstellung in Nähe zu Maria lässter er zunächst keine negative Beurteilung der Herzeloydefigur zu und auch später stellt er noch einmal ihre besondere Rolle als Mutter heraus (128,25).7 Indem der Erzähler bescheinigt der valsch sô gar an ir verswant (117,1)8, wird seine positive Beurteilung der Herzeloyde deutlich, sie zeichnet sich durch keinerlei Fehler aus.
[...]
1 Auch Gregorius und Tristan werden fern ihrer höfischen Gesellschaft erzogen, dennoch genießen sie eine Erziehung im Sinne dieser.
2 vgl. Yeandle, David N.: Commentary on the Soltane and Jeschute Episodes in Book III of Wolfram von Eschenbach’s PARZIVAL (116,5-138,8). Heidelberg 1985, S. 33-34.
3 vgl. Schröder, Walter Johannes: Die Soltane-Erzählung in Wolframs Parzival. Studien zur
Darstellung und Bedeutung der Lebensstufen Parzivals. Heidelberg 1963, S. 55.
4 vgl. Yeandle, S. 13-16.
5 vgl. Roßkopf, Rudolf: Der Traum Herzeloydes und der Rote Ritter. Erwägungen über die Bedeutung des staufisch-welfischen Thronstreites für Wolframs „Parzival“. Göppingen 1972, S. 132-136 und vgl. Schröder, Walter Johannes: Die Soltane-Erzählung in Wolframs Parzival. Studien zur
Darstellung und Bedeutung der Lebensstufen Parzivals. Heidelberg 1963, S. 60-61.
6 vgl. Greenfield, John: Wolframs zweifache Witwe. Zur Rolle der Herzeloyde-Figur im Parzival, S.172. und vgl. Heckel, Susanne: „die wîbes missewende vlôch“ (113,12) Rezeption und Interpretation der Herzeloyde, S. 46. und vgl. Parra Membrives, Eva: Alternative Frauenfiguren in Wolframs
>Parzival<: Zur Bestimmung des Höfischen anhand differenzierter Verhaltensmuster, S. 50-51.
Häufig gestellte Fragen
Was symbolisiert der Ort Soltâne in Wolframs „Parzival“?
Soltâne ist ein ambivalenter Raum. Einerseits wird er als Wildnis (waste) beschrieben, andererseits als paradiesische Idylle (locus amoenus). Er dient Herzeloyde als Rückzugsort, um Parzival fernab der ritterlichen Welt aufzuziehen.
Warum zieht sich Herzeloyde nach Soltâne zurück?
Laut Erzähler geschieht dies aus Treue (triuwe) und Trauer um Gahmuret, um ihren Sohn vor dem Tod im Rittertum zu bewahren. Die neuere Forschung sieht darin jedoch auch eine egoistische Komponente und eine Form der Identitätsverweigerung gegenüber Parzival.
Welche Bedeutung hat die Vogelepisode für Parzival?
In der Vogelepisode zeigt sich Parzivals kindliche Unschuld, aber auch seine instinktive Reaktion auf Schönheit und Schmerz. Als er die singenden Vögel tötet und später darüber weint, wird seine emotionale Ambivalenz und seine Naturverbundenheit deutlich.
Wie sind die Lehren Herzeloydes zu bewerten?
Die Lehren sind höchst ambivalent. Herzeloyde gibt Parzival oberflächliche Verhaltensregeln mit, die ihn in der höfischen Welt eher lächerlich machen oder zu Missverständnissen führen, da sie ihm den tieferen Sinn ritterlicher Tugenden vorenthält.
Was löst Parzivals Aufbruch aus Soltâne aus?
Die zufällige Begegnung mit vier Rittern im Wald ist das Initialereignis. Parzival hält sie aufgrund ihrer glänzenden Rüstungen für Götter und beschließt, selbst Ritter zu werden, was das Ende seiner Isolation in Soltâne markiert.
Inwiefern ist Parzivals Kindheit eine „Nicht-Welt“?
Soltâne wird als Raum außerhalb der gesellschaftlichen Ordnung (Rittertum, Hof) dargestellt. Parzival wächst ohne Wissen über seine Herkunft, seinen Namen und seinen sozialen Status auf, was seine Kindheit zu einer Phase der Identitätslosigkeit macht.
- Citation du texte
- Kathleen Grünert (Auteur), 2008, der valsch sô gar an ir verswant (117,1), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125781