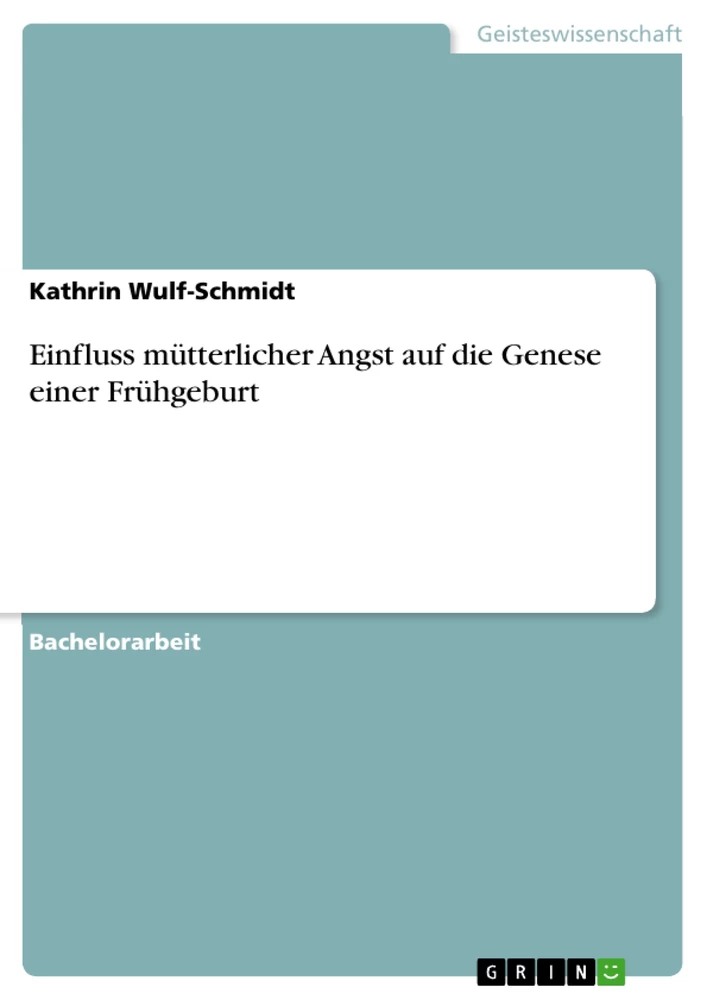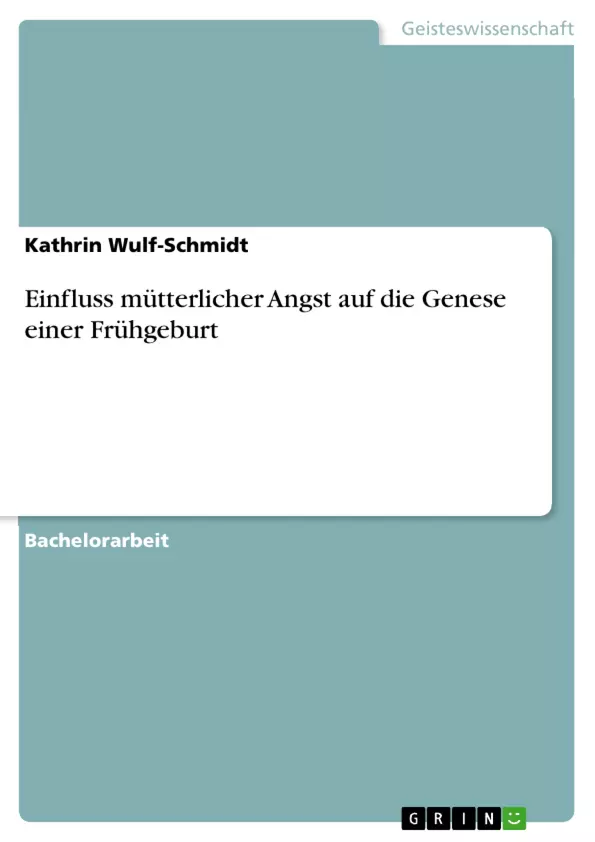Der erste Teil dieser Arbeit beschäftigt sich zum einen mit einer genauen Betrachtung sowie Definition der Begriffe Angst und Frühgeburt. Dieser theoretische Teil liefert zum anderen einen Einblick in das Thema Angst als Emotion und der einhergehenden Mehrdimensionalität des Konstruktes. Darauffolgend werden allgemeine Grundlagen der Angstdiagnostik dargestellt. Neben einer Beschreibung verschiedener Methoden und standardisierter Verfahren, wird zentral auf die Herausforderungen im Diagnoseprozess eingegangen. Bei der Definition und Begriffsbestimmung des Themas Frühgeburt im zweiten Abschnitt des theoretischen Teils, geht es in Ergänzung zur grundsätzlichen Bestimmung einer Frühgeburt um die Unterscheidung zwischen einer Frühgeburt, einer frühen Frühgeburt und einer extrem frühen Frühgeburt. Danach folgt ein Kapitel zu den epidemiologischen Daten und dem Stand der bisherigen ätiologischen Betrachtungsweise einer Frühgeburt. Der letzte Abschnitt des theoretischen Teils beschäftigt sich mit den Indikatoren, die auf eine Frühgeburt hinweisen. Ergänzend werden die einhergehenden somatischen und psychologischen Folgen einer Frühgeburt beleuchtet.
Welche weiteren Variablen beziehungsweise, welche Variablen in Gänze in dieser Arbeit herangezogen werden, ist der thematische Schwerpunkt des ersten Abschnitts des empirischen Teils. Hier erfolgt zunächst ein Kapitel mit der Herleitung der Hypothesen, der expliziten Benennung der Hypothesen und einer Einordnung im Rahmen des bisherigen Forschungsstandes. Im darauffolgenden Kapitel wird die Methode zur Untersuchung der benannten Hypothesen beschrieben. Unterschieden wird eine explizite Darstellung der Erhebungs- und der Auswertungsmethode dieser Studie. Als Erhebungsmethode wird eine Online-Befragung eingesetzt. Die Darstellung der Ergebnisse dieser Umfrage ist ein weiterer zentraler Aspekt des empirischen Teils. Dabei werden die erfassten demografischen Daten zur Stichprobe dargestellt und ausgewertet sowie die Ergebnisse zu den Variablen deskriptiv analysiert. Des Weiteren wird eine inferenzstatistische Überprüfung zu den Hypothesen erfolgen. Zum Abschluss erfolgt eine Diskussion zur vorläufigen Annahme oder Zurückweisung der Hypothesen. Auch werden verschiedene Einflüsse auf die Objektivität, Reliabilität und Validität diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Teil
- 2.1 Angst
- 2.1.1 Die Emotion Angst - ein mehrdimensionales Konstrukt
- 2.1.2 Grundlagen der Angstdiagnostik
- 2.2 Frühgeburt
- 2.2.1 Epidemiologie und Ätiologie
- 2.2.2 Indikatoren einer drohenden Frühgeburt
- 2.2.3 Somatische und psychologische Folgen
- 3. Empirischer Teil
- 3.1 Hypothesen und Forschungsstand
- 3.1.1 Herleitung der Hypothesen
- 3.1.2 Forschungsstand
- 3.2 Methode
- 3.2.1 Erhebungsmethode
- 3.2.1.1 State-Trait Angstinventar (STAI)
- 3.2.1.2 Pregnancy Related Anxiety Questionnaire-Revised (PRAQ-R)
- 3.2.1.3 Fragebogenaufbau
- 3.2.2 Auswertungsmethode
- 3.3 Ergebnisse
- 3.3.1 Demografische Daten der Stichprobe
- 3.3.2 Deskriptive Auswertung mit Variablen- und Hypothesenbezug
- 3.3.3 Inferenzstatistische Analyse der Hypothesen
- 4. Diskussion und Fazit
- 4.1 Überprüfung der Hypothesen
- 4.2 Mögliche Einflüsse auf die Gütekriterien
- 4.3 Fazit und Verweis auf weitere Untersuchungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelor-Thesis untersucht den Einfluss mütterlicher Angst auf die Genese einer Frühgeburt. Ziel ist es, den Zusammenhang zwischen mütterlicher Angst und dem Risiko einer Frühgeburt zu beleuchten und die zugrundeliegenden Mechanismen zu erforschen.
- Die Emotion Angst als mehrdimensionales Konstrukt und ihre Bedeutung in der Schwangerschaft.
- Epidemiologie und Ätiologie von Frühgeburten.
- Mögliche Faktoren, die zu mütterlicher Angst in der Schwangerschaft beitragen.
- Die Auswirkungen mütterlicher Angst auf den Verlauf der Schwangerschaft und die Entwicklung des Fetus.
- Entwicklung von Hypothesen und deren empirische Überprüfung.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Bachelor-Thesis ein und erläutert die Relevanz der Forschungsfrage. Der theoretische Teil beleuchtet die Emotion Angst und ihre Bedeutung in der Schwangerschaft. Dabei werden verschiedene Konzepte und Modelle der Angst erläutert sowie die Grundlagen der Angstdiagnostik dargestellt. Anschließend wird das Thema Frühgeburt eingehend behandelt, wobei insbesondere auf die Epidemiologie, Ätiologie und die Indikatoren einer drohenden Frühgeburt eingegangen wird. Der empirische Teil der Arbeit präsentiert die Methodik, die zur Untersuchung der Forschungsfrage eingesetzt wurde. Hier werden die Hypothesen und der Forschungsstand dargestellt sowie die Erhebungsmethode und die Auswertungsmethode erläutert. Die Ergebnisse der Untersuchung werden im Anschluss vorgestellt und hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Forschungsfrage diskutiert. Abschließend wird im Fazit der Zusammenhang zwischen mütterlicher Angst und der Genese einer Frühgeburt zusammengefasst, die Ergebnisse kritisch reflektiert und der Bedarf an weiterer Forschung hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen mütterliche Angst, Frühgeburt, Schwangerschaft, Angstdiagnostik, Epidemiologie, Ätiologie, Hypothesen, Forschungsstand, Methode, Ergebnisse, Diskussion, Fazit.
Wie beeinflusst mütterliche Angst das Risiko einer Frühgeburt?
Die Studie erforscht den Zusammenhang zwischen psychischer Belastung (Angst) und den physiologischen Mechanismen, die eine vorzeitige Geburt auslösen können.
Was ist der Pregnancy Related Anxiety Questionnaire (PRAQ-R)?
Dies ist ein standardisiertes Testverfahren, das speziell Ängste misst, die direkt mit der Schwangerschaft und der Gesundheit des Kindes verbunden sind.
Welche Arten von Frühgeburten werden unterschieden?
Es wird zwischen der normalen Frühgeburt, der frühen Frühgeburt und der extrem frühen Frühgeburt differenziert.
Was sind die somatischen Folgen einer Frühgeburt?
Dazu gehören körperliche Entwicklungsverzögerungen oder gesundheitliche Komplikationen beim Neugeborenen aufgrund der Unreife der Organe.
Welche Rolle spielt das State-Trait Angstinventar (STAI)?
Das STAI unterscheidet zwischen situationsbedingter Angst (State) und der generellen Ängstlichkeit als Persönlichkeitsmerkmal (Trait) der Mutter.
- Quote paper
- Kathrin Wulf-Schmidt (Author), 2022, Einfluss mütterlicher Angst auf die Genese einer Frühgeburt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1257883