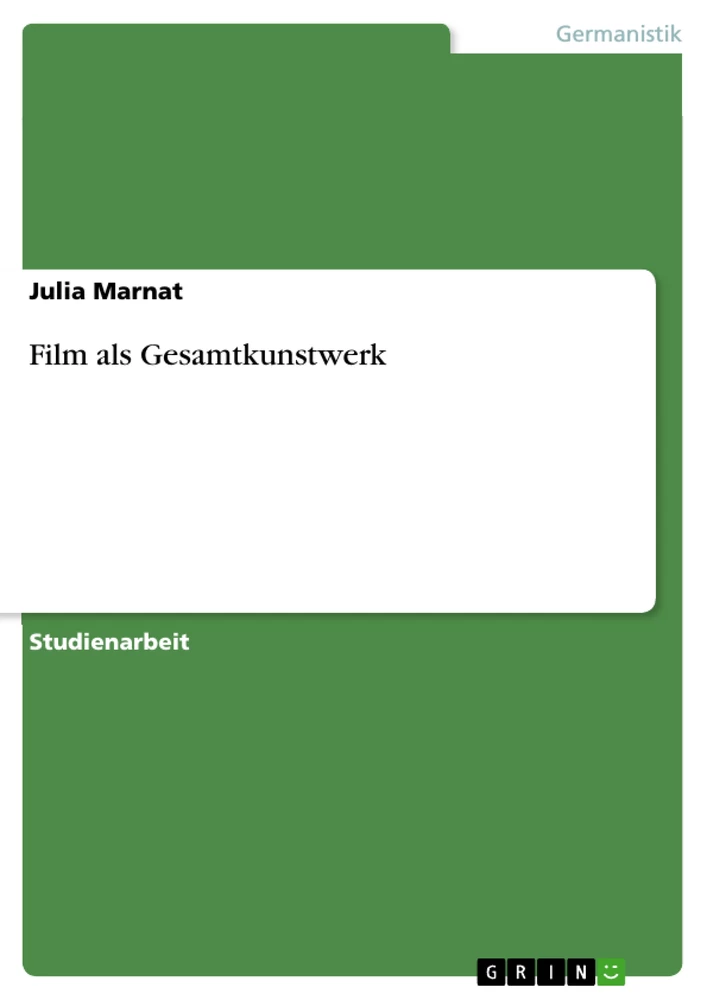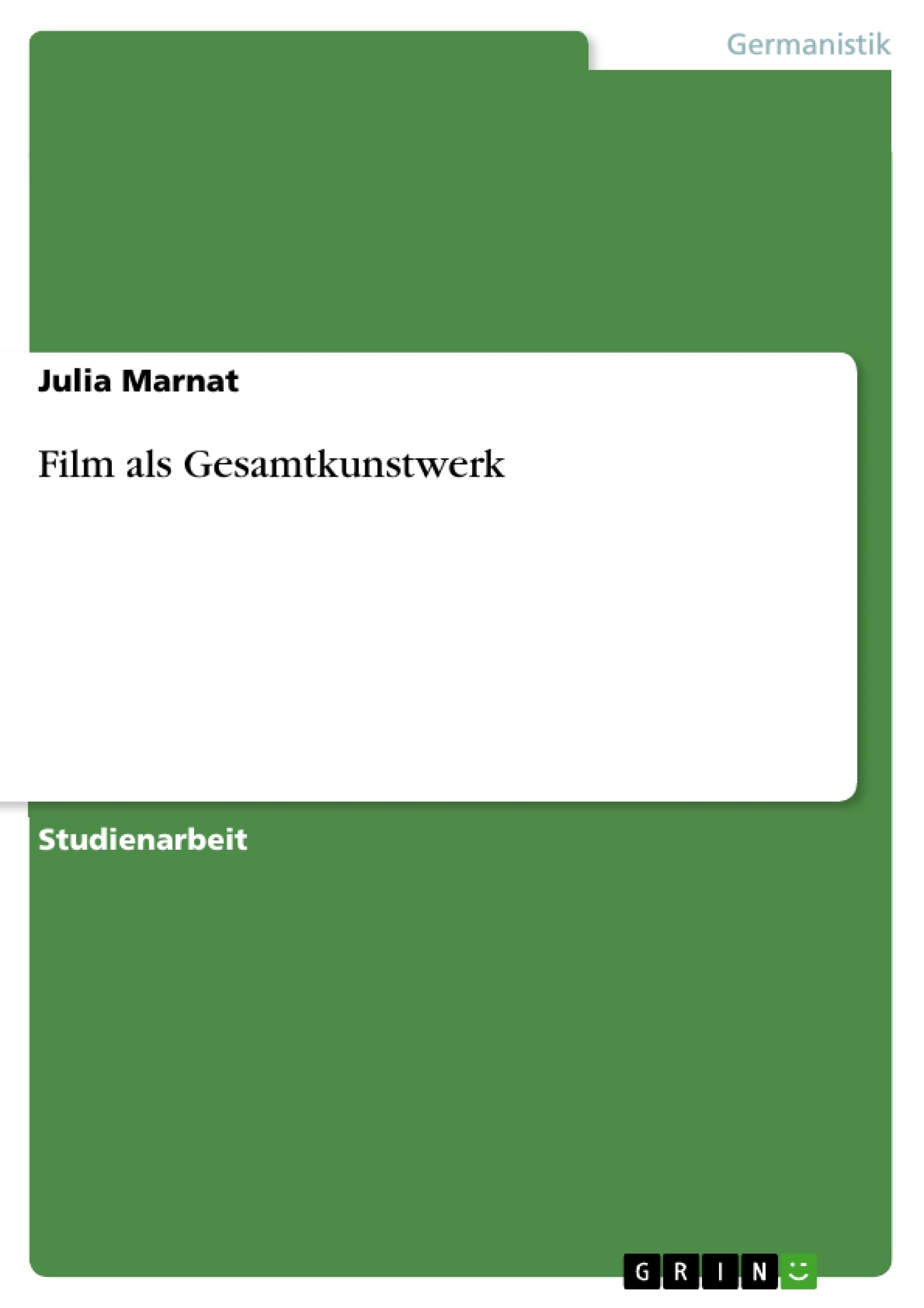Kaum ein Begriff ist so widersprüchlich und hat so viele Ausprägungen wie das Gesamtkunstwerk. In der wissenschaftlichen Literatur findet man viele Bezeichnungen für eine und dieselbe Idee: vom Gesamtkunstwerk über das Total-Theater, Überdrama, die Synästhesie, Klangmalerei und Sprachmusik bis hin zu Mixed Media oder Multimedia in der englischsprachigen Literatur.
Es ist nicht eindeutig, was man meint, wenn man von einem Gesamtkunstwerk spricht. „Die Sache, um die es dabei geht, ist älter als der Name. Leider ist nicht ganz klar, um welche Sache es geht“, schrieb Bazon Brock in seinem Aufsatz in dem Ausstellungsband „Der Hang zum Gesamtkunstwerk“ (1983). Deswegen hat dieses Konzept möglicherweise so viele Ausprägungen gefunden. Jeder der sich mit der Idee beschäftigten Wissenschaftler versuchte ein „eigenes“ Gesamtkunstwerk zu schaffen oder es auf eigene Art und Weise zu erklären, je nachdem, in welcher Kunst er „tätig“ war: Für Wagner war es die Oper, für Runge die Malerei und für Schlegel die „Universalpoesie“. Viele Wissenschaften setzen sich mit dem Begriff des Gesamtkunstwerks auseinander. Was ist ein Gesamtkunstwerk? Warum gibt es unterschiedliche Namen für scheinbar eine und dieselbe Idee (Vorstellung)? Warum kann es unterschiedliche Ausprägungen haben? Die vorliegende Hausarbeit versucht die geschichtliche Entwicklung des Begriffs von der Frühromantik bis zu der modernen Zeit zu verfolgen und zu systematisieren. Außerdem beschäftigt sich ein Kapitel mit dem Film als mögliche Realisierung des Konzepts Gesamtkunstwerk.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Begriffsproblematik
2 Anfänge des Gesamtkunstwerks
3 Gesamtkunstwerk nach Wagner
4 Film als Gesamtkunstwerk
4.1 Film als Kunst
4.2 Film als Gesamtkunstwerk
5 Shining als Gesamtkunstwerk
Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
Einleitung
Kaum ein Begriff ist so widersprüchlich und hat so viele Ausprägungen wie das Gesamtkunstwerk. In der wissenschaftlichen Literatur findet man viele Bezeichnungen für eine und dieselbe Idee: vom Gesamtkunstwerk über das Total-Theater, Überdrama, die Synästhesie, Klangmalerei und Sprachmusik bis hin zu Mixed Media oder Multimedia in der englischsprachigen Literatur.
Es ist nicht eindeutig, was man meint, wenn man von einem Gesamtkunstwerk spricht. „Die Sache, um die es dabei geht, ist älter als der Name. Leider ist nicht ganz klar, um welche Sache es geht“[1], schrieb Bazon Brock in seinem Aufsatz in dem Ausstellungsband „Der Hang zum Gesamtkunstwerk“ (1983). Deswegen hat dieses Konzept möglicherweise so viele Ausprägungen gefunden. Jeder der sich mit der Idee beschäftigten Wissenschaftler versuchte ein „eigenes“ Gesamtkunstwerk zu schaffen oder es auf eigene Art und Weise zu erklären, je nachdem, in welcher Kunst er „tätig“ war: Für Wagner war es die Oper, für Runge die Malerei und für Schlegel die „Universalpoesie“.
Viele Wissenschaften setzen sich mit dem Begriff des Gesamtkunstwerks auseinander. Was ist ein Gesamtkunstwerk? Warum gibt es unterschiedliche Namen für scheinbar eine und dieselbe Idee (Vorstellung)? Warum kann es unterschiedliche Ausprägungen haben? Die vorliegende Hausarbeit versucht die geschichtliche Entwicklung des Begriffs von der Frühromantik bis zu der modernen Zeit zu verfolgen und zu systematisieren. Außerdem beschäftigt sich ein Kapitel mit dem Film als mögliche Realisierung des Konzepts Gesamtkunstwerk.
1 Begriffsproblematik
Der Begriff Gesamtkunstwerk wird meistens mit Wagner und seinen Werken Die Kunst und die Revolution (1849) und Das Kunstwerk der Zukunft (1849) verbunden. Allerdings benutzte Wagner den Begriff schon vor seinen Züricher Schriften und war nicht der Erste, der von ihm Gebrauch machte.[2] Dieter Borchmeyer weist in Moderne Literatur in Grundbegriffen darauf hin, dass der früheste Beleg in Schriften des Philosophen der Spätromantik K. F. E. Trahndorff (1782- 1863) zu finden ist.[3] Trahndorff spricht von einem „Gesamt=Kunstwerken von Seiten aller Künste“, die nach Einheit des „innern Lebens“ streben.
Die Definitionen des Begriffs sind in musik-, literatur- und theaterwissenschaftlichen Enzyklopädien und Sachwörterbüchern zu finden. So definiert das Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft Gesamtkunstwerk folgendermaßen: „die Verbindung unterschiedlicher Kunstarten zu einem Werk-Modell wechselseitiger Durchdringung.“ Das Metzler Literatur Lexikon ist präziser und gibt nicht nur die Definition des Begriffs, sondern verfolgt direkt die Weiterentwicklung der Idee:
„Vereinigung von Dichtung, Musik, Tanz zu einem einheitlichen Kunstwerk […]. Während aber bei Wagner, entgegen seinem Programm, das Gesamtkunstwerk unter der Herrschaft der Musik steht, dominierten in verwandten Bestrebungen bei M. Reinhardt und L: Dumont die Dichtung im ‚Bauhaus’ die Architektur. Ohne den Anspruch auf Integration gleichwertiger Künste wurde in den 20er Jahren das Gesamtkunstwerk als ‚Überdrama’ von I. Goll postuliert, als Agitator.“
The new Grove Dictionary of Opera geht in seiner Definition einen Schritt weiter und bezieht die sozialpolitischen Elemente eines Gesamtkunstwerks mit ein: “The artist of the future was thus the Volk, and the Gesamtkunstwerk the product of necessity or historical inevitability.“
Odo Marquard war ebenso damit einverstanden, dass es nicht leicht fällt, ein Gesamtkunstwerk zu definieren. Er nennt allerdings die möglichen Kriterien, die einem dabei helfen könnten. Marquard unterscheidet zwischen qualitativen und quantitativen Kriterien. So ist „die multimediale Verbindung aller Künste in einem einzigen Kunstwerk […]“[4] ein quantitativer Aspekt. Zu dem qualitativen Aspekt gehört die Verwischung der Grenze zwischen dem Kunstwerk und der Realität .
2 Anfänge des Gesamtkunstwerks
In Die Sehnsucht nach dem Gesamtkunstwerk. Studien zu einer ästhetischen Konzeption der Moderne betont R. Fornhoff noch einmal, dass es schon zahlreiche Versuche gegeben hat, den Begriff Gesamtkunstwerk zu definieren. Allerdings waren diese alle nicht besonders erfolgreich. Fornoff macht einen Vorschlag, die möglichen Ausprägungen/Entwürfe des Gesamtkunstwerks in vier Kategorien zu unterteilen.[5] So gehört zu der ersten Gruppe „das konkrete inter- oder multimediale, also unterschiedliche Künste oder ästhetisch-mediale Elemente vereinende bzw. neu legierende Kunstwerk“. Als Beispiel dafür könnte man die Wagner’sche Oper nennen. Zur zweiten Gruppe lassen sich Theorien oder Vorstellungen „von der idealen Vereinigung der Künste“ zuordnen.
In Gruppe drei und vier gehören „eine geschlossene und fest gefügte Weltanschauung bzw. ein in unterschiedlicher Weise, etwa gesellschaftstheoretisch, geschichtsphilosophisch oder metaphysisch-religiös akzentuiertes Bild vom Ganzen“ und „eine in unterschiedlichem Maße konkretisierte ästhetisch-soziale oder ästhetisch-religiöse Utopie“.
Schon in der Romantik gab es zahlreiche Versuche, die Künste in einem Ganzen zu vereinen. In der Zeit herrschte die Vorstellung, dass alle Künste in früherer Zeit eine Ur-Einheit gebildet haben, die im Laufe der Zeit zersplittert wurde.[6] So entwickelten sich viele Gedanken, Entwürfe und Theorien, die alle Künste zu vereinen versuchten.
Friedrich Schlegel sah in der „progressiven Universalpoesie“ die einzige Kunstform, die es ermöglichte, die verschiedenen Künste zusammenzuführen. So schreibt er im 116. Athenäum:
„Die romantische Poesie ist eine progressive Universalpoesie. Ihre Bestimmung ist nicht bloß, alle getrennte Gattungen der Poesie wieder zu vereinigen und die Poesie mit der Philosophie und Rhetorik in Berührung zu setzen. Sie will, und soll auch Poesie und Prosa, Genialität und Kritik, Kunstpoesie und Naturpoesie bald mischen, bald verschmelzen, die Poesie lebendig und gesellig, und das Leben und die Gesellschaft poetisch machen, den Witz poetisieren, und die Formen der Kunst mit gediegnem Bildungsstoff jeder Art anfüllen und sättigen, und durch die Schwingungen des Humors beseelen.“[7]
Der wichtige Vertreter der deutschen Romantik Novalis sieht die Poesie ebenso als eine Kunstform, die Potenzial hat, alle Künste zu vereinen:
„Wie die Philosophie durch System und Staat, die Kräfte des Individuums mit den Kräften der Menschheit und des Weltalls verstärkt, das Ganze zum Organ des Individuums und das Individuum zum Organ des Ganzen macht – so die Poesie, in Ansehung des Lebens. Das Individuum lebt im Ganzen und des Ganzes im Individuum. Durch Poesie entsteht die höchste Sympathie und Koaktivität, die innigste Gemeinschaft de Endlichen und Unendlichen.“[8]
Zu den bedeutendsten deutschen Romantikern gehört der Maler Philipp Otto Runge. Das Werk Runges wird heute als prototypisch für die deutsche Romantik bezeichnet.[9] In erster Linie, weil er im Gegensatz zu Tieck, Schlegel und Novalis versucht hat, sein Werk „mit unbedingter Konsequenz“[10] zu verwirklichen. Dabei spielte die Musik bei Runge eine große Rolle. Als ideale Vereinigung der Künste sah Runge die musikalisch inspirierte Malerei.
[...]
[1] Brock (1983), S. 22.
[2] Finger (2006), S. 16.
[3] Borchmeyer (1994), S. 181.
[4] Marquard (1983), S. 40.
[5] Fornoff (2004), S. 20.
[6] Ebd., S. 26.
[7] Schlegel (1967), S. 182.
[8] Novalis S. 378.
[9] Linger (1983), S. 54.
[10] Ebd., S. 55.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Begriff Gesamtkunstwerk?
Ein Gesamtkunstwerk beschreibt die Verbindung unterschiedlicher Kunstarten zu einem einheitlichen Werkmodell, bei dem sich die verschiedenen Medien wechselseitig durchdringen.
Wer prägte den Begriff des Gesamtkunstwerks maßgeblich?
Obwohl der Begriff oft mit Richard Wagner verbunden wird, findet sich der früheste Beleg in den Schriften des spätromantischen Philosophen K. F. E. Trahndorff.
Welche Rolle spielte Richard Wagner für dieses Konzept?
Wagner sah in der Oper die ideale Form des Gesamtkunstwerks und beschrieb seine Vorstellungen in Schriften wie „Das Kunstwerk der Zukunft“.
Wie unterschieden sich die Ansätze von Wagner, Runge und Schlegel?
Für Wagner war es die Oper, für Philipp Otto Runge die Malerei und für Friedrich Schlegel die „Universalpoesie“.
Kann ein Film als Gesamtkunstwerk betrachtet werden?
Ja, die vorliegende Arbeit untersucht den Film als eine mögliche moderne Realisierung des Konzepts, da er Bild, Ton, Sprache und Schauspiel vereint.
- Citar trabajo
- Julia Marnat (Autor), 2009, Film als Gesamtkunstwerk, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125792