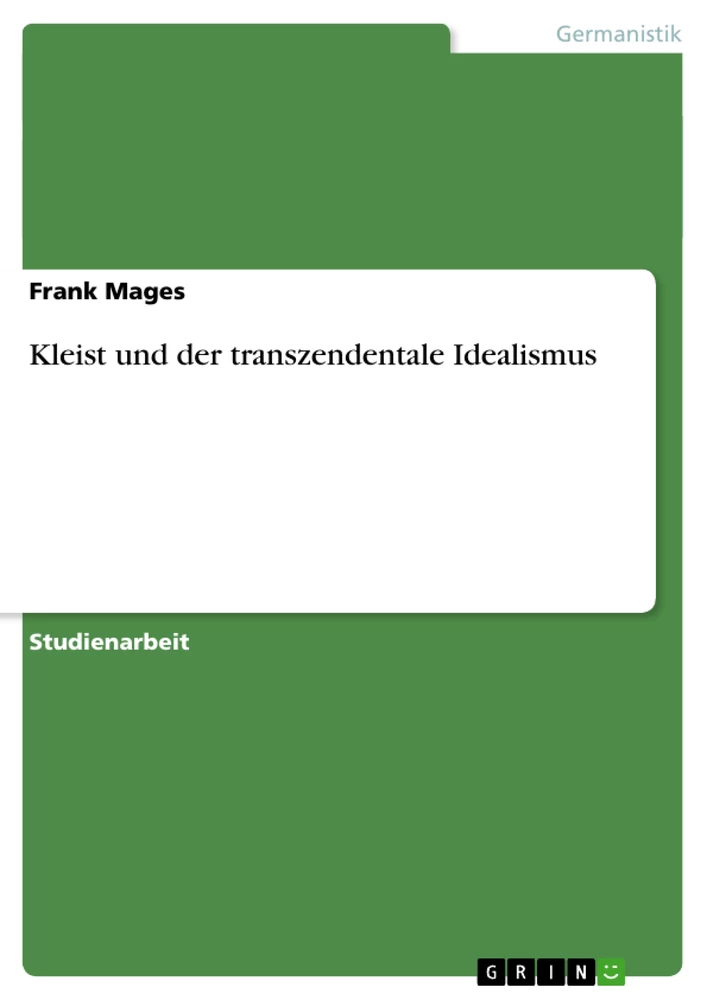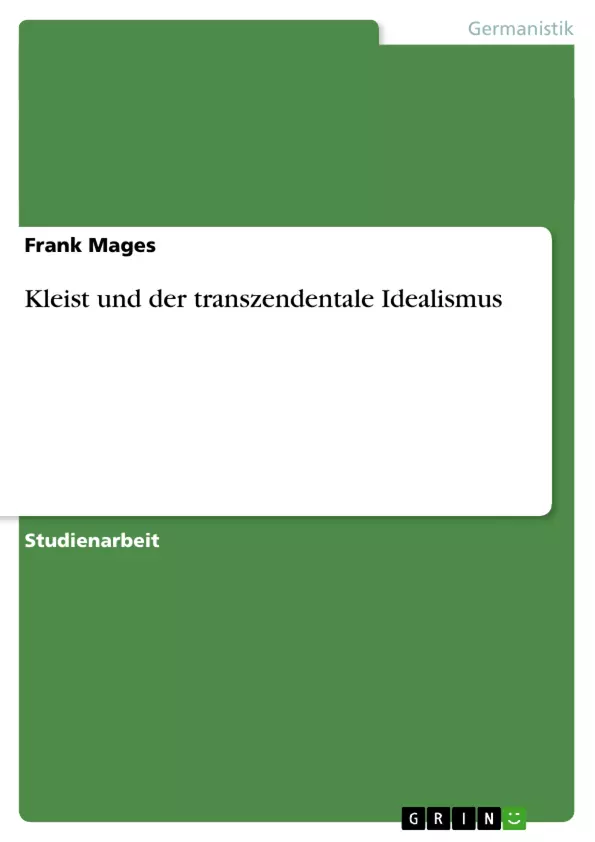Heinrich von Kleist schreibt am 23. März 1801 an seine Schwester Ulrike von Kleist einen Brief, in dem er ihr berichtet, dass die Begegnung mit der Kant’schen Philosophie sein Lebensziel zerstört habe. [...] Sorgt die kritische Philosophie Kants und die daraus erfolgende Begründung eines kritischen und transzendentalen Idealismus bei vielen Zeitgenossen zwar für radikales Umdenken, doch keiner – von Fichte bis zu Schopenhauer – wird durch sie auf solche Art und Weise in seiner eigenen Persönlichkeit und Lebensvorstellung erschüttert wie Heinrich von Kleist.3 Um die Reaktion Kleists auf die „neue“ Philosophie nachvollziehen zu können, sollen zuerst seine Überlegungen über das Glück und sein Lebensplan, aufgrund dessen er seinen Dienst im preußischen Militär kündigt, dargestellt werden. Im Anschluss an die Anschauungen des jungen Kleists werden die entscheidenden Momente des transzendentalen Idealismus aufzuweisen sein, um dann die für den Ausbruch der Krise ausschlaggebenden Differenzen zwischen eben diesen und Kleists bisheriger Überzeugung zu erarbeiten. Ihren Abschluss findet diese Arbeit in der Beobachtung der Spuren, die die „Kant-Krise“ im weiteren Leben und Werk Kleists hinterlassen hat.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Kleists Lebensplan, der transzendentale Idealismus und die „Kant-Krise“
2.1 Kleists Lebensplan
2.2 Der transzendentale Idealismus Kants und Fichtes
2.3 Die „Kant-Krise“ Heinrich von Kleists
3. Die Spuren der „Kant-Krise“ in Kleists Werk
4. Literaturverzeichnis
4.1 Textausgaben
4.2 Sekundärliteratur
1. Einleitung
Heinrich von Kleist schreibt am 23. März 1801 an seine Schwester Ulrike von Kleist einen Brief, in dem er ihr berichtet, dass die Begegnung mit der Kant’schen Philosophie sein Lebensziel zerstört habe.
„Es scheint, als ob ich eines der Opfer der Thorheit werden würde, deren die Kantische Philosophie so viel auf dem Gewissen hat. [...] Mein einzige[r]s u. höchstes Ziel ist gesunken, ich hab keines mehr.“1
Einen Tag zuvor, am 22. März, hatte Kleist bereits in einem Brief an seine damalige Verlobte Wilhelmine von Zenge seine verzweifelte Lage geschildert.
„Ja, allerdings dreht sich mein Wesen jetzt um einen Hauptgedanken, der [...] mein Innerstes ergriffen hat, er hat eine tiefe erschütternde Wirkung auf mich hervorgebracht – Ich weiß nur nicht, wie ich das, was seit 3 Wochen durch meine Seele flog, auf diesem Blatte zusammenpressen soll.“2
Sorgt die kritische Philosophie Kants und die daraus erfolgende Begründung eines kritischen und transzendentalen Idealismus bei vielen Zeitgenossen zwar für radikales Umdenken, doch keiner – von Fichte bis zu Schopenhauer – wird durch sie auf solche Art und Weise in seiner eigenen Persönlichkeit und Lebensvorstellung erschüttert wie Heinrich von Kleist.3
Um die Reaktion Kleists auf die „neue“ Philosophie nachvollziehen zu können, sollen zuerst seine Überlegungen über das Glück und sein Lebensplan, aufgrund dessen er seinen Dienst im preußischen Militär kündigt, dargestellt werden. Im Anschluss an die Anschauungen des jungen Kleists werden die entscheidenden Momente des transzendentalen Idealismus aufzuweisen sein, um dann die für den Ausbruch der Krise ausschlaggebenden Differenzen zwischen eben diesen und Kleists bisheriger Überzeugung zu erarbeiten. Ihren Abschluss findet diese Arbeit in der Beobachtung der Spuren, die die „Kant-Krise“ im weiteren Leben und Werk Kleists hinterlassen hat.
2. Kleists Lebensplan, der transzendentale Idealismus und die „Kant-Krise“
2.1 Kleists Lebensplan
Kleist wird 1777 in eine preußische Offiziersfamilie mit langer Tradition hineingeboren. Als er 1792 ebenfalls in den Militärdienst eintritt, scheint ihm ein ruhiges und gesichertes Leben zu erwarten.4 Sieben Jahre später entscheidet er sich jedoch, feststellend, dass er bisher immer für einen ihm unbekannten Zweck gearbeitet hat, das Militär zu verlassen. Seiner Verlobten berichtet Kleist in einem Brief von seiner Absicht, in Zukunft nur noch für sich zu leben und zu arbeiten.
„Ein eigener Zweck steht mir vor Augen, nach ihm würde ich handeln müssen, und wenn der Staat es anders will, dem Staate nicht gehorchen dürfen. Meinen Stolz würde ich darin suchen, die Aussprüche meiner Vernunft geltend zu machen gegen den Willen meiner Obern – [...].“5
Neben der Kritik am preußischen Staat und dem Austritt aus dem Militär, das zu dieser Zeit nichts geringeres als das Aushängeschild des preußischen Staates ist, als Protest gegen ein unmenschliches System6, spricht Kleist hier den Grundsatz seines Lebensplans an. Er will ein Leben nur für sich führen, keinem anderen Zweck unterworfen als dem eigenen.
In seinem nicht datierten Aufsatz „Aufsatz, den sichern Weg des Glücks zu finden und ungestöhrt – auch unter den größten Drangsalen des Lebens, ihn zu genießen!“ erkennt Kleist das Glück als das begehrenswerteste aller Dinge und das Glücklichsein als das höchste Ziel eines jeden an. Glücklichsein ist der Zweck, dem Kleist sich selbst unterordnet und nach dem er leben will. Den Weg zum Glück sieht er nicht in der Verbesserung der äußeren Umstände des Menschen. Besitz und gesellschaftlicher Status führen nach Kleist nur zu scheinbarem und nicht zu wahrem Glück, ja sie haben damit in keiner Weise etwas zu tun. Die Tugend ist es die den Menschen zum Glück führt. Kleist geht dabei sogar so weit, dass er allein die Tugend zur Bedingung des Glücks erhebt.7 So schreibt er sowohl in dem bereits zitierten Aufsatz als auch in einem Brief an seinen Lehrer Christian E]rnst Martini im März 1799:
„[…] die Tugend macht nur allein glücklich. […] die Tugend, und einzig allein, nur die Tugend ist die Mutter des Glücks, und der Beste ist der Glücklichste.“8
„So übe ich mich unaufhörlich darin, das wahre Glück von allen äußeren Umständen zu trennen und es nur als Belohnung und Ermunterung an die Tugend zu knüpfen.“9
[...]
1 Heinrich von Kleist: Sämtliche Werke. Brandenburger Ausgabe. Band IV/1 Briefe 1. Hrsg.: Roland Reuß, Peter Staengle. Basel, Frankfurt am Main, 1996. S. 512.
2 Ebd. S. 502f.
3 Vgl. Ernst Cassirer: Idee und Gestalt. Goethe Schiller, Hölderlin, Kleist. Darmstadt, 1994. S. 160.
4 Vgl. Paul, Böckmann: Heinrich von Kleist. 1777 – 1811. In: Walter Müller-Seidel: Heinrich von Kleist Aufsätze und Essays. Darmstadt, 1967. S. 296 – 316. S. 298f.
5 Heinrich von Kleist: Sämtliche Werke. IV/1. S. 364.
6 Vgl. Klaus Peter: Ikarus in Preußen. Heinrich von Kleists Traum von einer besseren Welt. Heidelberg, 2007. S. 4f.
7 Vgl. Heinrich von Kleist: Sämtlicher Werke. Brandenburger Ausgabe. Band II/9 Sonstige Prosa. Hrsg.: Roland Reuß, Peter Staengle. Basel, Frankfurt am Main, 2007. S. 11f.
8 Ebd. S. 13.
9 Heinrich von Kleist: Sämtliche Werke. IV/1. S. 13.
Häufig gestellte Fragen
Was war die "Kant-Krise" Heinrich von Kleists?
Die Kant-Krise war eine tiefe existenzielle Erschütterung Kleists im Jahr 1801, nachdem er sich mit Kants Philosophie (transzendentaler Idealismus) auseinandergesetzt hatte, die sein bisheriges Lebensziel zerstörte.
Warum zerstörte Kants Philosophie Kleists Lebensplan?
Kleist glaubte zuvor an die Erreichbarkeit von Wahrheit und Glück durch Tugend. Kants Erkenntnis, dass wir die Dinge nicht "an sich" erkennen können, nahm ihm die Gewissheit über den Zweck seines Strebens.
Wie sah Kleists ursprünglicher Lebensplan aus?
Er verließ das Militär, um nur noch für sich selbst und nach den Aussprüchen seiner Vernunft zu leben. Sein höchstes Ziel war das Glücklichsein durch unaufhörliche Übung in der Tugend.
Welche Rolle spielt der transzendentale Idealismus in diesem Kontext?
Der transzendentale Idealismus lehrt, dass unsere Erkenntnis durch unsere Sinne und unseren Verstand geformt wird, was Kleist so interpretierte, dass objektive Wahrheit für den Menschen unerreichbar bleibt.
Hinterließ die Krise Spuren in Kleists literarischem Werk?
Ja, die Themen der Unsicherheit, des Zweifels an der Wahrnehmung und der Zerbrechlichkeit der Welt ziehen sich nach der Krise durch sein gesamtes schriftstellerisches Schaffen.
- Quote paper
- Frank Mages (Author), 2008, Kleist und der transzendentale Idealismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125949