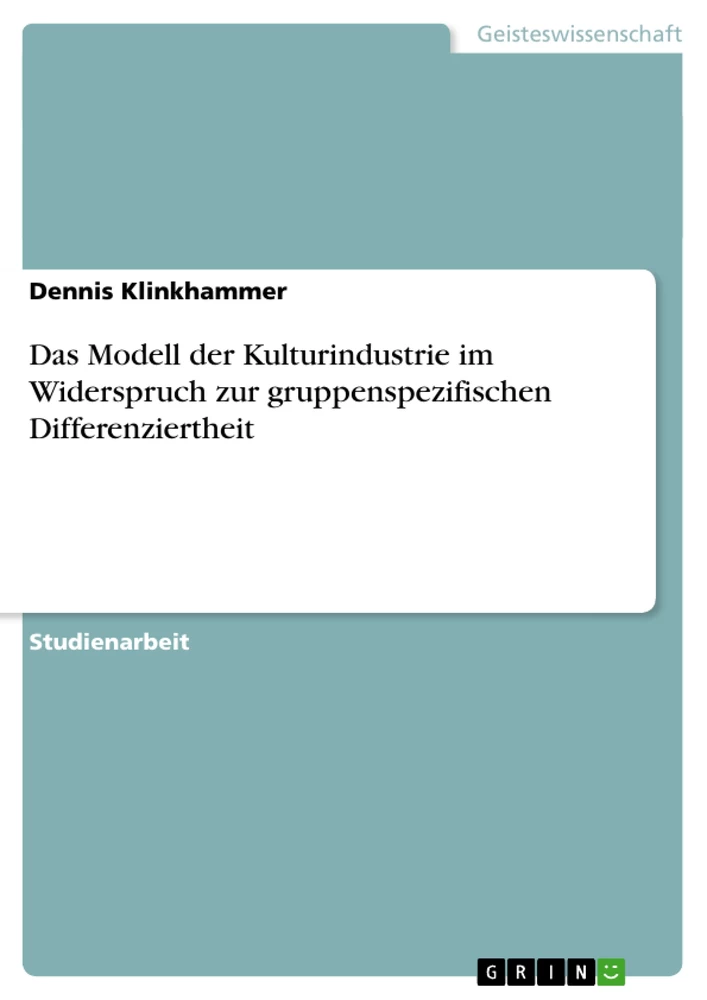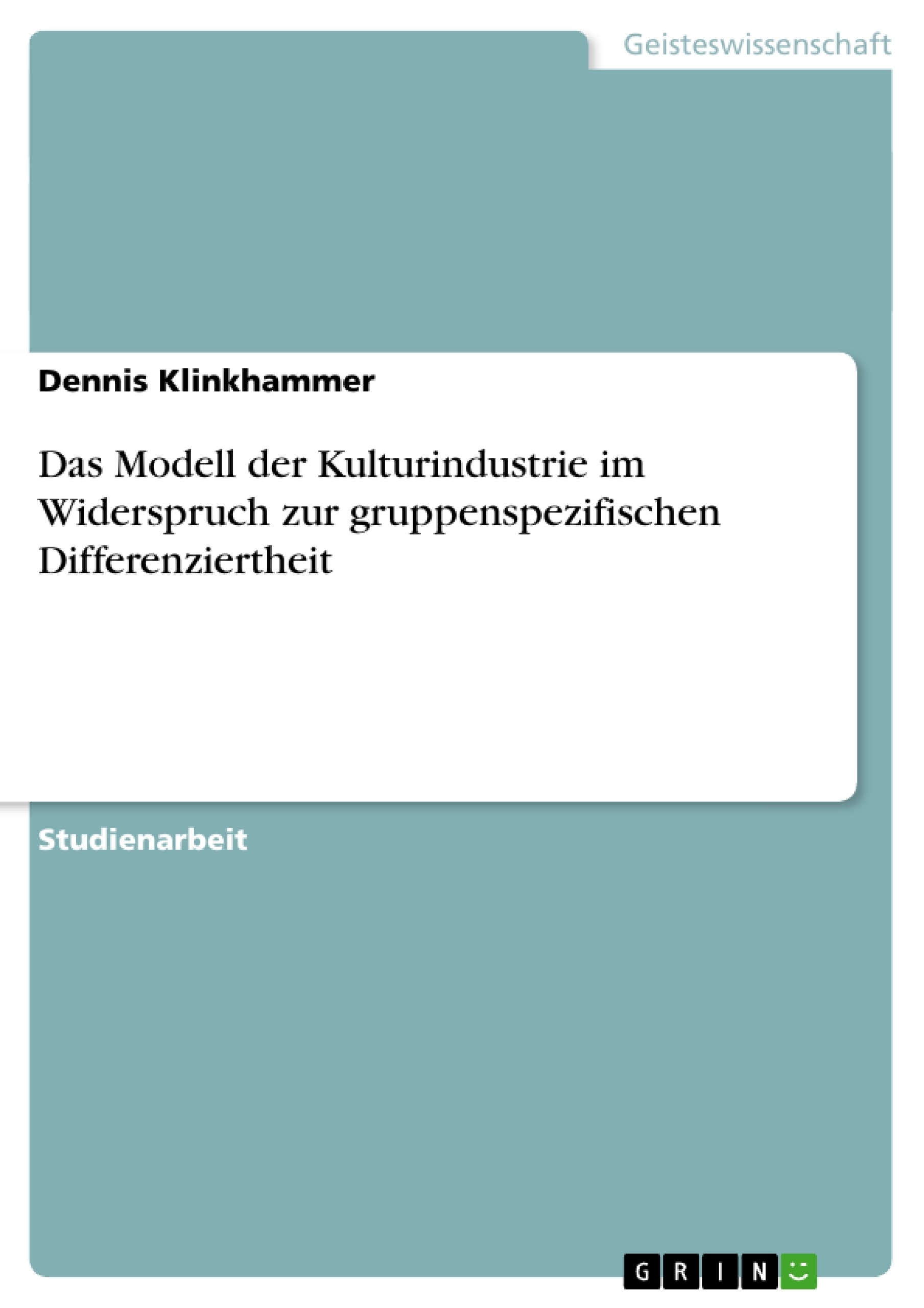Adorno und Horkheimer haben mit ihrer Schrift „Dialektik der Aufklärung“ einen Erklärungsansatz für die möglichen Einflüsse industriell erstellter Medien geliefert. Dabei skizzieren sie ein strukturiertes und in der Unterwerfung gegenüber den Medien entmündigtes Gesellschaftsbild, begleitet von einer Vielzahl kritischer Hypothesen über den von industriellen Medien geprägten Menschen.
Auszugsweise sollen diese kritischen Hypothesen vorgestellt und eingehender betrachtet werden, stehen sie doch auf den ersten Blick im Widerspruch zu den modernen soziologischen Annahmen zur Dynamik und Struktur von Gesellschaften.
Insbesondere der Charakter der neuen Medien und die menschliche Entscheidungsfreiheit werden hierbei als Kritik an Adorno und Horkheimer dargelegt.
INHALTSVERZEICHNIS
1) EINLEITUNG
2) KULTURINDUSTRIE UND MASSENKOMMUNIKATION
2.1 Die Geschichte der Massenmedien
2.2 Grundlagen: Kulturindustrie und Massenkommunikation
3) MEDIEN IN INDUSTRIEGESELLSCHAFTEN
3.1 Soziologische Betrachtungen
Teil I: Medien im Prozess der Machtbildung
Teil II: Medienwirkung und Medienwahrheit
3.2 Implikation der gruppenspezifischen Differenziertheit
4) MEDIENWIRKUNG IN DER SOZIALPSYCHOLOGIE
4.1 Medien im Fokus der Psychologie
4.2 Der Uses-and-Gratifications-Ansatz
5) KONTRÄRE ELEMENTE DER KULTURINDUSTRIE
5.1 Kontextuelle Dynamik der Medien
5.2 Strukturbedingter Kritikansatz
6) ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT
LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS
ERKLÄRUNG DES VERFASSERS
1) EINLEITUNG
Adorno und Horkheimer haben mit ihrer Schrift „Dialektik der Aufklarung" einen Erklärungsansatz für die möglichen Einflüsse industriell erstellter Medien geliefert. Ihr oft als Fundament der kritischen Theorie verstandener Beitrag im wissenschaftlichen Diskurs über den Einfluss der Medien hat einen souveränen Menschentypus im Fokus. Im Gegensatz dazu versuchen sie die „[...] Bedeutung von Massenkommunikation und Massenkultur für die Reproduktion des kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems [...]" (Kellner 1982: 482) zu belegen und dieser eine ordnende und kontrollierende Funktion derart zu unterstellen, dass ihre Ausprägungen in Form von „[...] Schematismus [...]" und einer „[...] riicksichtslosen Einheit [...]" (Adorno / Horkheimer 1969: 110f) sich in der Gesellschaft manifestieren. Somit skizzieren Adorno und Horkheimer ein strukturiertes und in der Unterwerfung gegenüber den Medien entmündigtes Gesellschaftsbild, begleitet von einer Vielzahl kritischer Hypothesen über den von industriellen Medien geprägten Menschen.
Auszugsweise sollen diese kritischen Hypothesen vorgestellt und eingehender betrachtet werden, scheinen sie doch auf den ersten Blick im Widerspruch zu den modernen soziologischen Annahmen zur Dynamik und Struktur von Gesellschaf-ten und somit, umgangssprachlich ausgedrückt: „schwach auf der Brust" (Enzensberger 1988: 146). Insbesondere deren zentraler Vergleich, „Donald Duck in den Cartoons wie die Unglücklichen in der Realität erhalten ihre Prügel, damit die Zuschauer sich an die eigenen gewöhnen " (Horkheimer / Adorno 1969: 124), unterminiert die Souveränität und Widerstandskraft der modernen Gesellschaften gegenüber den von Adorno und Horkheimer gepflegten Befürchtungen vor kom-munistischen und faschistischen Tendenzen in Form einer Diktatur.
Mittels Bezügen zur Medienwirkungsforschung und Sozialpsychologie soll unter-sucht werden, ob sich die „[J Kompetenz der Konsumenten [...] erhöht" (Feldmann 2005: 293) hat und mit dem Fortschreiten der Medienentwicklung nicht nur die Struktur der Gesellschaften gewandelt, sondern diese auch partiell, dank der Stärke ihrer Pluralität, eine kritische Haltung gegenüber ihre „[...] Herrn [...]" (Adorno / Horkheimer 1969: 111) eingenommen haben.
2) KULTURINDUSTRIE UND MASSENKOMMUNIKATION
Mit ihrer Theorie der Kulturindustrie beschreiben Adorno und Horkheimer einen „[...] ausgekliigelten Apparat zur Klassenherrschaft [...]" (Kellner 1982: 485). Damit diese Auffassung ihrer Arbeit überprüft werden kann, erfolgt in diesem Kapitel eine Darstellung der zentralen Aussagen des Textes „Dialektik der Aufklärung", gepaart mit einer Einordnung in den sozialhistorischen Kontext.
2.1 Die Geschichte der Massenmedien
Zwei zentrale Aspekte können als Beweggründe für die Arbeit Adornos und Horkheimers herausgestellt werden: Auf der einen Seite ist der Kontext der totalitären Regime in Europa und Asien des frühen zwanzigsten Jahrhunderts zu nennen. Sowohl der von Deutschland und Italien ausgehende Faschismus, als auch der Sozialismus in der Sowjetunion, bedienten sich technologischer Möglichkeiten, um eine breite Masse an Personen mit identischem Inhalt zu erreichen. In dieser Form sind „[..] Massenmedien [..] ein zentraler Macht - und Herrschaftsfaktor" (Feldmann 2005: 291; Vgl. Thompson 1995), da sie in beiden Diktaturformen mittels selektiver Informationsvermittlung einen den Systemen gerechten Informationsgehalt verbreiteten. Andererseits sind die ersten dreißig Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts von technologischen Erneuerungen geprägt. In den USA, als Exilstädte vor dem Faschismus Deutschlands (Vgl. Kellner 1982: 482), erleben Adorno und Horkheimer den raschen Fortschritt der technologischen Möglichkeiten und wie die Bevölkerung diese als „[...] popular culture [...]" (Kellner 1982: 482) scheinbar bedingungslos aufnimmt. Sie befürchten einen ähnlich stringenten Einfluss der Medien wie es in Europa der Fall gewesen sein könnte und beginnen daraufhin mit ihren Untersuchungen an dem Phänomen der Medien.
Ihr Empfinden, dass die Entwicklung der Medien in Richtung Massenmedien geht, lässt sich mit der Geschichte der Medientechnologien erklären. Bereits 1935 wurde in Deutschland das erste regelmäßige Fernsehprogramm der Welt ausgestrahlt, mit dem die Reichs-Rundfunk-Gesellschaft an fünf Tagen der Woche ein 90 Minütiges Programm aus Berlin mit insgesamt 180 Zeilen übertrug. Dieses Medium entsprach in etwa einer inhaltlich prägnanten und aufwandstechnisch überzogenen Zeitung. Die frühe Form der technologischen Informationsverbreitung setzte die Zusammenkunft mehrerer Individuen voraus, da die Technik für den Einzelnen zu kostspielig war. Nachrichten gab es in „Lichtspielhausern" und Fernsehstuben, d.h. ein Gerat mit derselben Botschaft an ein breites Publikum. Erst mit den Volksempfängern wurde in Deutschland die private Informationsrezeption möglich, aber auch hier erhielt jedes Individuum den gleichen Bestand an selektiven Informationen. „Die ganze Welt wird durch das Filter der Kulturindustrie geleitet" (Adorno / Horkheimer 1969: 113). Was in den Diktaturen ein Ergebnis aus Kongruenz und Kontrolle durch die staatliche Macht darstellte, fassten Adorno und Horkheimer in den USA als „[...] die Macht der ökonomisch Stärksten über die Gesellschaft [..]" (Adorno / Horkheimer 1969: 109) auf.
2.2 Grundlagen: Kulturindustrie und Massenkommunikation
Die Theorie der Kulturindustrie lässt sich in ihre verschiedenen Ursache- und Wirkungsformen untergliedern. Diese Gliederung in die Elemente „Wirtschaft", „Gesellschaft", „Autorität" und „Folgen" soll im Nachfolgenden abgehandelt werden, um ein Gesamtbild der Arbeit Adornos und Horkheimers zu skizzieren. Die erste Form ist die der Wirtschaft: Bereits der Begriff „Kulturindustrie" legt nahe, dass es sich um Industrie handelt. Industrie ist im weitesten Sinne eine „[..] aus dem Handwerk hervorgegangene Form des wirtschaftl. T l tigseins [...]" und den für die Medienentwicklung zuständigen Bereich nennt man allgemeinhin „[...] Elektroindustrie [...]" (Bertelsmann Lexikon Redaktion 1966: 819). Die wirtschaftliche Tätigkeit liegt hier insbesondere in und zwischen den Unternehmen vor, welche die technologisch basierten Medien und deren Vorführtechnik herstellen oder erwerben und verbreiten müssen. In dem Zusammenhang sprechen Adorno und Horkheimer von der „[..] Abhängigkeit der m l chtigsten Sendegesellschaften von der Elektroindustrie [...]" (Adorno / Horkheimer 1969: 110). Damit dieser über verschiedene Wirtschaftsstufen laufende Prozess der Produktion und des Vertriebs funktioniert, muss es auf politischer Ebene einen angemessenen Akzeptanzrahmen geben (Vgl. Adorno / Horkheimer 1969: 110). Eben durch diese industrielle Produktion, begleitet von dem Streben nach Profitmaximierung, geht es um die ständige Erschließung neuer Absatzmärkte und den Vertrieb der eigenen Produkte in weite Teile der Gesellschaft. Die große Masse des zu erreichenden und nach der Ware „Medien" verlangenden Publikums führte die Produktion zu schneller herstellbaren Standards. Ziel ist die Versorgung aller Gesellschaftbereiche, d.h. aller Menschen mit ihren unterschiedlichen Interessen und Kenntnissen. Dadurch, dass „ für alle [..] etwas vorgesehen [...]" (Adorno / Horkheimer 1969: 110) ist, erreichen die Medien ein breites Spektrum in der Gesellschaft, der nächsten Betrachtungsstufe in dieser Ausführung. Medien mit diesen akribisch geplanten Prozessen als Herstellungsbasis präsentieren sich der Gesellschaft als eine strukturierte „[...] Ordnung", jedoch ohne „Zusammenhang" (Adorno / Horkheimer 1969: 113). Das Mittel, mit dem die Medien ihre gestalterische Kraft entfalten, ist nach den Autoren der vergnügliche Charakter der Medienkultur. Vergnügen ist für Adorno und Horkheimer das Zwischenglied von einer Arbeitseinheit zur nächsten, sozusagen der regenerative Prozess zur Erhaltung der Arbeitsmoral (Vgl. Adorno / Horkheimer 1969: 123). Die Rezipienten sind nämlich nicht nur Kunden, sondern auch Wirkungselemente in der Gesellschaft. Dieser Zusammenhang aller Elemente einer Gesellschaft stabilisiert scheinbar das ganze System, indem eine ständige Identifikation der Rezipienten mit der ihnen übergeordneten Macht gefordert wird (Vgl. Adorno / Horkheimer 1969: 138). Durch eine „[...] eigene S prache [..] mit S yntax und Vokabular" (Adorno / Horkheimer 1969: 115) festigt sich somit der autoritäre Charakter der Kulturindustrie, welche ein der Realität entnommenes Abbild präsentiert, „damit sich die Zuschauer an die eigenen" Sorgen des Alltags „gewöhnen" (Adorno / Horkheimer 1969: 124). Die Folgen sind eine ständige Reproduktion desselben, um die Einheit aus Realität und Fiktion, Produktion und Konsum nicht zu gefährden. „ S wig [..] die gleichen Babies" (Adorno / Horkheimer 1969: 133) erzeugen eine Homogenität dieser Gesellschaft, die sich dadurch selber kennzeichnet, dass jedem seine Art des Konsums zugesprochen werden kann. Adorno und Horkheimer gehen davon aus, dass, wer die Abbilder der Medien nicht kennt und sich nicht an deren Schemen und Botschaften anpasst, die Konsequenzen dieser erkennbaren Dissonanz zu den Rezipienten zu tragen hat. Als Folge entspricht „d ie Stufenleiter der Lebensstandards [...]" somit „der inneren Verbundenheit der Schichten und Individuen mit dem S ystem" (Adorno / Horkheimer 1969: 135). Diese komplexe Konstellation und das Zusammenspiel aller beteiligten Elemente erwecken folglich für Adorno und Horkheimer den Eindruck einer fest verankerten „Erfolgsreligion" (Adorno / Horkheimer 1969: 131).
3) MEDIEN IN INDUSTRIEGESELLSCHAFTEN
Obwohl sich die meisten „[...] west - und mitteleuropäischen und nordamerikanischen Industriestaaten zu Dienstleistungsgesellschaften gewandelt [...]" (Feldmann 2005: 204) haben, sind beide Teile zunehmend durch technologische Produkte auf den Märkten gekennzeichnet. Eine Erklärung für diesen Wandel der Produktionsstruktur und der gleichzeitigen Zunahme der technisch hergestellten Produkte und deren Konsum ist durch den technischen Fortschritt begründet. Um die Frage zu beantworten, ob Medien einen, wie von Adorno und Horkheimer konstituiert, formenden Einfluss in Richtung einer homogenen Massengesellschaft haben, soll in diesem Kapitel eine soziologisch ausgerichtete Perspektive der Medienadaption für die modernen Gesellschaftsformen untersucht werden.
3.1 Soziologische Betrachtungen
Dieser Abschnitt befasst sich mit der makrosoziologischen Betrachtung der Medien, deren Zusammensetzung und Wirkungen auf die Gesellschaft. In Teil I werden zum einen die Macht- und Herrschaftstheorien von Heinrich Popitz dargelegt und deren Anwendbarkeit in Bezug auf die Schrift Adornos und Horkheimers, als auch die kritische Fortführung der Kulturindustrie von dem deutschen Soziologen Hans Markus Enzensberger. Primär soll gezeigt werden, ob die Medien und die dazugehörigen Elemente der Produktion und Vermarktung eine der Theorie des Machtbildungsprozesses angemessene Struktur aufzeigen und ob nicht unter Umständen andere Deutungen der Medienlandschaft möglich sind. In Teil II wird der Informationsgehalt der Medien erläutert werden, welcher von Winfried Schulz und Walter Lippmann separat eingehend untersucht worden ist. Ergänzt wird dieser Ansatz durch Michael Schenks Theorie der unterschiedlichen Medienwirkungswege.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was verstehen Adorno und Horkheimer unter „Kulturindustrie“?
Es beschreibt die industrielle Herstellung von Kultur als Ware, die der Kontrolle und Entmündigung der Massen dient, um das bestehende Gesellschaftssystem zu stabilisieren.
Warum wird die Kulturindustrie als Instrument der Klassenherrschaft gesehen?
Weil sie durch schematisierte Unterhaltung (z.B. Cartoons) die Zuschauer an ihre eigene Unterordnung gewöhnt und kritisches Denken durch passiven Konsum ersetzt.
Was ist der „Uses-and-Gratifications-Ansatz“?
Im Gegensatz zur Kulturindustrie-These geht dieser Ansatz davon aus, dass Rezipienten Medien aktiv und souverän nutzen, um ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.
Wie beeinflussten totalitäre Regime die Theorie der Kulturindustrie?
Adorno und Horkheimer sahen im Faschismus und Sozialismus, wie Massenmedien als Machtfaktor genutzt wurden, und befürchteten ähnliche Tendenzen durch die ökonomische Macht in den USA.
Hat sich die Kompetenz der Konsumenten heute erhöht?
Die Arbeit untersucht, ob die Pluralität moderner Gesellschaften und neue Medien eine kritischere Haltung ermöglichen, die dem entmündigten Bild der „Dialektik der Aufklärung“ widerspricht.
- Citation du texte
- Dennis Klinkhammer (Auteur), 2007, Das Modell der Kulturindustrie im Widerspruch zur gruppenspezifischen Differenziertheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126020