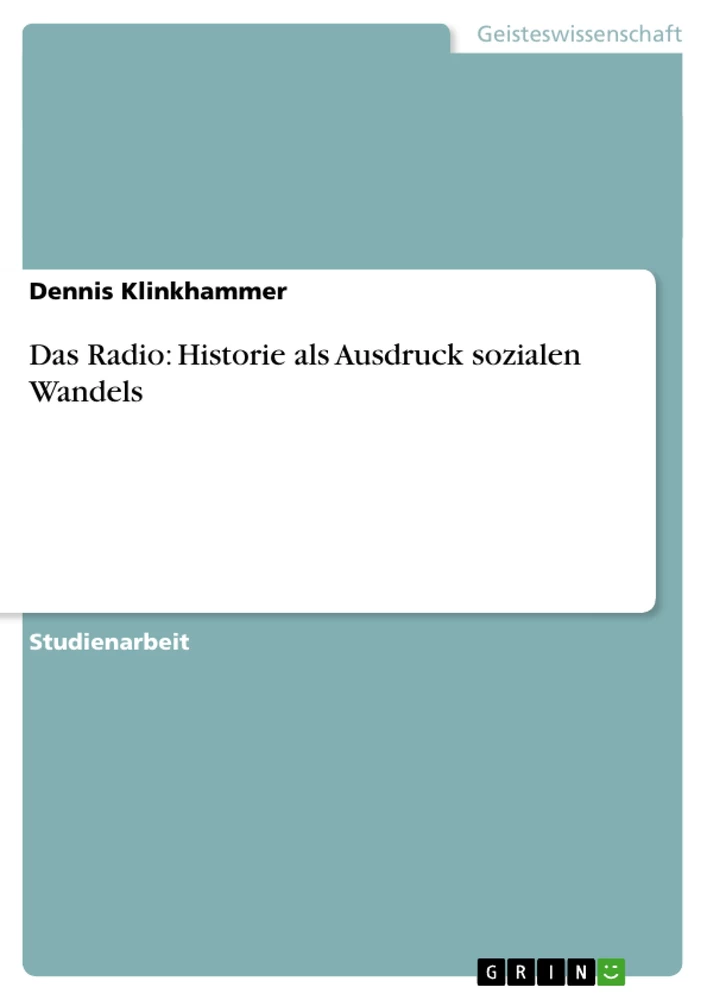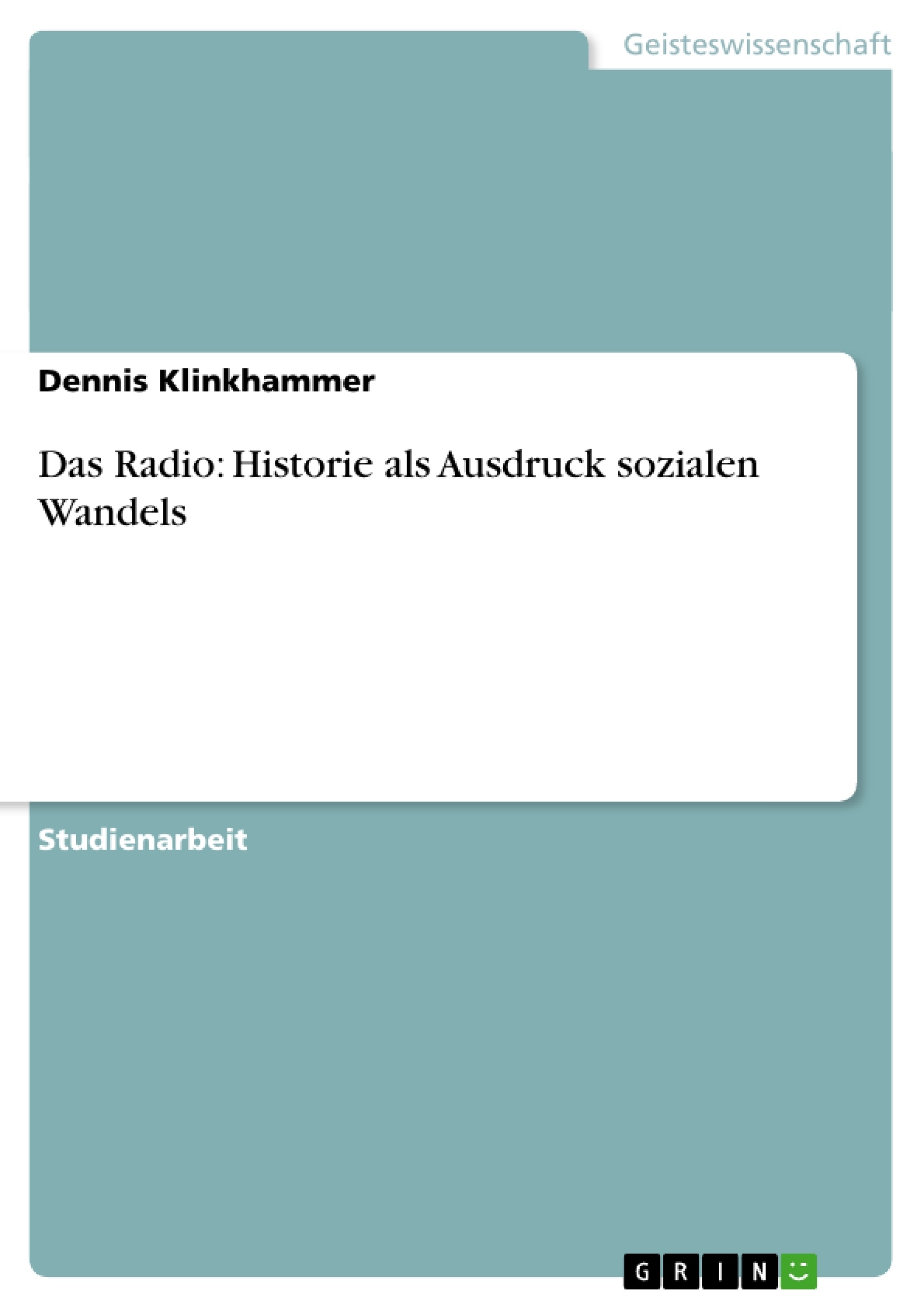Verschiedene Faktoren verleihen dem Radio seine Bedeutung für die Gesellschaft. Im Fokus dieser Arbeit stehen die Geschichte des Radios und dessen Einbettung in den deutschen Kulturkreis.
Für die Sozialwissenschaften stellt sich die Frage nach den Rezipienten, deren Differenzierbarkeit nach soziodemographischen Merkmalen und den unterschiedlichen Arten des Konsums, so dass sich an den Radionutzungsdaten der Prozess des sozialen Wandels ablesen lässt.
INHALTSVERZEICHNIS
1) EINLEITUNG
2) DAS RADIO: GESCHICHTE
2.1 Die Entwicklung der Radiotechnologie
2.2 Radioübertragungen in Deutschland
3) VERKNÜPFUNG VON RUNDFUNK UND GESELLSCHAFT
3.1 Die Bedeutung des Radios
3.2 Aspekte empirischer Sozialforschung
4) DAS ANALYSEVERFAHREN
4.1 Das statistische Verfahren
4.2 Die verwendeten Werte - eine formalistische Betrachtung
5) DATENANALYSE UND INTERPRETATION
5.1 Radionutzung im Tagesablauf
5.2 Radionutzung im Wochenverlauf
5.3 Die Verbreitung der Radiotechnologie im Zeitverlauf
5.4 Individuelles Hörerverhalten - im Fokus: Orte des Konsums
5.5 Reaktionen im Radiokonsum auf konkurrierende Medien
5.6 Begleitender Charakter als Stärke?
5.7 Sinus-Milieus und Medienzeitbudget
5.8 Radiokonsum und bildungsspezifische Merkmale
6) ZUSAMMENFASSUNG
LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS
1) EINLEITUNG
Ein alltäglicher Morgen: Bei vielen Bundesbürgern gibt ein Radiowecker den ersten Audioreiz des Tages, begleitet die Tagesvorbereitungen in der Küche oder dem Bad und im KFZ auf dem Weg zur Arbeit. Kaum ein Medium scheint so internalisiert zu sein wie das Radio und ist daher „[...] a us unserem Allt a g nicht mehr wegzudenken" (Franz et al. 1991: 400).
Verschiedene Faktoren verleihen dem Radio diese in der Gesellschaft manifestierte Bedeutung. Eine expandierende Versorgung mit der notwendigen Technologie, die damit einhergehende Vergünstigung des Produkts Radio und die zunehmend innovativen Einflüsse auf die Bedienbarkeit verhalfen diesem Medium zu seinem Erfolg. Alles in allem ist „die begleitende Funktion des Hörfunks, die oft als Schwäche ausgelegt wird, [..] seine eigentliche Starke" (Franz et al. 1991: 404).
Ein Medium mit einer derart umfassenden Geltung liegt natürlich im Fokus sozialwissenschaftlicher Analysen. Es stellt sich die Frage nach den Rezipienten, deren Differenzierbarkeit nach soziodemographischen Merkmalen und die unterschiedlichen Arten des Konsums. Als letzter Schritt ist die Betrachtung dieser Erhebungen im zeitlichen Verlauf von Interesse. Lassen sich an den Radionutzungsdaten im zeitlichen Vergleich Prozesse des sozialen Wandels ablesen?
Um diese Frage zu beantworten, wirft diese Ausarbeitung einen zusammenfassend analytischen Blick auf die Ergebnisse der Radionutzungsforschung der letzten 50 Jahre der Bundesrepublik und zieht ein Resümee über die parallele Entwicklung des Mediums und der Gesellschaft sowie über die Verwendbarkeit dieser Daten.
2) DAS RADIO: GESCHICHTE
Dieses Kapitel umfasst prägnant die historischen Stationen in der Entwicklung der Rundfunktechnologie der Bundesrepublik, deren politischen Entstehungs-hintergründe und strategische Position als Gesellschaftsmedium.
2.1 Die Entwicklung der Radiotechnologie
Mit den Worten ,,Hier ist Berlin, Vox-Haus" (Vgl. Deutsches Rundfunkarchiv 1998) begann am 28. September 1923 die Geschichte des Rundfunks auf deutschem Boden. Diese erste Radioübertragung aus dem Dachgeschoß des Kolonialkaufmanns August Stauch in dem Berliner Vox-Haus basierte auf einer improvisierten Sendeanlage aus alten Laboratoriumsbeständen. Zu dieser Zeit war ein Radioempfangsgerät entweder ein teurer Luxusartikel oder aber eine improvisierte Lösung - überwiegend aus Draht bestehend.
Seitdem hat sich die Rundfunktechnologie kontinuierlich weiterentwickelt. Bedingt durch verbesserte Produktionstechniken und den damit verbundenen Kostensenkungen in der Anschaffung wandelte sich das spärlich verbreitete Radio zu einem Massenprodukt.
Weil das Verständnis von der Entwicklung des Mediums Radio für die Deutung von Konsum- und Verhaltensanalysen grundlegend ist, gibt Abbildung 1 einen Überblick über die im Laufe der Zeit entstandenen Produktdifferenzierungen mit der Funktion eines Radios.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Grafik: Dennis Klinkhammer 2007
Angefangen bei der Urform des Radios 1923, setzte 1933 mit dem Deutschen Volksempfänger die Massentauglichkeit des Radios ein. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 wurde das Medium Radio von den Siegermächten als kontrollierbare Instanz für die demokratische Ordnung in dem befreiten Deutschland verstanden. Neben der Öffnung für private Sender in den 80er Jahren, erlebte das Radio mehrere technologische Neuerungen. Es erhielt Einzug in Automobilen, in jüngster Zeit im Internet und als Zusatzfunktion in Kleinst-und Telefongeräten. Technologisch gesehen ist das Radio heute ein konzentriert auftretendes Produkt.
2.2 Radioübertragungen in Deutschland
Die Bundesrepublik hat zum heutigen Zeitpunkt ein „Duales Rundfunksystem". Dies bedeutet eine Aufteilung des Rundfunkangebots in private und öffentliche Anbieter, wie Abbildung 2 veranschaulicht.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Grafik: Dennis Klinkhammer 2007
Die Marktanteile verteilen sich etwa gleichmäßig auf private und öffentlich-rechtliche Anbieter. Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind die Landesrundfunkanstalten und bundesweite sowie Auslandsprogramme. Zu nennen sind hier beispielsweise der Süd-West-Rundfunk (SWR) und die Deutsche Welle. Die Funktion der öffentlich-rechtlichen Rundfunksender sollte ein Eintreten „[...1 für die demokratische Ordnung ebenso für das Kulturelle Leben in der Bundesrepublik [..1" (Bomas 2005: 3) sein. Bis in den 80er Jahren war der öffentlich-rechtliche Rundfunk der einzige Anbieter von Radioprogrammen. Erst danach öffnete sich der Rundfunkmarkt für private Investoren und ermöglichte einen Wettbewerb um Marktanteile. Die Unterschiede liegen überwiegend in dem Finanzierungswesen und der inhaltlichen Ausrichtung der Sender. Die öffentlich-rechtlichen Sender finanzieren sich mittels der Gebühren-Einzugs-Zentrale (GEZ) und die privaten über Werbeeinnahmen.
3) VERKNÜPFUNG VON RUNDFUNK UND GESELLSCHAFT
Dass das Medium Radio einen festen Platz in der Gesellschaft zu haben scheint, wurde bereits in den Kapiteln 1 und 2 deutlich. Dieses Kapitel befasst sich mit den Ursachen dieser Kausalität. Auf der einen Seite ergibt sich die tatsächliche Bedeutung für die Gesellschaft bei der Betrachtung individueller Medienzeitbudgets (Abschnitt 3.1). Auf der anderen Seite steht das empirische Interesse und mit welchem Fokus man Daten über Mediennutzung betrachten kann (Abschnitt 3.2). Beide Seiten werden in diesem Kapitel kurz behandelt.
3.1 Die Bedeutung des Radios
Im Vordergrund dieses Abschnitts steht die Frage nach der Bedeutung eines Mediums. Für dessen Messung hat sich in den Medienwissenschaften der Wert des „Medienzeitbudgets" etabliert. Dies sind Bruttowerte aus der Summierung der einzelnen Mediennutzungsdauern. Ein fiktives Beispiel: Eine erwerbslose Person hat bei 9 Stunden Fernsehkonsum und 2 Stunden Radiokonsum am Tag ein Medienzeitbudget von 9 + 2 = 11 Stunden. Der Anteil der jeweiligen Medien dividiert durch das Medienzeitbudget ergibt die prozentuale Gewichtung des einzelnen Mediums. In unserem Beispiel entfallen mehr als 80% Bedeutung auf den Fernsehkonsum. Wie die in der Bundesrepublik erhältlichen Medien untereinander rangieren, ergibt sich aus Abbildung 3, welche den durchschnittlichen Tageskonsum an unterschiedlichen Medien in Prozent angibt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Zu erkennen ist die Dominanz der Medien Radio und Fernsehen, auf welche zusammen 75 Prozent des Medienzeitbudgets entfallen. Dabei schließt das Radio mit 36 Prozent Anteil fast gleichauf mit dem Fernsehen bei 38 Prozent. Demnach ist die hohe Bedeutung des Mediums Radio filr den individuellen Tagesablauf bestätigt.
3.2 Aspekte empirischer Sozialforschung
Eben weil das Radio so stark im gesellschaftlichen Alltag vertreten ist, muss eine Verflechtung zwischen Konsum und Gesellschaft bestehen. Während die Resultate dieser Verflechtung eingehend in Kapitel 5 behandelt werden, folgt nun ein Blick auf die möglichen Aspekte der Datenerhebung in den Medienwissenschaften:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Grafik: Dennis Klinkhammer 2007
Abbildung 4 zeigt relevante zu erhebende Daten aus der Medien-nutzungsforschung. Das betrachtete Medium ist das Radio, welchem man unter bestimmten Umständen (wann, wie lange...) zuhören kann. Die Umstände variieren von Individuum zu Individuum, allerdings gibt es ilberhäufig auftretende Gemeinsamkeiten unter sich ähnelnden Individuen. Solche homogenen Individuen lassen sich als Gruppen zusammenfassen, beispielsweise die Gruppe der Menschen in Beruf oder Ausbildung. Die dabei relevante Frage ist: In welche soziodemographischen Gruppen lässt sich die Menge an Konsumenten unterteilen und auf welche Weise folgen diese dem Medium Radio? Beispielsweise könnte man feststellen, dass Schiller in der Zeit von 08:00 bis 14:00 wenig am Radioprogramm partizipieren, weil bedingt durch die Schule der Konsum nicht möglich ist. Somit hätte man dem Alter, einem gesellschaftlichen Status und der daraus resultierenden Tätigkeit einer Gruppe von Individuum ein Konsumverhalten zugeordnet. In den nachfolgend verwendeten Analysen wird in Altersgruppen mit einer Breite von je 10 Jahren unterschieden, dem Geschlecht, der Bildung und dem sozioökonomischen Status. Daraus resultiert eine Vielzahl möglicher Kausalitäten, welche eingehend betrachtet werden.
4) DAS ANALYSEVERFAHREN
Dieses Kapitel verweist auf die verwendeten Erhebungen, ihre Methoden und klärt besondere statistische Begrifflichkeiten in Hinblick auf die Radionutzungsforschung.
4.1 Das statistische Verfahren
Die zu Grunde liegenden Befunde entstammen aus „[...] insgesamt 1 2 Tagesablaufstudien [...]" (Franz et al. 1991: 400) fur die Ergebnisse aus „Die Entwicklung der Radionutzung 1969 bis 1990" und werden um aktuelle Erhebungen aus „Media Analysen Radio II 2007" erganzt. Diese Untersuchungen hatten denselben Fokus auf das Thema Radiokonsum, „trotzdem weisen die einzelnen Erhebungen Unterschiede auf [...]" (Franz et al. 1991: 400). Von Erhebung zu Erhebung kann das Rekrutierungsverfahren der Probanden variieren, oder der Untersuchungszeitraum (Vgl. Franz et al. 1991, Tabelle 1: Infratest 5:30 bis 24:00 und Teleskopie von 0:00 bis 24:00). Dies soll nicht unerwähnt bleiben, auch wenn die zu erwartenden Effekte marginal ausfallen dürften. Die Erhebungsmethode der Radionutzungsdaten bestand in der Rekonstruktion des Tagesablaufs der Probanden und einer nachträglichen Zuteilung von Radiokonsumzeiten (Vgl. Franz et al. 1991: 400).
[...]
Häufig gestellte Fragen
Wann begann die Geschichte des Rundfunks in Deutschland?
Die erste offizielle Radioübertragung in Deutschland fand am 28. September 1923 aus dem Vox-Haus in Berlin statt.
Was ist das „Duale Rundfunksystem“?
Es bezeichnet die Koexistenz von öffentlich-rechtlichen Sendern (finanziert durch Gebühren) und privaten Anbietern (finanziert durch Werbung) in Deutschland.
Wie hoch ist die Bedeutung des Radios im Vergleich zum Fernsehen?
Radio und Fernsehen dominieren das Medienzeitbudget. Das Radio macht etwa 36 % des täglichen Medienkonsums aus, fast gleichauf mit dem Fernsehen (38 %).
Was war der „Volksempfänger“?
Der 1933 eingeführte Volksempfänger ermöglichte die Massenverbreitung des Radios in Deutschland, wurde jedoch auch massiv für politische Propaganda genutzt.
Kann man sozialen Wandel an Radionutzungsdaten ablesen?
Ja, Veränderungen im Tagesablauf, Bildungsstand und Freizeitverhalten spiegeln sich in den Daten der Radionutzungsforschung über Jahrzehnte hinweg wider.
- Citation du texte
- Dennis Klinkhammer (Auteur), 2008, Das Radio: Historie als Ausdruck sozialen Wandels, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126023