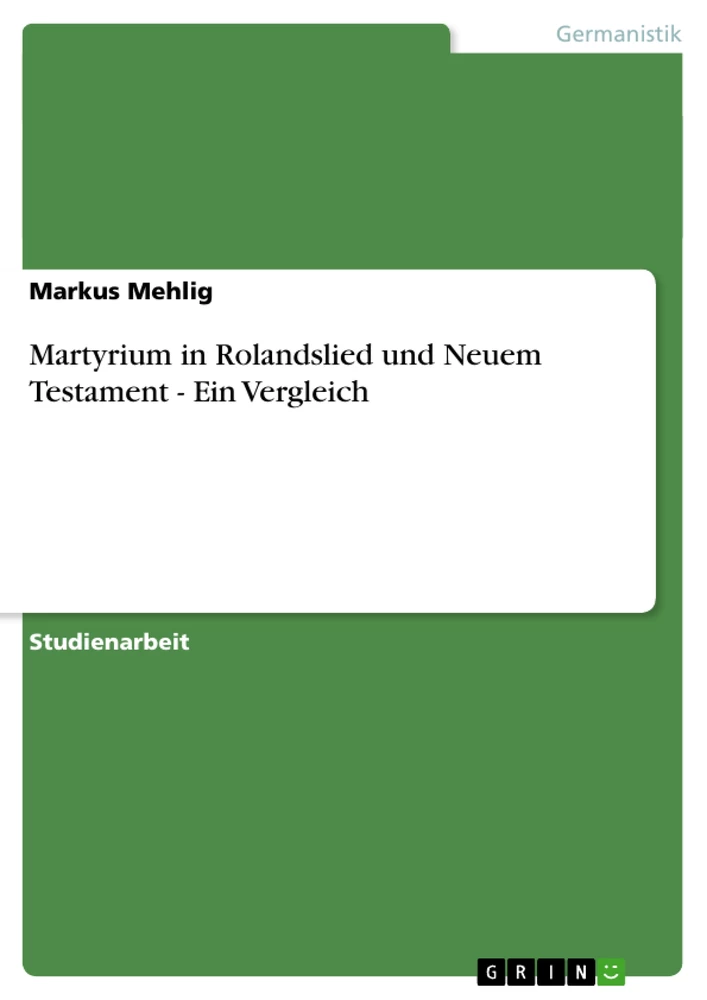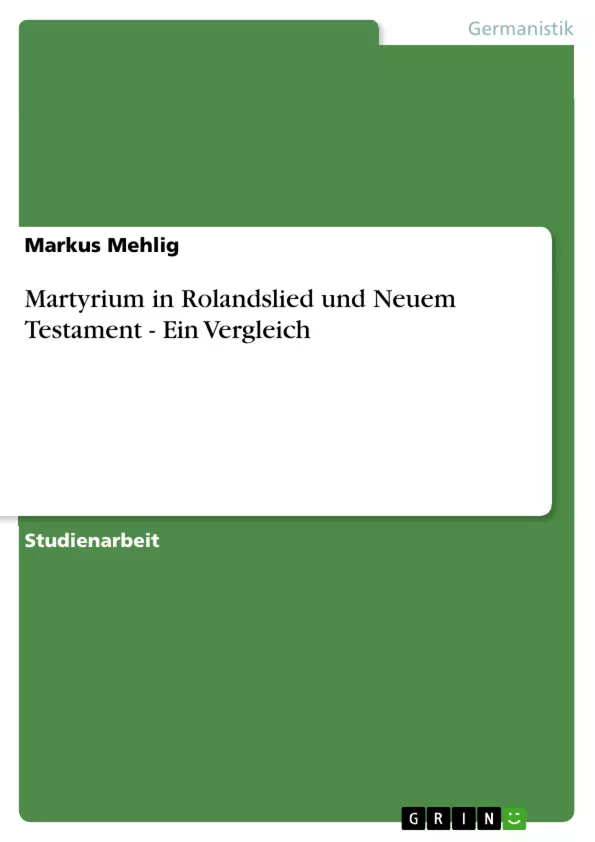Das Rolandslied des Pfaffen Konrad ist eines der bekanntesten Epen der mittelhochdeutschen
Sprachepoche. Als Adaption der französischen „Chanson de Roland“
schildert es den Kreuzzug der Gefolgschaft Karls des Großen nach Spanien gegen
die dort ansässige heidnische Bevölkerung. Seinem Ziel – der vollkommenen Bekehrung
der spanischen Bevölkerung – sehr nahe, widersträubt sich nur noch die
Stadt Saragossa unter der Herrschaft des Königs Marsilie seiner Unterwerfung.
Im Mittelpunkt der Erzählung, die schließlich im Sieg der Christen über die heidnischen
Heerscharen endet, steht bis zu seinem Tod der Kreuzritter und Neffe Karls:
Roland.
[...]
Besonders mit der Thematik des Martyriums und der Gottesgegenwart im Kampf
Rolands und seiner Mitstreiter gegen die Heiden soll sich diese Arbeit befassen. Vor
allem die direkten Parallelen des Epos zur Heiligen Schrift der Bibel sollen aufgedeckt
und erörtert werden. Neben dem Verrat Geneluns und dem märtyrerischen Tod
Rolands gilt es dabei auch die beschriebenen Himmelszeichen und Naturgewalten
Gottes während der Schlacht zu untersuchen und eventuelle Bezüge zu biblischen
Beschreibungen zu klären.
Ich möchte zu Beginn vor allem auf die hauptsächlich interpretatorische und erörternde
Absicht dieser Arbeit hinweisen, die sich nicht auf eine große Anzahl von
Sekundärquellenbezügen stützt, sondern viel mehr darauf bedacht ist, sich der
Primärquelle, dem ursprünglichen Text – in direktem Bezug zur Passionsgeschichte
des Neuen Testaments – sensibel zu nähern.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Verrat
- 2.1 Umstände des Verrats
- 2.2 Motive der Verräter
- 3. Gotteszeichen
- 3.1 Vorbemerkungen
- 3.2 Konkrete Gotteszeichen
- 3.2.1 Gott als Kraftspender
- 3.2.2 Wiederauferstehung
- 4. Martyrium
- 4.1 Vorbemerkungen
- 4.2 Vergleich der Martyrien Rolands und Jesu Christi
- 4.2.1 Vergleich der Bestrafungen der Verräter
- 4.2.2 Vergleich der Reaktionen auf das bevorstehende Martyrium
- 4.2.3 Vergleich der konkreten Leidensgeschichten
- 4.2.4 Vergleich der beiden Todesszenen
- 4.2.5 Vergleich der Naturerscheinungen nach dem Tod
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Parallelen zwischen dem Martyrium Rolands im Rolandslied und dem Martyrium Jesu Christi im Neuen Testament. Die Arbeit konzentriert sich auf einen vergleichenden Ansatz, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Erzählungen herauszuarbeiten. Der Fokus liegt dabei auf den narrativen Strukturen, den Motiven und der Darstellung von Gottes Wirken.
- Der Verrat als zentraler Handlungskatalysator in beiden Erzählungen.
- Die Darstellung von Gotteszeichen und göttlicher Intervention.
- Der Vergleich der Martyrien Rolands und Jesu Christi bezüglich der Umstände, Reaktionen und Folgen.
- Die Rolle des Verräters (Genelun und Judas Iskariot).
- Die literarische und theologische Bedeutung des Martyriums.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Seminararbeit ein und stellt das Rolandslied als wichtiges mittelhochdeutsches Epos vor. Sie beschreibt den Kontext des Kreuzzugs und die zentrale Rolle Rolands. Die Arbeit wird als vergleichende Analyse des Rolandsliedes mit der Passionsgeschichte Jesu Christi positioniert, wobei der Fokus auf dem Martyrium und der göttlichen Intervention liegt. Die interpretatorische Herangehensweise und die Konzentration auf die Primärquellen werden betont.
2. Verrat: Dieses Kapitel analysiert den Verrat als zentralen Aspekt beider Erzählungen. Es vergleicht die Umstände des Verrats an Roland durch seinen Stiefvater Genelun und den Verrat an Jesus durch Judas Iskariot. Während die äußeren Umstände – ein enges Verhältnis zum Verratenen – Ähnlichkeiten aufweisen, werden die inneren Motive der Verräter als unterschiedlich dargestellt: Genelun handelt aus persönlicher Feindschaft und Rache, während Judas’ Motivation im Rolandslied weniger deutlich wird. Der Vergleich der biblischen Stellen zur Beschreibung des Verrats an Jesus wird herangezogen um Parallelen und Unterschiede aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Rolandslied, Neues Testament, Martyrium, Verrat, Genelun, Judas Iskariot, Gotteszeichen, Vergleichende Literaturanalyse, Mittelhochdeutsch, Passionsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen zum Rolandslied und der Passionsgeschichte Jesu Christi
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit untersucht die Parallelen zwischen dem Martyrium Rolands im Rolandslied und dem Martyrium Jesu Christi im Neuen Testament. Der Fokus liegt auf einem vergleichenden Ansatz, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Erzählungen herauszuarbeiten, insbesondere bezüglich narrativer Strukturen, Motive und der Darstellung göttlichen Wirkens.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf den Verrat als zentralen Handlungskatalysator, die Darstellung von Gotteszeichen und göttlicher Intervention, einen detaillierten Vergleich der Martyrien beider Figuren (Umstände, Reaktionen und Folgen), die Rolle der Verräter (Genelun und Judas Iskariot) und die literarische sowie theologische Bedeutung des Martyriums.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Verrat, Gotteszeichen, Martyrium und Zusammenfassung. Die Kapitel behandeln jeweils spezifische Aspekte des Vergleichs zwischen dem Rolandslied und der Passionsgeschichte, beginnend mit einer Einführung in die Thematik und endend mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse.
Was wird im Kapitel "Verrat" untersucht?
Dieses Kapitel analysiert den Verrat an Roland durch Genelun und den Verrat an Jesus durch Judas Iskariot. Es vergleicht die Umstände des Verrats und die Motive der Verräter. Während die äußeren Umstände Ähnlichkeiten aufweisen, werden die inneren Motive als unterschiedlich dargestellt: Genelun handelt aus persönlicher Feindschaft und Rache, Judas' Motivation wird als weniger deutlich beschrieben. Der Vergleich zieht biblische Stellen zur Beschreibung des Verrats an Jesus heran.
Was wird im Kapitel "Gotteszeichen" behandelt?
Das Kapitel "Gotteszeichen" befasst sich mit der Darstellung göttlicher Intervention in beiden Erzählungen. Es untersucht konkrete Gotteszeichen und deren Bedeutung im Kontext der Martyrien Rolands und Jesu Christi. Ein Unterkapitel konzentriert sich beispielsweise auf Gott als Kraftspender und die Wiederauferstehung.
Wie wird das Martyrium im Detail verglichen?
Das Kapitel "Martyrium" vergleicht die Martyrien Rolands und Jesu Christi umfassend. Der Vergleich umfasst die Bestrafungen der Verräter, die Reaktionen auf das bevorstehende Martyrium, die konkreten Leidensgeschichten, die Todesszenen und die Naturerscheinungen nach dem Tod beider Figuren.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Rolandslied, Neues Testament, Martyrium, Verrat, Genelun, Judas Iskariot, Gotteszeichen, Vergleichende Literaturanalyse, Mittelhochdeutsch und Passionsgeschichte.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Primärquellen: das Rolandslied und das Neue Testament. Die interpretatorische Herangehensweise betont den Vergleich dieser Quellen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Zusammenfassung fasst die wichtigsten Ergebnisse des Vergleichs zwischen dem Martyrium Rolands und dem Martyrium Jesu Christi zusammen. Sie zeigt Parallelen und Unterschiede in den Erzählungen auf und beleuchtet die literarische und theologische Bedeutung des Martyriums in beiden Kontexten.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist primär für akademische Zwecke gedacht und dient der Analyse von literarischen und theologischen Themen in strukturierter und professioneller Weise.
- Citation du texte
- Markus Mehlig (Auteur), 2009, Martyrium in Rolandslied und Neuem Testament - Ein Vergleich , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126191