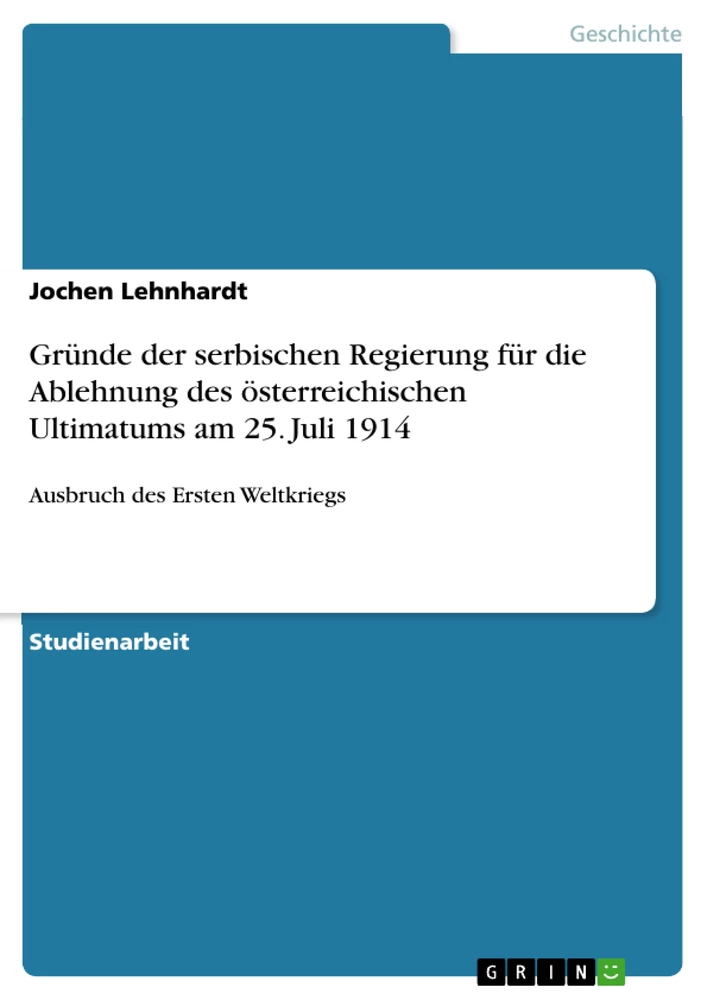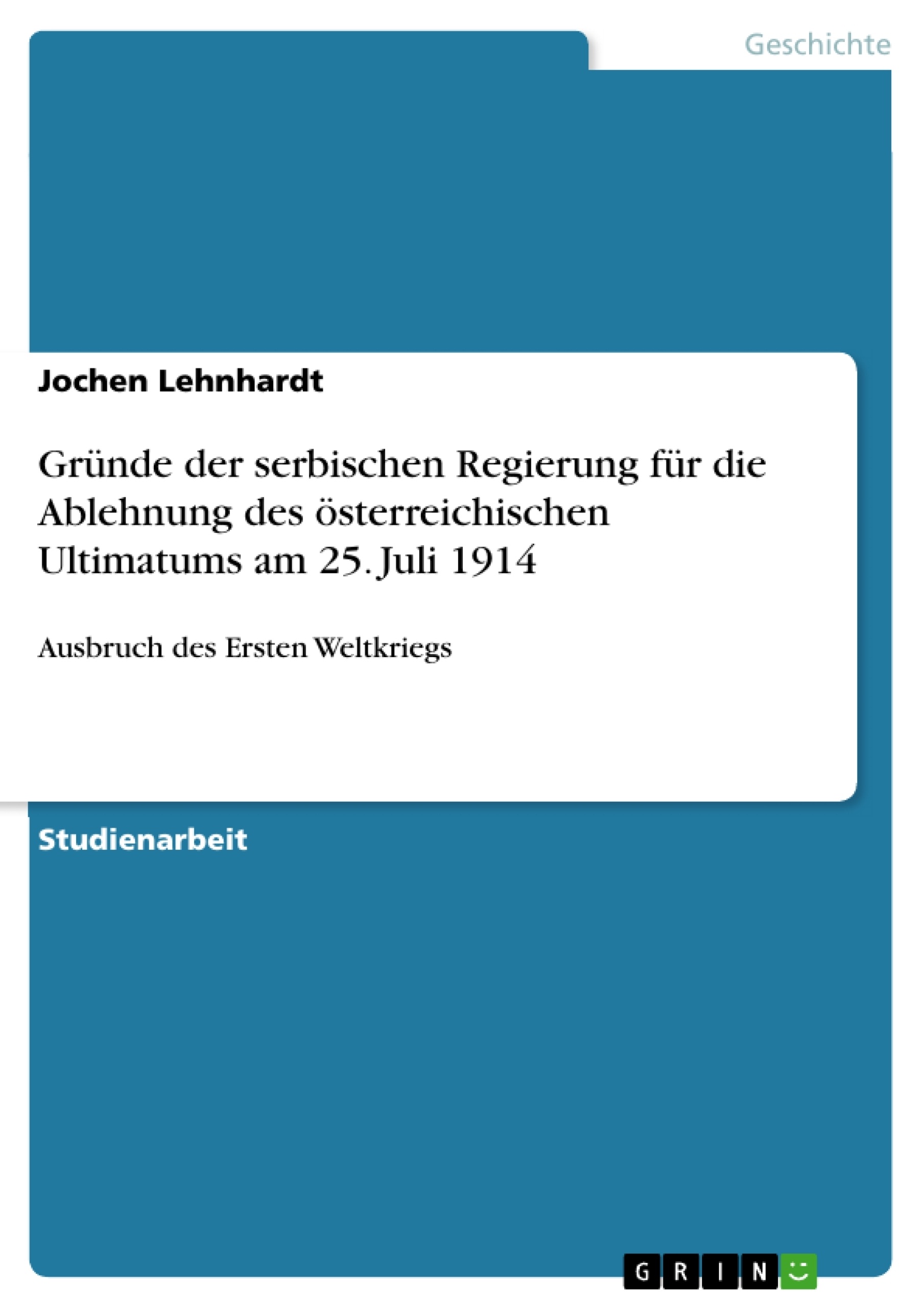Als Serbien am 23.Juli 1914 die Forderungen, die Österreich-Ungarn nach dem Attentat von Sarajevo an sie gestellt hatte, zurückwies, hatten sie damit eine Entscheidung getroffen, die letztlich den Ausbruch des ersten Weltkrieges zur Folge hatte. Diese Konsequenz des serbischen Handelns war die Ursache dafür, daß die Vorgänge, die mit der östereichischen Begehrnote vom 23. Juli zusammenhängen, von großem Interesse für die Forschung war und ist.
Dies gilt auch für die Gründe für das serbische Handelns. Ihnen mußte, wie diese Arbeit zeigen wird, klar sein, daß die Nichterfüllung aller österreichischen Forderungen sehr wahrscheinlich einen Krieg mit der Doppelmonarchie nach sich ziehen wird. Somit war die Entscheidung über die Beantwortung dieser Note eine Frage um Krieg oder Frieden.
In dieser Hausarbeit soll nun erörtert werden, welche Ziele die serbische Regierung mit dieser Entscheidung verbunden hatte und was sie zu dieser Handlungsweise veranlasst hat. Weniger Raum wird dabei den südslawischen Plänen der Serben gegeben, zum Einen wegen des beschränkten Umfangs der Arbeit und zum Anderen, weil diese eine nur geringe Rolle in den 48 Stunden Bedenkzeit, die die Serben hatten, spielte und diese erst im späteren Verlauf des Krieges auf der Tagesordnung standen.
In dieser Arbeit wird zunächst die Vorgeschichte der Beziehungen beider Staaten analysiert, um historische Gründe für die spätere Haltung der serbischen Regierung zu finden, dann wird untersucht werden, welcher Art die gestellten Forderungen waren und welche Absicht man in Wien damit verband. Besonders interessant ist hierbei, ob die Serben überhaupt eine Wahl bei der Beantwortung gehabt haben. Dann wird erörtert, was für innenpolitische Gründe für und wider den Krieg sprachen. Zuletzt soll dann noch der Einfluß des Auslandes und insbesondere Rußlands auf die Serben dargestellt werden.
Diese Hausarbeit stützt sich im wesentlichen, neben den Akteneditionen, auf die Werke von Albertini, Fish Cornwall und Fay, da diese den Vorteil einer relativ neutralen Haltung zu diesem Thema haben. Den übrigen Werken ist zum Teil, angesichts der Bedeutung dieser Frage bezüglich der Kriegsschuld am Ersten Weltkrieg, eine einseitige Sichtweise zu eigen, was eine objektive Arbeit damit erschwert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Geschichte der Beziehungen zwischen Österreich-Ungarn und Serbien bis zum Ultimatum vom 23. Juli 1914.
- 1.1 Bis 1903
- 1.2 Ab 1903 bis zur Julikrise
- 1.3 Attentat von Sarajevo
- 2. Das österreichische Ultimatum an Serbien
- 2.1 Ziele Österreich-Ungarns
- 2.2 Übergabe und Inhalt des Ultimatums
- 2.3 Antwort Serbiens
- 3. Innenpolitische Gründe Serbiens für die Ablehnung
- 3.1 Militärische Lage Serbiens nach den Balkankriegen
- 3.2 Stellung der „Schwarze Hand“ und ihre Beteiligung am Attentat
- 3.3 Der Prioritätsstreit und Auswirkungen auf das serbische Handeln
- 4. Einfluß des Auslandes auf die serbische Entscheidung
- 4.1 Einfluß anderer Staaten auf serbische Entscheidung
- 4.2 Russischer Einfluß
- Zusammenfassung / Ergebnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Gründe für die serbische Ablehnung des österreichischen Ultimatums vom 23. Juli 1914, welches den Ausbruch des Ersten Weltkriegs zur Folge hatte. Die Arbeit analysiert die komplexen Faktoren, die zu dieser Entscheidung führten, und beleuchtet die politischen, militärischen und internationalen Aspekte.
- Die historischen Beziehungen zwischen Österreich-Ungarn und Serbien vor dem Ultimatum.
- Der Inhalt und die Ziele des österreichischen Ultimatums.
- Die innenpolitische Situation in Serbien und die Rolle der „Schwarzen Hand“.
- Der Einfluss anderer europäischer Mächte, insbesondere Russlands, auf die serbische Entscheidung.
- Die Abwägung von Krieg und Frieden aus serbischer Perspektive.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung skizziert die Bedeutung der serbischen Entscheidung, das österreichische Ultimatum zurückzuweisen, als entscheidenden Faktor für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Sie erläutert den Fokus der Arbeit auf die serbischen Beweggründe und kündigt die Struktur der Analyse an, die die historischen Beziehungen der beiden Staaten, den Inhalt des Ultimatums, die innenpolitischen Faktoren in Serbien und den Einfluss des Auslands beleuchten wird. Der begrenzte Umfang der Arbeit wird als Begründung für die Konzentration auf die unmittelbaren Ursachen der Entscheidung angegeben.
1. Geschichte der Beziehungen zwischen Österreich-Ungarn und Serbien bis zum Ultimatum vom 23. Juli 1914.: Dieses Kapitel untersucht die komplexen und oft angespannten Beziehungen zwischen Österreich-Ungarn und Serbien bis zum Jahr 1914. Es beginnt mit der langen Periode der türkischen Herrschaft über Serbien und der darauf folgenden Unabhängigkeit. Der Text analysiert das Misstrauen Österreich-Ungarns gegenüber dem aufstrebenden serbischen Nationalismus und dessen potenzieller Wirkung auf die südslawischen Gebiete innerhalb der Donaumonarchie. Die wirtschaftlichen und politischen Spannungen, verstärkt durch die österreichisch-ungarische Annexion Bosniens und Herzegowinas, werden ausführlich dargestellt, ebenso wie die wachsende Abhängigkeit Serbiens vom österreichischen Markt und die darauf folgenden Bemühungen Serbiens, sich ökonomisch zu emanzipieren. Das Kapitel beschreibt die Entwicklung der serbischen Politik von einer anfänglichen Kooperation mit Österreich-Ungarn hin zu einer zunehmend feindseligen Haltung.
2. Das österreichische Ultimatum an Serbien: Dieses Kapitel analysiert das österreichische Ultimatum an Serbien nach dem Attentat von Sarajevo. Es untersucht die Ziele Österreich-Ungarns, die Formulierung und die Übergabe des Ultimatums und die serbische Antwort. Der Text betont den Druck, den das Ultimatum auf die serbische Regierung ausübte und die geringe Spielräume für eine andersartige Reaktion. Es wirft die Frage auf, inwiefern die Serben überhaupt eine echte Wahl hatten angesichts der ultimativen Forderungen Österreich-Ungarns. Der Fokus liegt auf der Darstellung des Ultimatums als ein Instrument der Machtdemonstration und als Ausdruck der österreichisch-ungarischen Entschlossenheit, Serbien zu unterwerfen.
3. Innenpolitische Gründe Serbiens für die Ablehnung: Dieses Kapitel untersucht die innenpolitischen Faktoren, welche die serbische Entscheidung beeinflusst haben. Es beleuchtet die militärische Lage Serbiens nach den Balkankriegen, die Rolle der „Schwarzen Hand“ und den Konflikt zwischen verschiedenen politischen Fraktionen innerhalb der serbischen Regierung. Es analysiert den Einfluss dieser Faktoren auf die Entscheidung der serbischen Regierung, das Ultimatum zurückzuweisen, unter Berücksichtigung der schwierigen innenpolitischen Lage und der unterschiedlichen Interessenslagen der politischen Akteure. Der Text deutet die komplexen Abwägungen und die möglichen Folgen, sowohl im Inland als auch im Ausland, auf die Entscheidung an.
4. Einfluß des Auslandes auf die serbische Entscheidung: Dieses Kapitel konzentriert sich auf den Einfluss ausländischer Mächte auf die serbische Entscheidung, insbesondere die Rolle Russlands. Es untersucht, wie die internationale Politik und die Beziehungen zu anderen europäischen Mächten die Handlungsfähigkeit und die Entscheidungsfindung der serbischen Regierung beeinflusst haben. Es wird untersucht, inwieweit der internationale Druck und die Unterstützung durch Russland die Entscheidung der serbischen Regierung mitgeprägt haben, und wie diese verschiedenen außenpolitischen Faktoren die serbische Reaktion auf das österreichische Ultimatum beeinflusst haben. Die Analyse legt den Fokus auf die Abwägung von Risiken und Chancen im Kontext der europäischen Machtverhältnisse.
Schlüsselwörter
Österreich-Ungarn, Serbien, Julikrise, Ultimatum, Attentat von Sarajevo, Balkankriege, „Schwarze Hand“, Russischer Einfluss, Innenpolitik, Außenpolitik, Kriegsschuld, Südslawen, Nationalismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Hausarbeit: Die serbische Ablehnung des österreichischen Ultimatums von 1914
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Gründe für die serbische Ablehnung des österreichischen Ultimatums vom 23. Juli 1914, welches als entscheidender Auslöser des Ersten Weltkriegs gilt. Der Fokus liegt auf der Analyse der politischen, militärischen und internationalen Faktoren, die zu dieser Entscheidung führten.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die historischen Beziehungen zwischen Österreich-Ungarn und Serbien vor dem Ultimatum, den Inhalt und die Ziele des Ultimatums selbst, die innenpolitische Situation in Serbien (einschließlich der Rolle der „Schwarzen Hand“), den Einfluss anderer europäischer Mächte (besonders Russland) auf die serbische Entscheidung, und die Abwägung von Krieg und Frieden aus serbischer Sicht.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in eine Einleitung, vier Hauptkapitel und eine Zusammenfassung. Kapitel 1 beleuchtet die Geschichte der Beziehungen zwischen Österreich-Ungarn und Serbien bis 1914. Kapitel 2 analysiert das österreichische Ultimatum. Kapitel 3 untersucht die innenpolitischen Gründe Serbiens für die Ablehnung. Kapitel 4 befasst sich mit dem Einfluss des Auslands auf die serbische Entscheidung.
Was sind die wichtigsten Erkenntnisse des Kapitels zur Geschichte der Beziehungen zwischen Österreich-Ungarn und Serbien?
Dieses Kapitel beschreibt die komplexen und oft angespannten Beziehungen zwischen beiden Ländern. Es analysiert das Misstrauen Österreich-Ungarns gegenüber dem serbischen Nationalismus und die Auswirkungen der Annexion Bosniens und Herzegowinas. Es zeigt die Entwicklung der serbischen Politik von anfänglicher Kooperation zu einer zunehmend feindseligen Haltung.
Was wird im Kapitel über das österreichische Ultimatum behandelt?
Dieses Kapitel analysiert das Ultimatum nach dem Attentat von Sarajevo, seine Ziele, Formulierung und Übergabe, sowie die serbische Antwort. Es betont den Druck auf die serbische Regierung und die Frage, inwieweit die Serben überhaupt eine Wahl hatten.
Welche innenpolitischen Faktoren werden in der Hausarbeit berücksichtigt?
Die Hausarbeit beleuchtet die militärische Lage Serbiens nach den Balkankriegen, die Rolle der „Schwarzen Hand“, und den Konflikt zwischen verschiedenen politischen Fraktionen. Es analysiert den Einfluss dieser Faktoren auf die Entscheidung, das Ultimatum zurückzuweisen.
Welche Rolle spielte der Einfluss des Auslands, insbesondere Russland?
Dieses Kapitel untersucht, wie die internationale Politik und die Beziehungen zu anderen europäischen Mächten, insbesondere Russland, die Handlungsfähigkeit und Entscheidungsfindung der serbischen Regierung beeinflusst haben. Es analysiert den internationalen Druck und die Unterstützung durch Russland.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Österreich-Ungarn, Serbien, Julikrise, Ultimatum, Attentat von Sarajevo, Balkankriege, „Schwarze Hand“, Russischer Einfluss, Innenpolitik, Außenpolitik, Kriegsschuld, Südslawen, Nationalismus.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der Hausarbeit?
Die Hausarbeit enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel und eine abschließende Zusammenfassung/ein Ergebnis, die die wichtigsten Erkenntnisse der Analyse zusammenfasst.
Für wen ist diese Hausarbeit gedacht?
Diese Hausarbeit ist für den akademischen Gebrauch bestimmt und dient der Analyse der Thematik auf strukturierte und professionelle Weise.
- Citar trabajo
- M. A. Jochen Lehnhardt (Autor), 2001, Gründe der serbischen Regierung für die Ablehnung des österreichischen Ultimatums am 25. Juli 1914, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126219