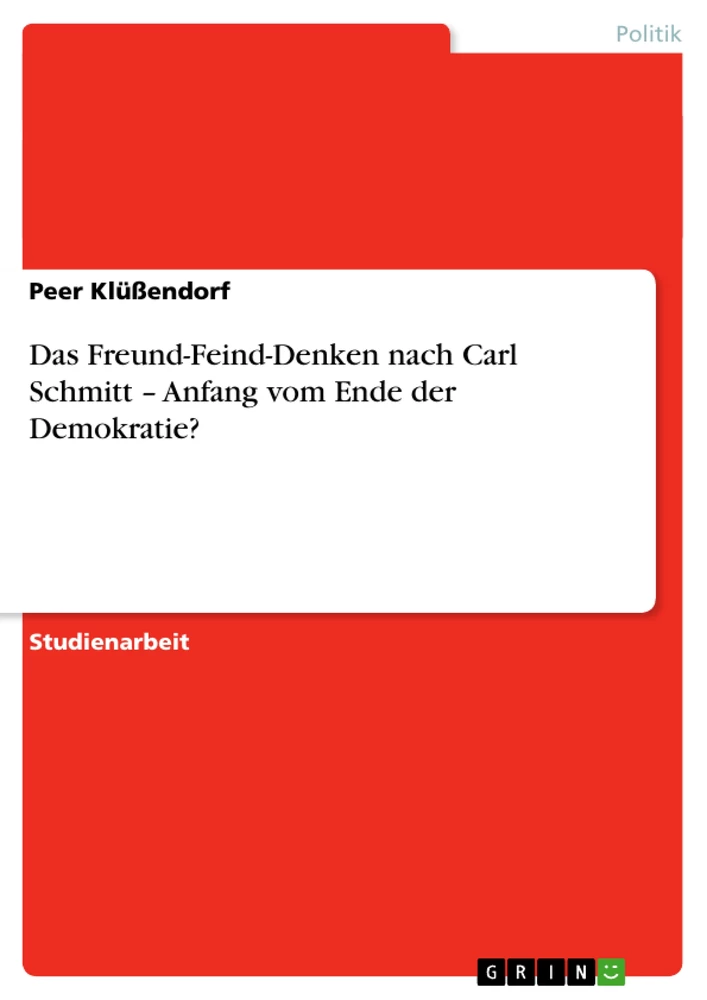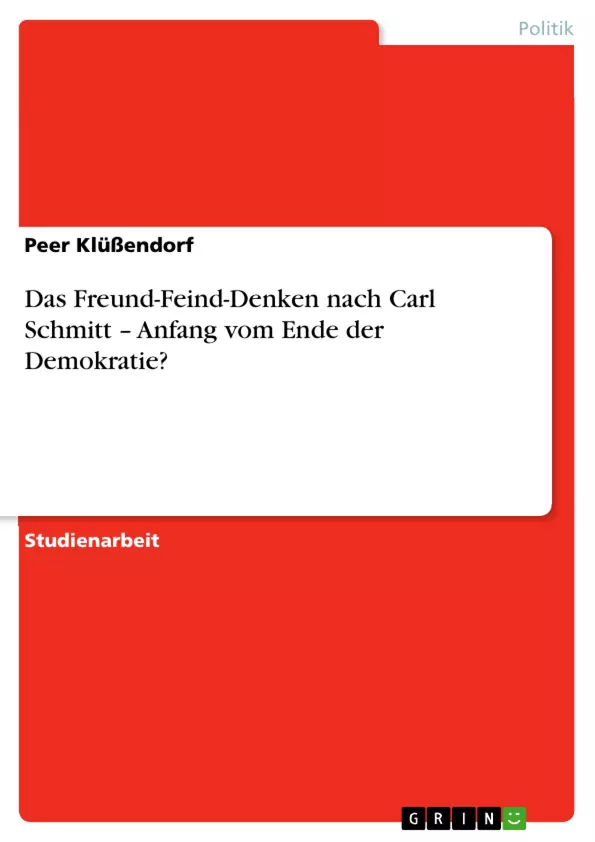„Auctoritas, non veritas facit legem.“ – „Autorität, nicht Wahrheit schafft das Recht.”
Durchaus im Sinne dieses Ausspruchs von Hobbes, erarbeitete Carl Schmitt politische Theorien und Rechtsvorstellungen mit Fokus auf einen starken, souveränen Staat.
Die Aktualität seiner Theorien bestätigt ein Blick in die Presselandschaft, in der seit dem Beginn der Finanzkrise nahezu täglich die Forderung nach größerer Staatsmacht gestellt und der Wirtschaftsliberalismus kritisiert wird.
Für Schmitt setzt dieser „Begriff des Staates […] den Begriff des Politischen voraus“ und damit nicht eine simple Autorität in ökonomischen Fragen, sondern per se die Unterscheidung zwischen Freund und Feind, die alles Politische prägt.
Diese scheinbar archaische Definition von Politik findet sich jedoch nicht nur in nationalsozialistischer Ideologie, sondern auch in der Gegenwartspolitik wieder.
Die damit verbundenen Gefahren liegen auf der Hand und finden in den abschließenden Schlussfolgerungen ihren Platz. Zuvor ist es Aufgabe dieser Hausarbeit, die Ideologie des Nationalsozialismus und die Politik der US-Regierung von George W. Bush im „Krieg gegen den Terror“ auf Denkmuster aus Carl Schmitts „Begriff des Politischen“ zu untersuchen. Durch diese Nebeneinanderstellungen soll keinesfalls eine Gleichstellung politischer Motive versucht werden, auch wenn in der Argumentation Jennifer Van Bergen zitiert wird, die die USA unter Bush „on the road to fascism“ sieht. Vielmehr verdeutlicht dies das Problem, zu einem noch immer sehr aktuellen und emotionalen Thema objektive Sekundärliteratur zu wählen. Daher wurden die Angaben von fünf politisch unterschiedlichen Autoren zu diesem Themengebiet abgeglichen.
Auf dieser Grundlage sollen bestehende und vergangene ideologische Muster sachlich und ohne die von Schmitt geschätzte Polemik untersucht werden, um zu erkennen, ob das Freund-Feind-Denken noch heute als eine Gefahr für die bürgerliche Freiheit oder sogar als Vorbote des Endes der Demokratie betrachtet werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Freund-Feind-Unterscheidung nach Carl Schmitt
- Zur Person Carl Schmitt
- Die Freund-Feind-Unterscheidung im „Begriff des Politischen“
- Das Freund-Feind-Bild im Nationalsozialismus
- Das Freund-Feind-Bild im US-amerikanischen „Krieg gegen den Terror“
- Die Gefährdung bürgerlicher Freiheit durch das Freund-Feind-Denken
- Das Freund-Feind-Denken – Anfang vom Ende der Demokratie?
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Aktualität von Carl Schmitts „Begriff des Politischen“ und dessen Freund-Feind-Unterscheidung. Sie analysiert, wie diese Unterscheidung in der Ideologie des Nationalsozialismus und der Politik der US-Regierung im „Krieg gegen den Terror“ zum Tragen kommt. Die Arbeit beleuchtet die Gefahren, die das Freund-Feind-Denken für die bürgerliche Freiheit und die Demokratie birgt.
- Die Freund-Feind-Unterscheidung nach Carl Schmitt
- Die Anwendung des Freund-Feind-Denkens im Nationalsozialismus
- Die Anwendung des Freund-Feind-Denkens im „Krieg gegen den Terror“
- Die Gefährdung der bürgerlichen Freiheit durch das Freund-Feind-Denken
- Die Auswirkungen des Freund-Feind-Denkens auf die Demokratie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Aktualität von Carl Schmitts Theorien dar und führt in die Thematik der Freund-Feind-Unterscheidung ein. Das zweite Kapitel beleuchtet die Person Carl Schmitts und seine zentrale These, dass der Begriff des Staates den Begriff des Politischen voraussetzt. Hierbei wird die Unterscheidung von Freund und Feind als Grundlage des Politischen herausgestellt. Das dritte Kapitel analysiert, wie das Freund-Feind-Bild im Nationalsozialismus zur Rechtfertigung von Gewalt und Unterdrückung eingesetzt wurde. Das vierte Kapitel untersucht die Anwendung des Freund-Feind-Denkens in der US-amerikanischen Politik im „Krieg gegen den Terror“ und zeigt auf, wie diese Unterscheidung zur Legitimierung von militärischen Interventionen und Einschränkungen der bürgerlichen Freiheiten genutzt wurde.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den „Begriff des Politischen“, die Freund-Feind-Unterscheidung, Carl Schmitt, Nationalsozialismus, „Krieg gegen den Terror“, bürgerliche Freiheit und Demokratie. Die Arbeit analysiert, wie das Freund-Feind-Denken in verschiedenen historischen und politischen Kontexten zur Rechtfertigung von Gewalt und Unterdrückung eingesetzt wurde und welche Gefahren es für die Demokratie birgt.
- Citar trabajo
- Peer Klüßendorf (Autor), 2009, Das Freund-Feind-Denken nach Carl Schmitt – Anfang vom Ende der Demokratie?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126254