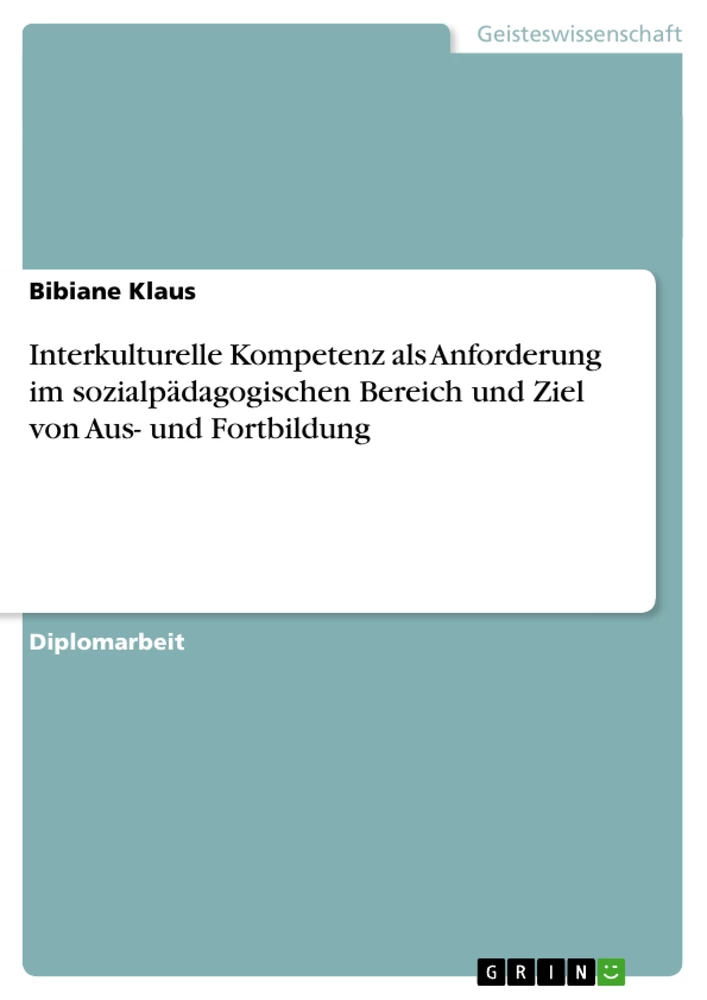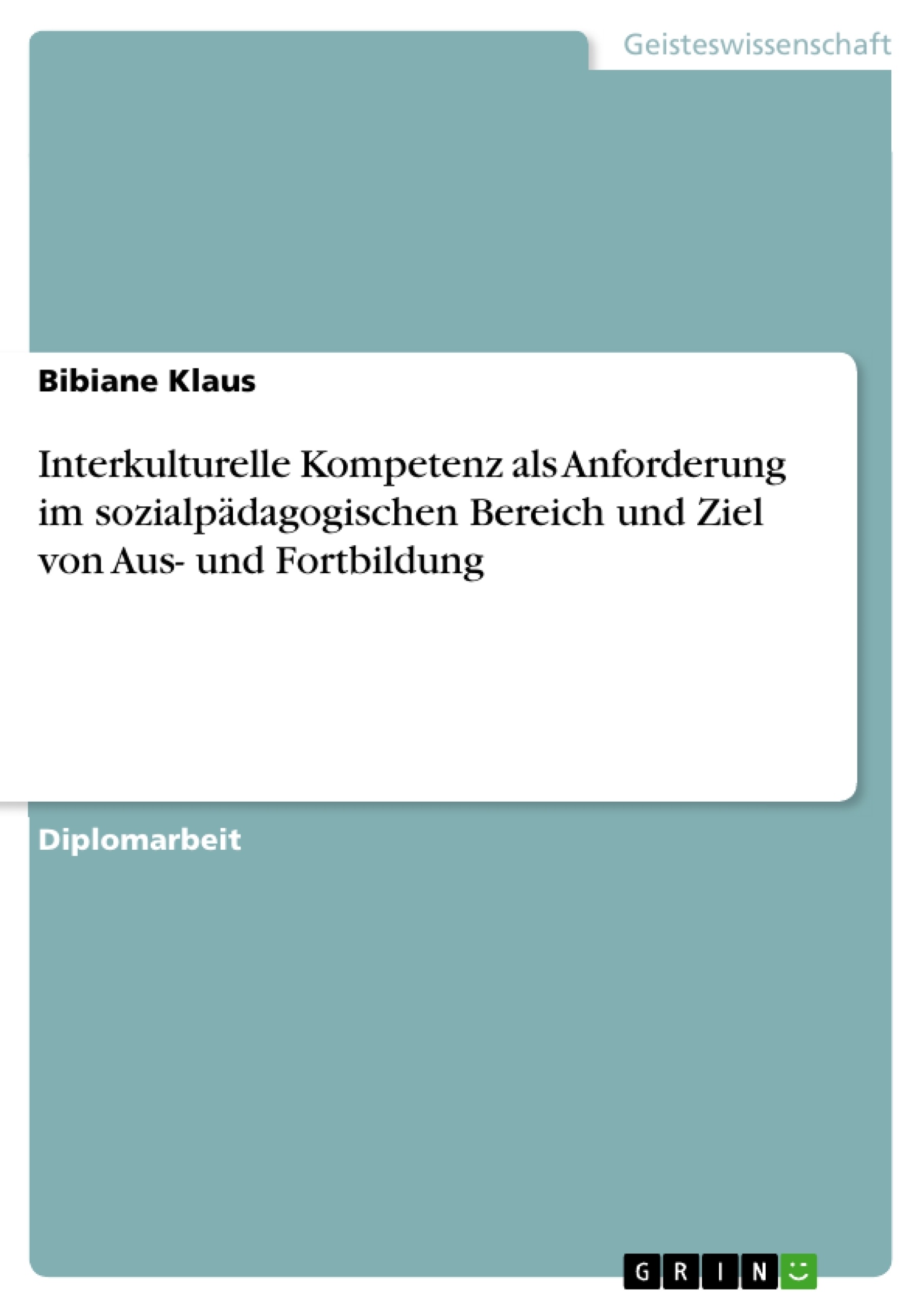„Von den Fremden nimmt man (also) zunächst nur ein Bild wahr, das sich zusammensetzt
aus vielfältigen Vorannahmen und Eindrücken, aus den Phantasien über die fremde
Kultur. Deshalb verweist jede Auseinandersetzung mit Fremden unausweichlich zurück auf
die eigene Kultur. Will ich das Fremde verstehen muß ich zuallererst mich selbst, meine
eigene Kultur und meine eigene historische und soziale Situation verstehen und begreifen.
Gerade das aber macht die Auseinandersetzung mit Fremden so schwierig, weil die
Wahrnehmung des Fremden auf das engste verflochten ist mit der eigenen Geschichte.“1
Motivation und Anregung das Thema des „Interkulturellen Kompetenzerwerbs“ zu bearbeiten,
lieferten die Berichte von Kommilitonen und Freunden, die Teilnahme an Seminaren, eigene
Erfahrungen im Umgang mit Nichtdeutschen im In- und Ausland, sowie meine Überzeugung der
Richtig- und Wichtigkeit einer solchen „Interkulturellen Kompetenz“ als Anforderung für die professionelle
Ausübung der Tätigkeit als Sozialpädagoge.
Ein weiterer Grund sich für gerade dieses Thema zu entscheiden, war der beobachtete bzw.
wahrgenommene reale Zustand auf vielen Ämtern sowie schulischen und außerschulischen
Einrichtungen etc., in denen sozialpädagogisch geschulte Mitarbeiter tätig sind und der auf
unbeabsichtigte Kommunikations- bzw. Interaktionsstörungen zwischen Menschen
unterschiedlicher Kulturen hinweist. Häufig wird als einzige Maßnahme der Schwerpunkt auf die
sprachliche Vorbereitung von Mitarbeitern und/oder Nicht-Deutschen gelegt, da die mangelnden
Sprachkenntnisse als eine der wesentlichen Kommunikationsbarrieren in der interkulturellen
Begegnung angesehen werden. Obwohl einige Mitarbeiter die Herausforderung der
interkulturellen Begegnung erkannt haben und eine gewisse (eigene) Kreativität im Umgang mit
den „anderen“ entwickelten, ist der prozentuale Anteil eben dieser Mitarbeiter sehr gering. Nur
selten werden interkulturelle Begegnungen und Erfahrungen reflektiert. Sie werden viel eher mit
eigenen (kulturellen) Orientierungsmustern verglichen und es wird häufig immer noch verfahren, als
gelte es, sich mit einer homogenen, d.h. monokulturellen Bevölkerung auseinanderzusetzen.
Meines Erachtens ist die Reihe der Probleme, die sich aus diesem Verhalten ergeben können, vom einzelnen allein nicht mehr lösbar. Daher richtet sich das Thema an in sozialpädagogischen
Bereichen tätige Personen. [...]
1 vgl. Rohr, 1990, S. 87. In: Losche, 1995, S. 15.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- I. Kapitel: Bestandsaufnahme
- Multikulturalität als Merkmal der Bundesrepublik Deutschland
- Demographische Bestandsaufnahme und Entwicklung der Bevölkerungszahlen
- Überblick über das gesamte Migrationsgeschehen in der BRD in den 90er Jahren
- Alterstruktur
- Die einzelnen Zuwanderergruppen
- Der Ausländerbestand
- Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur
- Traditionelle Formen sozialpädagogischer Ausbildung
- Grundgedanken sozialpädagogischer Konzepte
- Das Studium der Erziehungswissenschaften (Pädagogik) an der Hochschule
- Studienaufbau und Studieninhalte
- Berufliche Tätigkeitsfelder
- Das Studium der Sozialarbeit/Sozialpädagogik an der Fachhochschule
- Studienaufbau und Studieninhalte
- Spezialisierungsmöglichkeiten und Ergänzungs- und Aufbaustudien
- Arbeitsmarkt für Sozial-, Erziehungs- und Bildungsberufe
- Sozialarbeiter und Sozialpädagogen der Fachhochschulen
- Erziehungswissenschaftler von Universitäten
- Verbleibsstudien von Hochschul „Diplom-Pädagogen“
- Zentrale Ergebnisse der Berufsverbleibstudien
- Berufliche Ausbildung
- Formen beruflicher Weiterbildung
- Rechtliche Zuständigkeit und gesetzliche Regelungen beruflicher Weiterbildung
- Teilnehmermotivation und -struktur in der beruflichen Weiterbildung
- Qualifikation, Qualifikationsvoraussetzungen und Aufgaben des Personals in der beruflichen Weiterbildung
- Zusammenfassung
- Multikulturalität als Merkmal der Bundesrepublik Deutschland
- II. Kapitel: Theoretische Grundlagen
- Interkulturelles Lernen - Ein Begriff macht Karriere
- Begriffsbestimmungen Interkulturellen Lernens
- Ziele interkulturellen Lernens
- Menschliche Grunddimensionen und Bedürfnisse interkultureller Lernziele nach J. Schilling
- Interkulturelles Lernen - ein Prozeß
- Kultur
- Erklärungsmodelle von Kultur
- Austauschtheoretische Definition von Kultur
- Kulturstandards
- Zur Identifizierung von Kulturstandards
- Zur Dynamik kultureller Standards
- Vier Dimensionen kulturspezifischer Unterschiede nach G. Hofstede
- Kulturelle Identität
- Kommunikation
- Modellvorstellungen zur Kommunikation
- Vier Seiten einer Nachricht nach Schulz von Thun
- Kommunikative Störfalle
- Explizite Botschaften - die besondere Bedeutung von Sprache und Fremdsprache
- Implizite Botschaften - die besondere Bedeutung der Körpersprache
- Interaktionsfallen
- Wahrnehmung
- Stereotype/Vorurteile als Form der Wahrnehmungsvereinfachung
- Kompetenz
- Definitionen Interkultureller (Kommunikations)Kompetenz
- Spezifische (soziale) Fertigkeiten interkultureller Kompetenz
- Qualifikationsmerkmale Interkultureller Kompetenz
- Zusammenfassung
- Interkulturelles Lernen - Ein Begriff macht Karriere
- III. Kapitel: Interkulturelles Training
- Interkulturelles Lernen und interkulturelles Training
- Didaktische Merkmale interkultureller Trainingsprogramme
- Ausgewählte Grundmodelle (Methoden) interkulturellen Trainings
- Fallmethode
- Fallmethodenvariante: Analyse kritischer Ereignisse
- Fallmethodenvariante: Kultur-Assimilator
- Simulationsmodell
- Feld-Simulationsmodell
- Variante: Lokale Kultur-Erkundungen im Inland
- Interkulturelle und transkulturelle Lernprojekte
- Universitätsmodell
- Interaktionsmodell
- Übungen
- Fallmethode
- Kritische Bewertung der dargestellten Modelle bzw. Methoden
- Zusammenfassung und Ausblick
- Interkulturelles Lernen und interkulturelles Training
- Nachwort
- Anhang
- Literaturliste
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Bedeutung interkultureller Kompetenz im sozialpädagogischen Bereich. Sie beleuchtet den aktuellen Stand der Multikulturalität in Deutschland, analysiert traditionelle Formen der sozialpädagogischen Ausbildung und beleuchtet die Anforderungen des Arbeitsmarktes. Weiterhin werden theoretische Grundlagen der Interkulturellen Kompetenz, wie Kultur und Kommunikation, dargelegt und verschiedene Modelle und Methoden interkulturellen Trainings vorgestellt.
- Analyse der Multikulturalität in Deutschland
- Bedeutung interkultureller Kompetenz im sozialpädagogischen Kontext
- Theoretische Grundlagen des interkulturellen Lernens
- Vorstellung von Modellen und Methoden interkulturellen Trainings
- Kritische Reflexion der Bedeutung und Umsetzung interkultureller Kompetenz in der Ausbildung und im Beruf
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Diplomarbeit widmet sich der Bestandsaufnahme der Multikulturalität in Deutschland. Es analysiert die demographische Entwicklung und das Migrationsgeschehen der letzten Jahrzehnte. Zudem werden traditionelle Formen der sozialpädagogischen Ausbildung und die Anforderungen des Arbeitsmarktes für Sozialberufe beleuchtet. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass interkulturelle Kompetenz in der heutigen Gesellschaft eine wichtige Anforderung für Sozialpädagogen ist.
Im zweiten Kapitel werden theoretische Grundlagen des interkulturellen Lernens erörtert. Es werden verschiedene Konzepte von Kultur und Kommunikation vorgestellt und die Bedeutung von Stereotypen und Vorurteilen im interkulturellen Kontext untersucht. Weiterhin werden verschiedene Definitionen und Merkmale interkultureller Kompetenz erörtert.
Das dritte Kapitel fokussiert auf interkulturelles Training. Es werden verschiedene Modelle und Methoden interkulturellen Trainings vorgestellt und deren didaktische Merkmale und Stärken und Schwächen kritisch beleuchtet. Die Diplomarbeit zeigt, dass interkulturelles Training ein wichtiger Bestandteil der Aus- und Fortbildung von Sozialpädagogen sein kann, um sie für die Herausforderungen einer multikulturellen Gesellschaft zu sensibilisieren und zu qualifizieren.
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit konzentriert sich auf Themen wie Interkulturelle Kompetenz, Multikulturalität, Sozialpädagogik, Ausbildung, Arbeitsmarkt, Kultur, Kommunikation, Stereotype, Vorurteile, interkulturelles Training und didaktische Modelle. Die Arbeit untersucht die Bedeutung interkultureller Kompetenz für die professionelle Tätigkeit von Sozialpädagogen und analysiert die aktuelle Situation und zukünftige Anforderungen in einer zunehmend multikulturellen Gesellschaft. Sie beleuchtet die Notwendigkeit einer gezielten Förderung und Entwicklung interkultureller Kompetenz in der Aus- und Fortbildung von Sozialpädagogen.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist interkulturelle Kompetenz für Sozialpädagogen wichtig?
Aufgrund der Multikulturalität in Deutschland begegnen Sozialpädagogen in Ämtern und Schulen täglich Menschen unterschiedlicher Herkunft. Kompetenz hilft, Kommunikationsstörungen und Vorurteile abzubauen.
Was sind „Kulturstandards“ nach Alexander Thomas?
Kulturstandards sind zentrale Orientierungsmuster, die das Denken und Handeln der Mitglieder einer Kultur prägen und als Maßstab für "normales" Verhalten dienen.
Was ist ein „Kultur-Assimilator“ im Training?
Es ist eine Methode des interkulturellen Trainings, bei der Teilnehmer kritische Interaktionssituationen analysieren, um die Perspektive der fremden Kultur zu verstehen.
Welche Rolle spielt die Körpersprache in der interkulturellen Kommunikation?
Körpersprache vermittelt implizite Botschaften. Missverständnisse entstehen oft, weil Gestik oder Augenkontakt in verschiedenen Kulturen unterschiedliche Bedeutungen haben können.
Reicht Sprachvorbereitung allein für die Arbeit mit Migranten aus?
Nein, Sprachkenntnisse sind nur ein Teil. Ebenso wichtig ist die Reflexion eigener kultureller Muster und die Fähigkeit, Empathie für andere Lebensrealitäten zu entwickeln.
- Citation du texte
- Dipl.-Päd. Bibiane Klaus (Auteur), 2002, Interkulturelle Kompetenz als Anforderung im sozialpädagogischen Bereich und Ziel von Aus- und Fortbildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12629