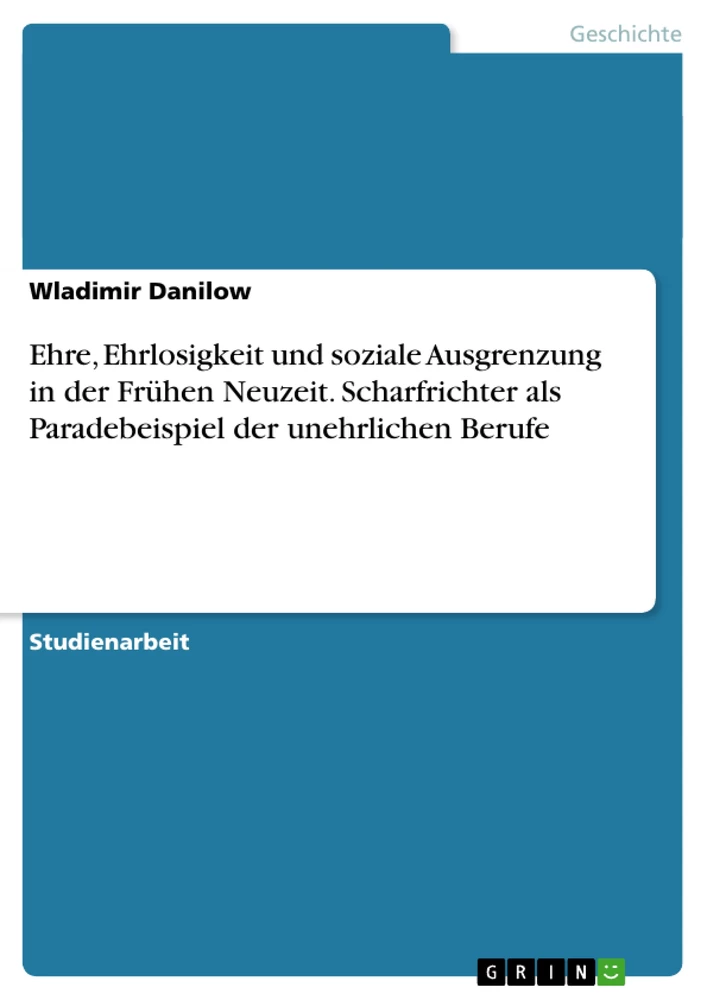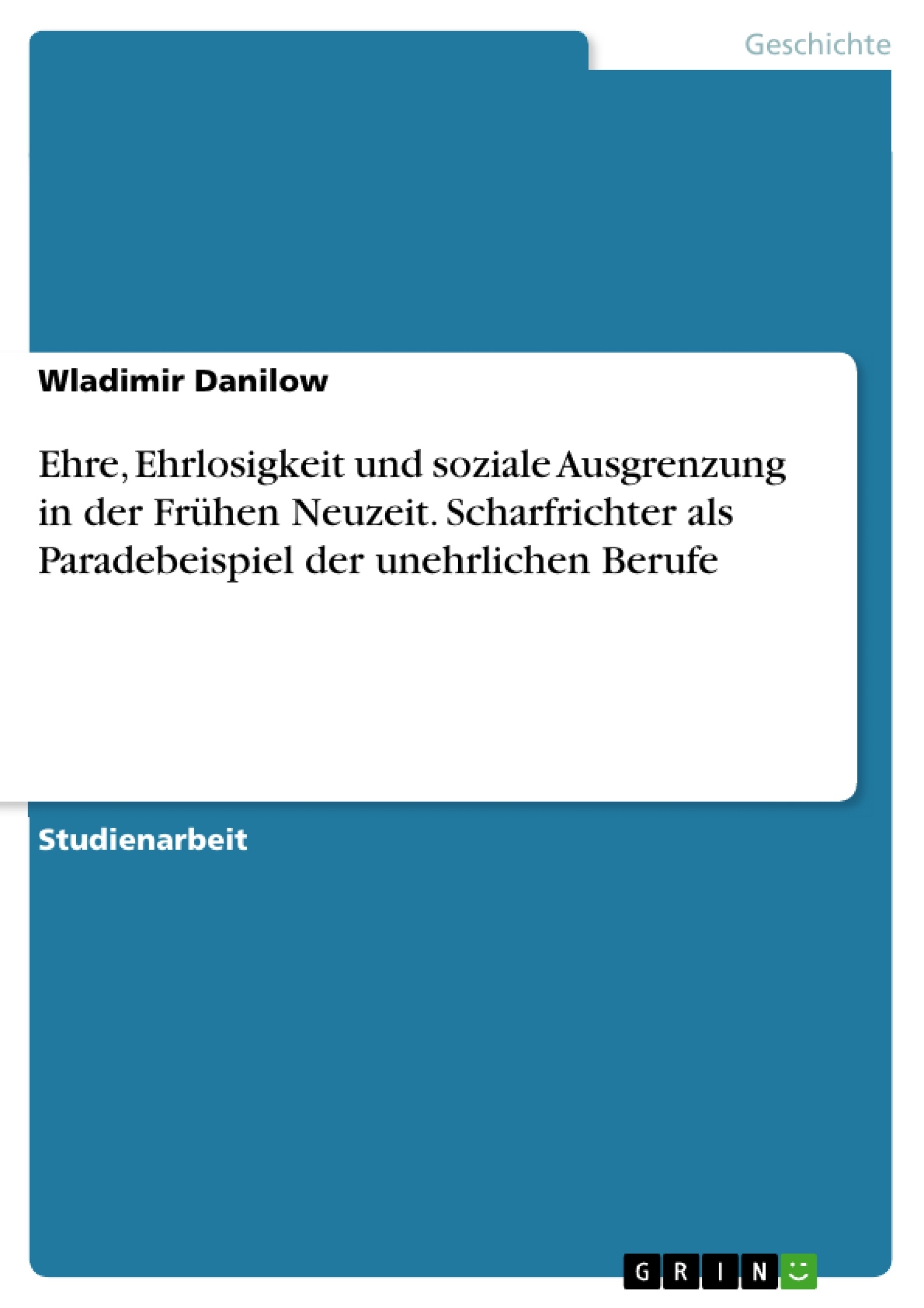Im Mittelalter und der Frühen Neuzeit mußte man weder Dieb noch Betrüger sein, um seine Ehre zu verlieren. Die „Unehrlichkeit“ des Mittelalters und der Frühen Neuzeit hat mit der heutigen Unehrlichkeit wenig gemeinsam. Es war kein moralisches Problem, sondern „eine rechtliche Zurückstellung bestimmter Berufe, verbunden mit sozialer Distanzierung und Verachtung“1. Als „ehrlos“ galten eine Reihe von Berufen, wie zum Beispiel Leineweber, Müller, Töpfer oder Bader. Diese nützlichen und sinnvollen Berufe waren dem Spott und der Verachtung der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Gesellschaft ausgesetzt2. Die Müller waren demnach Diebe und betrieben nebenbei ein Bordell in ihrer Mühle3, ebenso die Schneider, die einen Teil des gelieferten Materials verschwinden ließen4; die Türmer arbeiteten nachts, das machte sie unheimlich und verdächtig5. Das ist nur eine sehr kurze Auswahl an Vorurteilen, mit denen die Angehörigen der „ehrlosen“ Berufe zu kämpfen hatten.
An der Spitze der „unehrlichen“ Gewerbe stand der Beruf des Scharfrichters. Auch unter den Namen Henker, Freimann, Carnifex, Nachrichter, Schinder, Meister Hans oder Züchtiger6 bekannt, war dieser Beruf der Unehrlichste unter den „unehrlichen“ Berufen. Diese Arbeit beschäftigt sich ausschließlich mit dem Beruf des Scharfrichters als dem „Paradebeispiel“ der „unehrlichen“ Berufe.
Die Anfänge des Gewerbes, der Ursprung des professionalisierten Tötens werden im Kapitel Anfänge des Berufs behandelt. Das Kapitel Erklärungsversuche der „Unehrlichkeit“ des Berufs stützt sich hauptsächlich auf die von Jutta Nowosadtko aufgestellten Thesenkomplexe, wie es zu der „Unehrlichkeit“ kam. Das Leben der Scharfrichter gibt Einblicke in den Alltag der Henker, ihre Hauptbeschäftigung, „Nebenjobs“, Stellung innerhalb der Gesellschaft und die Verarbeitung der Ausgrenzung. Im Schlußteil wird auf die teilweise stattgefundene Rehabilitierung und Gleichstellung des Berufs eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Anfänge und Entwicklung des Berufs
- Germanen
- Mittelalterliche Gesellschaft
- Erklärungsversuche der „Unehrlichkeit" des Berufs
- Die rechtsgeschichtliche These
- Die psychologische These
- Die sakral-magische These
- Die rationalistische These
- Das Leben der Scharfrichter
- Aufgaben und Nebenerwerbstätigkeiten
- Gesellschaftliche Stellung
- Reaktionen auf den Ausschluß aus der Gesellschaft
- Schlußteil: Teilweise Rehabilitierung des Berufs
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, wie der Beruf des Scharfrichters in der Frühen Neuzeit zum „Paradebeispiel“ der „unehrlichen“ Berufe wurde und welche Faktoren zu seiner gesellschaftlichen Ausgrenzung führten. Die Analyse konzentriert sich auf die Anfänge und Entwicklung des Berufs sowie auf die verschiedenen Erklärungsansätze für seine „Unehrlichkeit“. Darüber hinaus werden das Leben der Scharfrichter, ihre gesellschaftliche Stellung und die Reaktionen auf ihre Ausgrenzung beleuchtet.
- Die Anfänge und Entwicklung des Scharfrichterberufs in der Geschichte
- Die rechtlichen, psychologischen, sakral-magischen und rationalistischen Thesen, die die „Unehrlichkeit“ des Berufs erklären
- Die Aufgaben, Nebenerwerbstätigkeiten und gesellschaftliche Stellung von Scharfrichtern in der Frühen Neuzeit
- Die Reaktionen der Gesellschaft auf die Ausgrenzung der Scharfrichter
- Die partielle Rehabilitierung des Berufs im Laufe der Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Definition von „Unehrlichkeit“ im Kontext der Frühen Neuzeit und stellt den Beruf des Scharfrichters als ein Paradebeispiel für diese Kategorie dar. Das Kapitel „Anfänge und Entwicklung des Berufs“ betrachtet die Ursprünge des Scharfrichterberufs in germanischen und mittelalterlichen Gesellschaften. Im Kapitel „Erklärungsversuche der „Unehrlichkeit" des Berufs“ werden verschiedene Thesen aus der Rechtsgeschichte, Psychologie, Sakralmagie und Rationalismus diskutiert, die die soziale Ausgrenzung des Scharfrichterberufs zu erklären versuchen. Das Kapitel „Das Leben der Scharfrichter“ beleuchtet den Alltag der Henker, ihre Aufgaben, Nebenerwerbstätigkeiten, gesellschaftliche Stellung und die Verarbeitung der Ausgrenzung. Der Schlussabschnitt beschäftigt sich mit der teilweise stattgefundenen Rehabilitierung und Gleichstellung des Scharfrichterberufs.
Schlüsselwörter
Scharfrichter, Henker, Freimann, Carnifex, Nachrichter, Schinder, Meister Hans, Züchtiger, Unehrlichkeit, Ehre, Ehrlosigkeit, soziale Ausgrenzung, Mittelalter, Frühe Neuzeit, Rechtsgeschichte, Psychologie, Sakralmagie, Rationalismus, Aufgaben, Nebenerwerbstätigkeiten, gesellschaftliche Stellung, Rehabilitierung, Gleichstellung.
Häufig gestellte Fragen
Warum galt der Scharfrichter als „unehrlich“?
Die „Unehrlichkeit“ war kein moralischer Defekt, sondern eine rechtliche Zurücksetzung und soziale Ausgrenzung aufgrund des Berufs, der mit dem Töten und dem Berühren von Unreinem verbunden war.
Welche anderen Berufe galten in der Frühen Neuzeit als unehrlich?
Dazu gehörten unter anderem Abdecker (Schinder), Müller, Leineweber, Töpfer, Bader und Türmer.
Welche Aufgaben hatte ein Scharfrichter neben Hinrichtungen?
Scharfrichter übernahmen oft Nebentätigkeiten wie die Tierkadaverbeseitigung (Abdeckerei), die Folter bei Verhören oder auch medizinische Heilbehandlungen.
Welche Thesen erklären die Entstehung dieser sozialen Ausgrenzung?
In der Forschung werden rechtsgeschichtliche, psychologische, sakral-magische und rationalistische Thesen diskutiert.
Wurde der Beruf des Scharfrichters später rehabilitiert?
Ja, im Laufe der Zeit kam es zu einer teilweisen rechtlichen Gleichstellung und gesellschaftlichen Rehabilitierung des Berufsstandes.
- Arbeit zitieren
- Wladimir Danilow (Autor:in), 2002, Ehre, Ehrlosigkeit und soziale Ausgrenzung in der Frühen Neuzeit. Scharfrichter als Paradebeispiel der unehrlichen Berufe, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12630