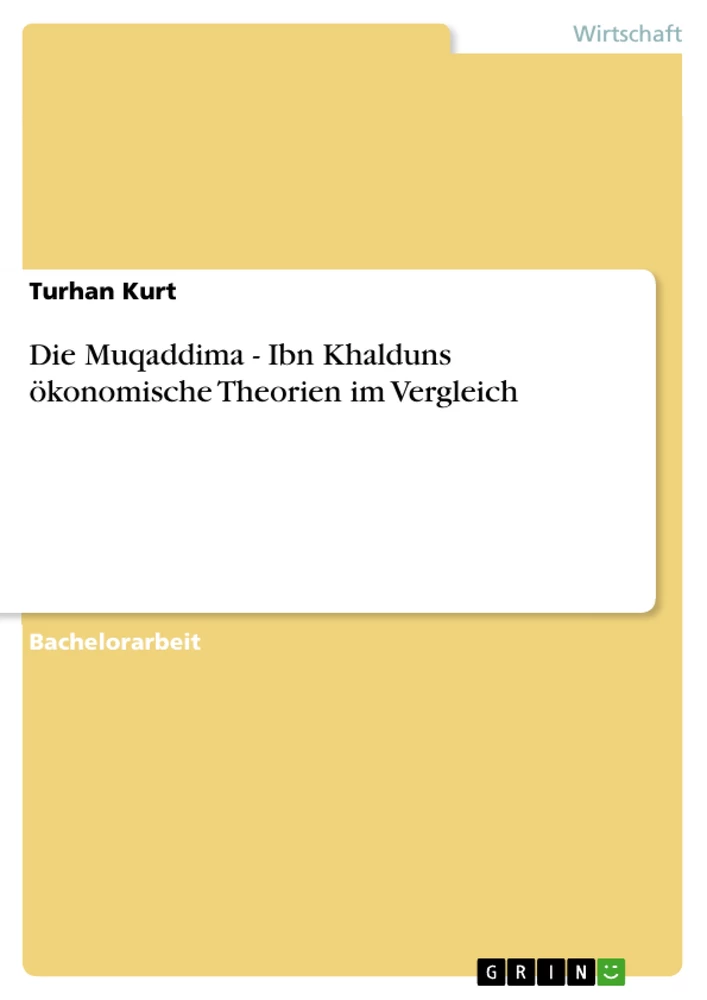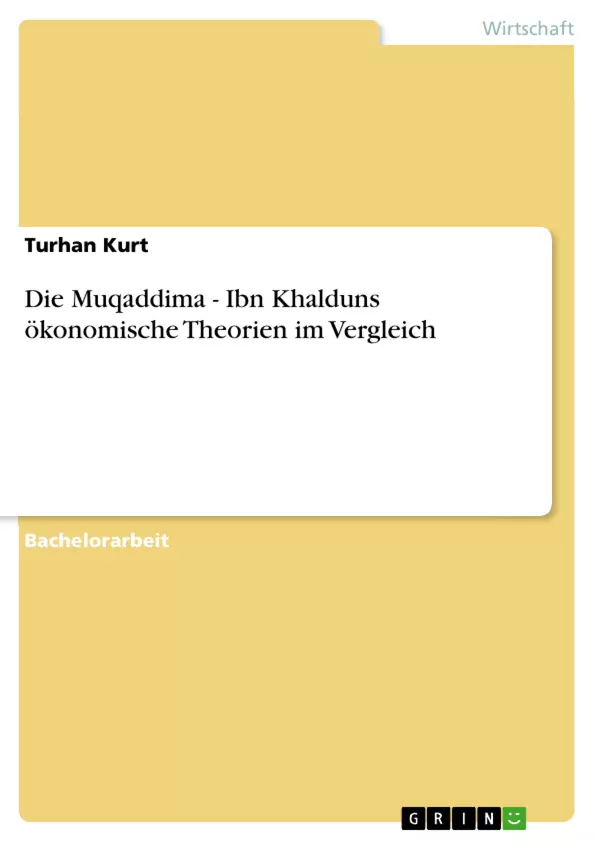Ibn Khaldun war Historiker, Philosoph, Soziologe, Kulturwissenschaftler, Ökonom, Lehrer und Richter. In manchen arabischen Ländern wurde Ibn Khaldun als Feind der arabischen Nation gesehen. Die Feindschaft reicht so weit das man im Irak seine Bücher verbrennen und sein Grab schänden wollte . Ein Grund für diese Haltung war die Beschuldigung seitens Khalduns gegen die Araber. Er beschuldigte die Araber, soweit ihr Macht dazu ausreicht, überall Zerstörung und Ruin zu verursachen und dass Araber nicht viel von Politik, handwerklichen Aktivitäten und der Industrie verstanden.
In der westlichen Welt - vor allem in Deutschland- war er wie viele islamischer Denker und Wissenschaftler nicht bzw. kaum bekannt. Der Grund hierfür hat viele Ursachen, die in dieser Arbeit keine Rolle spielen und daher auch nicht beachtet werden.
Die vorliegende Arbeit hat es sich zur Aufgabe gemacht Ibn Khaldun vorzustellen, seine Thesen zu erläutern und mit der Theorie anderer Ökonomen zu vergleichen. Hierbei werden seine ökonomischen Thesen aus der Muqaddima in den Vordergrund gestellt, die den Hauptteil der Arbeit darstellen. Die in der Vergangenheit verfassten Ausarbeitungen wurden zumeist in türkischer, arabischer und französischer Sprache verfasst, was die Aufarbeitung der Theorien erschwerte und den Informationsumfang einschränkt, hierbei handelt es sich meist um ausgewählte Auszüge aus der Muqaddima. Eine komplette Übersetzung seines Hauptwerks fehlt, zudem gibt es keine genaue Untersuchung zu den ökonomischen Thesen Ibn Khalduns. Ein Versuch über die tunesische und ägyptische Botschaften in Berlin an Informationen über Ibn Khalduns Theorien zu gelangen ist aus verschiedenen Gründen ohne Erfolg verlaufen, auf die nicht weiter eingegangen wird. Weiterhin fehlgeschlagen ist ein Versuch zur Erstellung eines Fragebogens, die der anfangs in Betracht bezogen wurde. Der Fragebogen sollte von Lehrkörpern in der Türkei beantwortet werden; dies scheiterte sowohl an der zeitlichen Begrenzung, als auch an der geographischen Entfernung.
Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Einleitung
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2 Das Leben Ibn Khalduns
- 2.1 Khalduns Werke
- 2.2 Thesen und Aussagen über die Ökonomie
- 2.3 Khaldun und der Staat
- 3 Ökonomie aus islamischer Sicht
- 3.1 Spekulation und Hortung
- 3.2 Handel, Zinsen
- 3.3 Zakat (Armensteuer)
- 4 Khaldun und ökonomisch theoretische Ansätze - ein Vergleich
- 4.1 Die tableau économique von Francois Quesnay
- 4.2 Die Arbeitsteilung von Adam Smith
- 4.3 Staatsintervention nach Adam Smith und David Ricardo
- 4.4 Arbeitswerttheorien
- 5 Khaldun´s Thesen in der heutigen Zeit
- 6 Schlusswort
- Quellennachweis
- Literaturquellen
- Internetquellen
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit den ökonomischen Theorien des arabischen Gelehrten Ibn Khaldun, insbesondere mit seinen Ausführungen in der Muqaddima. Ziel ist es, Ibn Khalduns Thesen zu analysieren, zu erläutern und in den Kontext der islamischen Ökonomie sowie im Vergleich zu klassischen westlichen Wirtschaftstheoretikern zu setzen. Die Arbeit soll einen Beitrag zur Rezeption von Ibn Khalduns Werk in der westlichen Welt leisten und dessen Bedeutung für die Wirtschaftsgeschichte und -theorie aufzeigen.
- Ibn Khalduns ökonomische Thesen in der Muqaddima
- Vergleich mit klassischen Wirtschaftstheoretikern (Adam Smith, David Ricardo)
- Islamische Ökonomie und deren Einfluss auf Ibn Khalduns Denken
- Relevanz von Ibn Khalduns Thesen für die heutige Zeit
- Die Rolle des Staates in der Wirtschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 stellt Ibn Khaldun als Historiker, Philosoph, Soziologe und Ökonom vor. Es werden sein Leben, seine Werke und seine wichtigsten Thesen beleuchtet, wobei ein besonderer Fokus auf seine ökonomischen Ansichten liegt. Das Kapitel schließt mit einer Darstellung seiner Gedanken über den idealen Aufbau des Staates.
Kapitel 3 widmet sich der islamischen Sicht auf die Ökonomie. Es werden zentrale Prinzipien des islamischen Wirtschaftsdenkens, wie z.B. die Ablehnung von Spekulation und Wucher, die Bedeutung des Handels und die Armensteuer (Zakat), anhand von Koransuren erläutert.
Kapitel 4 vergleicht Ibn Khalduns ökonomische Thesen mit den Ansätzen klassischer Wirtschaftstheoretiker wie Adam Smith und David Ricardo. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den verschiedenen Denkschulen aufgezeigt, wobei Ibn Khalduns Rolle als möglicher Vorläufer für die westliche Wirtschafts- und Staatstheorie hervorgehoben wird.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Ibn Khaldun, Muqaddima, islamische Ökonomie, Wirtschaftsgeschichte, Adam Smith, David Ricardo, Arbeitsteilung, Staatsintervention, Zakat, Spekulation, Hortung, Handel, Zinsen, Arbeitswerttheorie.
- Quote paper
- B. A. Turhan Kurt (Author), 2008, Die Muqaddima - Ibn Khalduns ökonomische Theorien im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126351