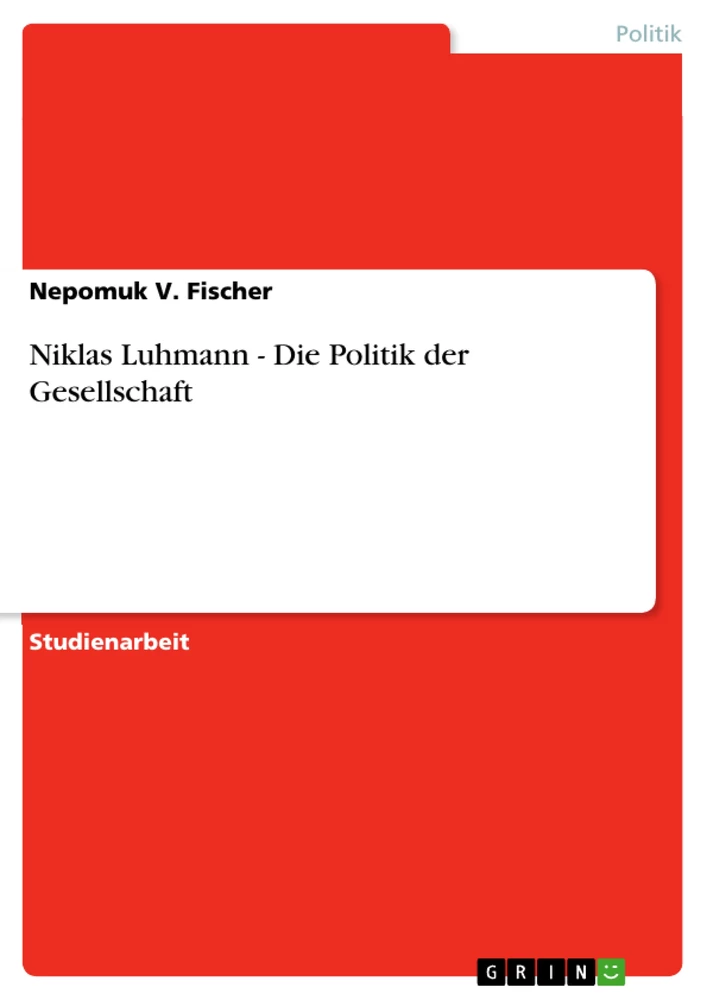Die Bedeutungs- und Beschreibungslehre von Begriffen, sprich: Die Semantik, versuchte nach der französischen Revolution unter Führung der Begriffe wie „Nation“ und „Souveränität“ einen Ersatz für die Monarchie zu finden, die zur Republik geworden war und jetzt ohne einen Monarchen auskommen musste.
Das neue politische System berief sich auf die Rechte und Meinungen der Individuen, auf die Menschenrechte und auf die öffentliche Meinung –
dem volonté générale der Individuen.
Diese Berufung auf die Menschenrechte diente jetzt nicht mehr nur der Einschränkung sondern der Fundierung souveräner Gewalt.
Ein Problem nach der französischen Revolution war, dass die, die vorher Untertanen waren, jetzt die politische Herrschaft innehatten. Diese Volkssouveränität führte zu massiven organisatorischen Problemen, wurde aber durch eine Veränderung des Verständnisses des Begriffs der „Repräsentation“ gelöst.
Aber was bleibt von den Untertanen übrig, wenn man sie emanzipiert, also ihnen ihre Untertänigkeit streicht?
Antwort:
- Nur die Individualität. Der Naturzustand. – Deshalb wird die Natur des Menschen als Freiheit bestimmt.
Wenn auf Merkmale wie Stände oder Nationsherkunft des Individuums verzichtet wird, gibt es nur noch die selbstorganisierte Individualität. Zu dieser gehören z.B. Verträge, Einkünfte oder die Heirat. Also alles Dinge, die man selber beeinflussen kann.
Aber trotz solcher persönlicher Entscheidungen oder wechselnder Umstände bleibt man immer derselbe.
Die notwendige Selbstorganisation des Politischen setzte Mikrodiversität voraus. Diese lies sich damals durch den neuen Begriff der „Population“- später Varietät erklären.
Eine Population besteht aus Individuen, die jedoch durch gemeinsame Merkmale zusammengehören.Da das politische System nach der französischen Revolution von einer indirekten (einer ständischen Ordnung) zu einer direkten Regulierung (des volonté générale) der Individuen übergegangen und die Natur des Menschen als Freiheit, also unterschiedlich bestimmt worden ist, ergeben sich für Luhmann neue Voraussetzungen der Selbstbeschreibung des politischen Systems.
Das Paradox, das Freiheit einerseits Anspruch auf Emanzipation besitzt, andererseits in einem Sozialstaat aber auch als einschränkungsbedürftig gilt, wird gelöst indem man besondere Ansprüche an politische Einschränkungen der Freiheit stellt.
Inhaltsverzeichnis
- Thesen und Schlussfolgerungen aus dem Werk:
- Die Bedeutungs- und Beschreibungslehre von Begriffen, sprich: Die Semantik
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Referat von Nepomuk V. Fischer analysiert Niklas Luhmanns Werk "Die Politik der Gesellschaft" und untersucht die Selbstbeschreibung des politischen Systems im Wandel. Es beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus der Emanzipation der Untertanen und der Einführung der Demokratie ergeben, und analysiert die Rolle von Werten und Diskursen in der Legitimation des politischen Systems.
- Die Selbstbeschreibung des politischen Systems im Wandel
- Die Bedeutung von Werten und Diskursen in der Legitimation
- Das Paradox der Demokratie als Herrschaftsausübung durch die Beherrschten
- Die Rolle von Repräsentation und Souveränität
- Die Herausforderungen der Selbstorganisation des politischen Systems
Zusammenfassung der Kapitel
Das Referat beginnt mit einer Analyse der Semantik von Begriffen wie "Nation" und "Souveränität" nach der französischen Revolution. Es wird deutlich, dass die neue politische Ordnung auf die Rechte und Meinungen der Individuen, auf die Menschenrechte und die öffentliche Meinung berief, um die souveräne Gewalt zu fundieren. Die Emanzipation der Untertanen führte jedoch zu neuen Herausforderungen, da die Natur des Menschen als Freiheit und Individualität definiert wurde. Luhmann argumentiert, dass die Selbstbeschreibung des politischen Systems sich auf die Verfassung beziehen muss, die rechtlich einschränkbare Grundrechte und Verfahrensregelungen formuliert. Die Demokratie als Herrschaftsform wird als Paradoxie der Herrschaftsausübung durch die Beherrschten dargestellt, da das Volk sich selbst befehlen und gehorchen muss.
Das Referat beleuchtet die Veränderungen in der Selbstbeschreibung des politischen Systems im Laufe der Zeit. Im 16. und 17. Jahrhundert genügte der Begriff des "Staates", während im 18. Jahrhundert die Begriffe "Öffentlichkeit" und "öffentliche Meinung" hinzukamen. Diese "weichen" Begriffe ermöglichten dem politischen System größere Freiheitsgrade der Selbstgestaltung und mehr Beweglichkeit in der Reaktion auf wechselnde Anforderungen der Umwelt. Die zunehmende Selbstorganisation verschiedener Teilsysteme der Gesellschaft stellt jedoch das politische System vor neue Herausforderungen. Luhmann argumentiert, dass die Demokratie durch das Repräsentationsprinzip zwar eingeführt wird, aber als Selbstbeschreibungsformel für das politische System dient, mit der sich jede politische Bewegung als demokratisch bezeichnet. Die Demokratie frisst sich in das System ein und erklärt sich schließlich zum "herrenlosen Herrn".
Das Referat beleuchtet die Bedeutung von Werten und Diskursen in der Legitimation des politischen Systems. Luhmann argumentiert, dass Legitimation immer Selbstlegitimation ist, die durch politische Kommunikationen bestimmt wird. Werte ermöglichen eine Neubestimmung anerkannter Leitbegriffe wie Freiheit, Frieden oder Gerechtigkeit und verschleiern den Bruch, der mit dem Übergang in die moderne Gesellschaft eingetreten war. Werte sind Präferenzen, die jeder akzeptiert und bilden das Gerüst, in das politische Projektionen hineinformuliert werden. Die Unterscheidung von Wert und Gegenwert bezeichnet man als Fremdreferenz des politischen Systems, während die Unterscheidung der Werte voneinander als Selbstreferenz bezeichnet wird. Die Legitimationssemantik der Werte führt eine selbsterzeugte Ungewissheit in das System ein, da durch das Bekenntnis zu den Werten die Unsicherheit darüber akzeptiert wird, was dabei rauskommt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Selbstbeschreibung des politischen Systems, die Emanzipation der Untertanen, die Demokratie als Herrschaftsform, die Rolle von Werten und Diskursen in der Legitimation, die Herausforderungen der Selbstorganisation des politischen Systems und die Bedeutung von Repräsentation und Souveränität.
Häufig gestellte Fragen
Wie analysiert Niklas Luhmann die Politik der Gesellschaft?
Luhmann betrachtet die Politik als ein funktional differenziertes Teilsystem der Gesellschaft, das sich durch die Kommunikation von Macht und die Herstellung kollektiv bindender Entscheidungen reproduziert.
Was bedeutet 'Emanzipation der Untertanen' in Luhmanns Theorie?
Nach der französischen Revolution wurden Untertanen zu Bürgern. Dies führte dazu, dass politische Herrschaft nun durch die Beherrschten selbst (Volkssouveränität) legitimiert werden musste, was Luhmann als Paradoxon beschreibt.
Welche Rolle spielen Werte in der politischen Legitimation?
Werte wie Freiheit oder Gerechtigkeit dienen als Selbstreferenz des Systems. Sie ermöglichen es, politische Entscheidungen als moralisch richtig darzustellen und Unsicherheiten im System zu verschleiern.
Was versteht Luhmann unter der 'Paradoxie der Demokratie'?
Die Demokratie ist eine Herrschaftsform, bei der das Volk gleichzeitig Befehlender und Gehorchender ist. Dieses Paradox wird durch Verfahren wie Wahlen und Repräsentation operativ gelöst.
Wie hat sich die politische Semantik seit dem 18. Jahrhundert gewandelt?
Begriffe wie 'öffentliche Meinung' und 'Menschenrechte' wurden zentral, um die souveräne Gewalt nicht mehr nur einzuschränken, sondern sie auf dem Willen der Individuen zu fundieren.
- Arbeit zitieren
- Dipl.sc.pol.Univ. Nepomuk V. Fischer (Autor:in), 2005, Niklas Luhmann - Die Politik der Gesellschaft, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126398