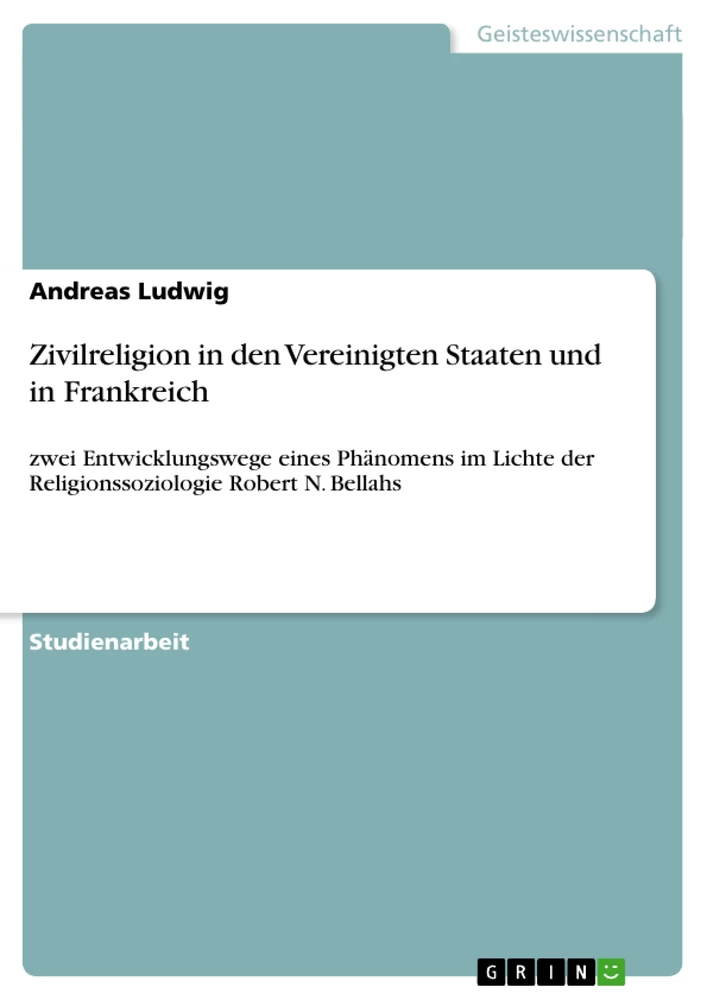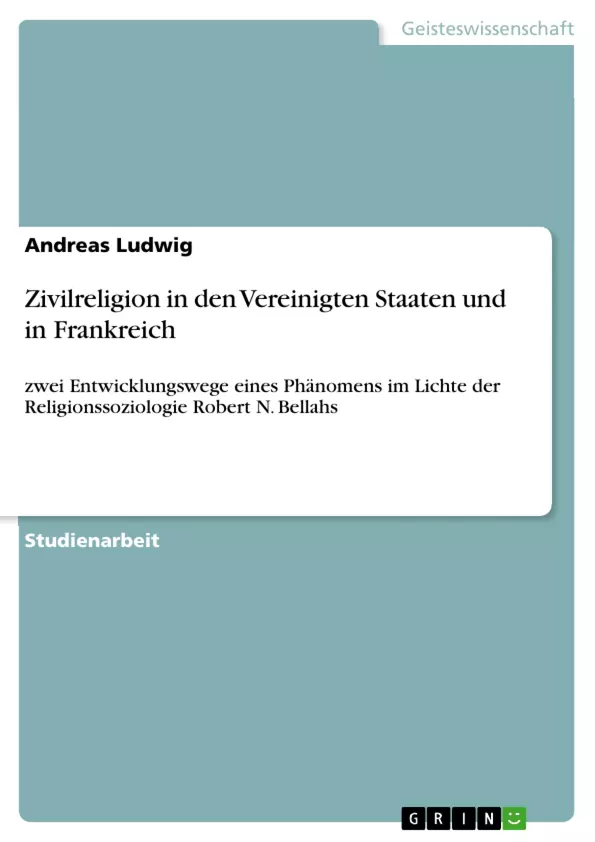Am Beginn des 21. Jahrhunderts gewinnt die Religiosität als Faktor gesellschaftlichen Zusammenlebens neue Vitalität. Vorbei die Zeiten, in denen man vor allem in Europa die Überwindung des Religiösen zum Kennzeichen der Modernität einer Gesellschaft erhoben hat. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus ist sowohl in den ehemaligen Ostblockstaaten als auch darüber hinaus – sei es in Asien, Lateinamerika, aber auch Europa – ein Wiedererstarken religiöser Bindungen zu konstatieren. Freilich bedeutet dies gerade in den westlichen Gesellschaften keine Rückkehr zum status ante der Aufklärung, viel mehr passt sich das Religiöse an neue Gegebenheiten des gesellschaftlichen Wandels an und findet so jenseits traditioneller Institutionen, Riten und Moralmuster seinen Weg zurück in das Leben der Individuen: „Religion hat die Modernisierung überlebt und es ist anzunehmen, dass sie auch die Moderne überleben wird.“ Während die Religion nicht im Verschwinden begriffen ist, so ist sie dennoch einem Prozess der Individualisierung und Privatisierung unterworfen, der ihrer normativen Einwirkungsmöglichkeit auf die Gesellschaft als Ganzes aus diesem Blickwinkel heraus Grenzen setzt.
Moderne und Religiosität lassen sich also allem Anschein nach im privatem, dem Individuum zur Selbstgestaltung offenen Raum, durchaus verbinden. Das empirische Fortbestehen religiöser Symbolik und Ausdrucksformen im gemeinschaftlichen Leben eines Staates – wie sie sich im Einzelfall auch darstellen mögen – macht aber auch deutlich, dass die religiöse Dimension niemals gänzlich aus der öffentlichen Sphäre gebannt werden konnte – auch wenn dies sicherlich im Falle einzelner Konfessionen geschehen sein mag. „Das Religiöse ist in der säkularen Moderne nicht abgegolten, vielmehr scheint sich wieder eine neue Balance zwischen Religion und Politik abzuzeichnen. Religion als öffentliche Privatsache lässt sich jedenfalls nicht länger unterdrücken.“
So betrachtet haben wir es weniger mit einem Prozess der allgemeinen Säkularisierung zu tun, als viel mehr einem der Entkonfessionalisierung – also der Distanzierung von einer einzelnen Norm oder Moralüberzeugung, hin zur Akzeptanz einer Pluralität, die jedoch ergänzt wird durch einen religiös gearteten Konsens in der Gesellschaft, der auf ein Muster von öffentlichen Glaubenssätzen, Symbolen und Ritualen zurückgreift, was der US-amerikanische Soziologe Robert N. BELLAH, in Anlehnung an die Wortschöpfung Jean-Jacques ROUSSEAUS, Zivilreligion genannt hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- I. Zwischen religion civile und Bürgerreligion – die Theorie der Zivilreligion
- 1. Grundlagen des religionssoziologischen Konzeptes der Zivilreligion
- 2. Robert N. BELLAHS Beitrag zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit diesem Phänomen
- II. Zivilreligion beiderseits des Atlantiks - Vergleichsansätze ihrer Ausprägung in den Vereinigten Staaten und in Frankreich
- 1. Philosophische und historische Fundamente der Zivilreligion
- 2. Times of trial und Stabilisierung des Phänomens in beiden Staaten
- 3. Entwicklungen nach der Krise beider Zivilreligionen im 20. Jahrhundert
- III. Perspektiven und Herausforderungen – die Zivilreligion zwischen Stagnation und Revitalisierung
- 1. Neue Vitalität eines alten Konzepts: die Zivilreligion in den Vereinigten Staaten nach dem 11. September
- 2. Herausforderung von Republik und Laizität: Frankreichs Zivilreligion angesichts neuer gesellschaftlicher und politischer Umstände
- Abschluss
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Phänomen der Zivilreligion und analysiert dessen Entwicklung in den Vereinigten Staaten und Frankreich. Ziel ist es, die beiden Ausprägungen dieses Phänomens im Lichte der Religionssoziologie Robert N. Bellahs zu vergleichen und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede aufzuzeigen.
- Die Entwicklung der Zivilreligion in den Vereinigten Staaten und Frankreich
- Die Rolle von Robert N. Bellah in der Theorie der Zivilreligion
- Die philosophischen und historischen Grundlagen der Zivilreligion in beiden Ländern
- Die Stabilisierungsprozesse und Krisen der Zivilreligion im 20. Jahrhundert
- Die Perspektiven und Herausforderungen der Zivilreligion im 21. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Zivilreligion im Kontext der modernen Gesellschaft dar und führt in die Thematik ein. Kapitel I beleuchtet die Theorie der Zivilreligion, insbesondere den Beitrag von Robert N. Bellah, und analysiert die Grundlagen des religionssoziologischen Konzeptes. Kapitel II vergleicht die zivilreligiösen Ausprägungen in den Vereinigten Staaten und Frankreich anhand dreier Vergleichsansätze: die historisch-philosophischen Grundlagen, die Stabilisierungsprozesse und die Entwicklungen nach den Krisen im 20. Jahrhundert. Kapitel III befasst sich mit den Perspektiven und Herausforderungen der Zivilreligion in beiden Ländern im 21. Jahrhundert. Der Abschluss fasst die Ergebnisse des Vergleichs zusammen und stellt die Zivilreligion im Kontext des analytischen Vorgehens Bellahs dar.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Zivilreligion, Robert N. Bellah, die Vereinigten Staaten, Frankreich, Religionssoziologie, gesellschaftlicher Wandel, politische Kultur, Säkularisierung, Entkonfessionalisierung, religiöse Symbolik, Staatsreligion, Glaubensfreiheit, Philosophie, Geschichte, Krisen, Revitalisierung, Stagnation.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Begriff Zivilreligion?
Zivilreligion bezeichnet einen religiös gearteten Konsens in einer Gesellschaft, der auf öffentlichen Glaubenssätzen, Symbolen und Ritualen basiert, unabhängig von traditionellen Konfessionen.
Welchen Beitrag leistete Robert N. Bellah zur Theorie der Zivilreligion?
Bellah entwickelte das religionssoziologische Konzept der Zivilreligion weiter und analysierte es insbesondere am Beispiel der Vereinigten Staaten.
Wie unterscheidet sich die Zivilreligion in den USA von der in Frankreich?
Die Arbeit vergleicht die philosophischen und historischen Grundlagen beider Länder, wobei in Frankreich Konzepte wie Laizität und Republik eine zentrale Rolle spielen.
Was bedeutet Entkonfessionalisierung in diesem Kontext?
Es beschreibt die Distanzierung von einzelnen kirchlichen Normen hin zur Akzeptanz einer Pluralität, die durch einen zivilreligiösen Basiskonsens ergänzt wird.
Welche Rolle spielte der 11. September für die US-Zivilreligion?
Nach dem 11. September kam es in den USA zu einer Revitalisierung zivilreligiöser Symbole und einer neuen Vitalität des Konzepts im öffentlichen Raum.
- Arbeit zitieren
- Andreas Ludwig (Autor:in), 2009, Zivilreligion in den Vereinigten Staaten und in Frankreich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126438