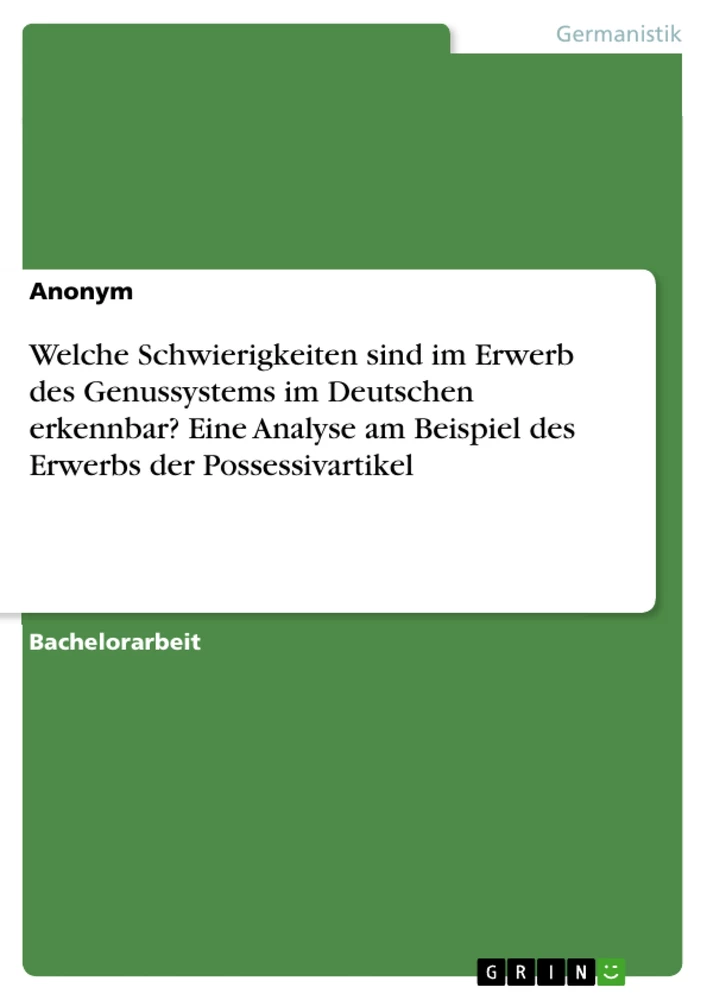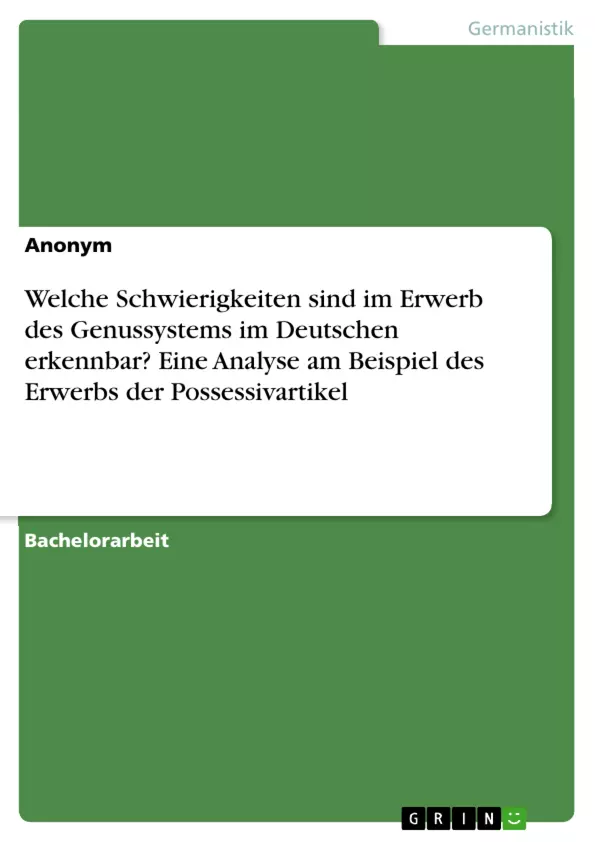Diese Arbeit umfasst eine Untersuchung zum Erwerb des Genussystems deutschsprachiger Kinder im Spracherwerbsprozess am Beispiel des Possessivartikels. Für die Untersuchung wurde das Leo-Korpus der Datenbank CHILDES genutzt.
Der Erwerb des Genussystems ist ein interessantes Phänomen, da Kinder die Zuweisung der Genera zwar einerseits recht früh weitgehend fehlerfrei beherrschen, einige Forscher das Genus jedoch als eine der wesentlichsten Lernschwierigkeiten der deutschen Grammatik ansehen. Es ist durchaus relevant, dass Kinder Substantiven das korrekte Genus verlässlich zuordnen können, denn im Deutschen besteht ein durchschnittlicher gesprochener Satz beinahe zu 60% aus Nomina, denen jeweils eines der drei Genera (Maskulinum, Femininum, Neutrum) als inhärentes Merkmal anhaftet. Zudem stellt die korrekte Verwendung von Genera eine bedeutende Funktion bei der Bildung komplexer und hierarchisch gegliederter Nominalphrasen dar. Dies zu beherrschen ist eine wichtige Voraussetzung "für die Aneignung sprachlicher Kompetenz und den Erfolg im Bildungssystem", weshalb dieser komplexe Teil der Grammatik durchaus eine Relevanz für den gesamten Spracherwerbsprozess aufweist. Trotzdem wird das Genus der Substantive in Schul- und Sprachbüchern für muttersprachlichen Unterricht in der Regel nicht behandelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grammatische Grundlagen
- Das Genus als grammatische Kategorie
- Genuserwerb und mögliche Muster der Genuszuweisung
- Funktionen von Genera
- Die Artikelwörter
- Die Artikelvielfalt der deutschen Sprache
- Possessivartikel
- Das Genus als grammatische Kategorie
- Schwierigkeiten des Erwerbsprozesses
- Analyse am Beispiel des Erwerbs der Possessivartikel
- Methodik und Datengrundlage
- Analyse der Daten
- Übergeneralisierungen und konkrete fehlerhafte Markierungen
- Übertragbarkeit der Ergebnisse auf in der Forschung beobachtete Schwierigkeiten des Erwerbsprozesses
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Schwierigkeiten, die Kinder beim Erwerb des deutschen Genussystems erleben. Sie untersucht das Phänomen des Genuserwerbs anhand des Beispiels der Possessivartikel und untersucht die Herausforderungen, die mit der Zuweisung des richtigen Geschlechts zu Substantiven verbunden sind. Die Arbeit konzentriert sich auf die Frage, welche konkreten Schwierigkeiten Kinder beim Erwerb des Possessivartikels erleben und ob diese mit den bekannten Problemen des Erwerbs des bestimmten Artikels übereinstimmen.
- Analyse der Herausforderungen beim Erwerb des Genussystems
- Untersuchung des Erwerbsprozesses der Possessivartikel
- Vergleich mit bereits bekannten Problemen des Genuserwerbs
- Identifizierung möglicher Erwerbsmuster
- Bedeutung des Genuserwerbs für die sprachliche Kompetenz
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in das Thema des Genuserwerbs und beleuchtet die Relevanz dieses Bereichs für den gesamten Spracherwerbsprozess. Kapitel 2 stellt die grammatischen Grundlagen für die weitere Arbeit dar, indem es die grammatische Kategorie Genus und das Artikelsystem des Deutschen erläutert. Dabei werden die verschiedenen Funktionen von Genera und die Bedeutung der Artikel für die Bildung von Nominalphrasen hervorgehoben.
Kapitel 3 befasst sich mit den Schwierigkeiten, die im Zusammenhang mit dem Genuserwerb auftreten können. In Kapitel 4 werden die Ergebnisse einer empirischen Analyse der Possessivartikel im Leo-Korpus der CHILDES-Datenbank präsentiert. Die Analyse untersucht übergeneralisierte Formen und konkrete Genusfehler und versucht, aus diesen Erkenntnissen zu schließen, welche Schwierigkeiten Kinder beim Erwerb des Possessivartikels erleben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Genuserwerb, Possessivartikel, Artikelsystem, Genuszuweisung, Sprachentwicklung, Übergeneralisierung, Fehleranalyse, CHILDES-Datenbank, Leo-Korpus.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist der Erwerb des Genussystems im Deutschen so schwierig?
Das Deutsche hat drei Genera (Maskulinum, Femininum, Neutrum), deren Zuweisung oft keinen logischen Regeln folgt, was besonders beim Erwerb von Artikelwörtern zu Fehlern führt.
Was sind typische Fehler beim Erwerb von Possessivartikeln?
Kinder neigen zu Übergeneralisierungen, bei denen sie eine Genusmarkierung (z.B. „mein“ für alles) auf alle Substantive übertragen, bevor sie die korrekte Kongruenz beherrschen.
Welche Rolle spielt das Genus für die sprachliche Kompetenz?
Die korrekte Verwendung ist essenziell für die Bildung komplexer Nominalphrasen und gilt als Indikator für den Erfolg im Bildungssystem und die allgemeine Sprachbeherrschung.
Ab wann beherrschen Kinder das Genussystem weitgehend fehlerfrei?
Obwohl erste Zuweisungen sehr früh erfolgen, zieht sich der vollständige, fehlerfreie Erwerb komplexer Formen wie der Possessivartikel oft über mehrere Jahre hinweg.
Was ist das Leo-Korpus der CHILDES-Datenbank?
Es ist eine wissenschaftliche Datensammlung, die den natürlichen Spracherwerb eines Kindes über einen längeren Zeitraum dokumentiert und für linguistische Analysen genutzt wird.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2021, Welche Schwierigkeiten sind im Erwerb des Genussystems im Deutschen erkennbar? Eine Analyse am Beispiel des Erwerbs der Possessivartikel, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1264496