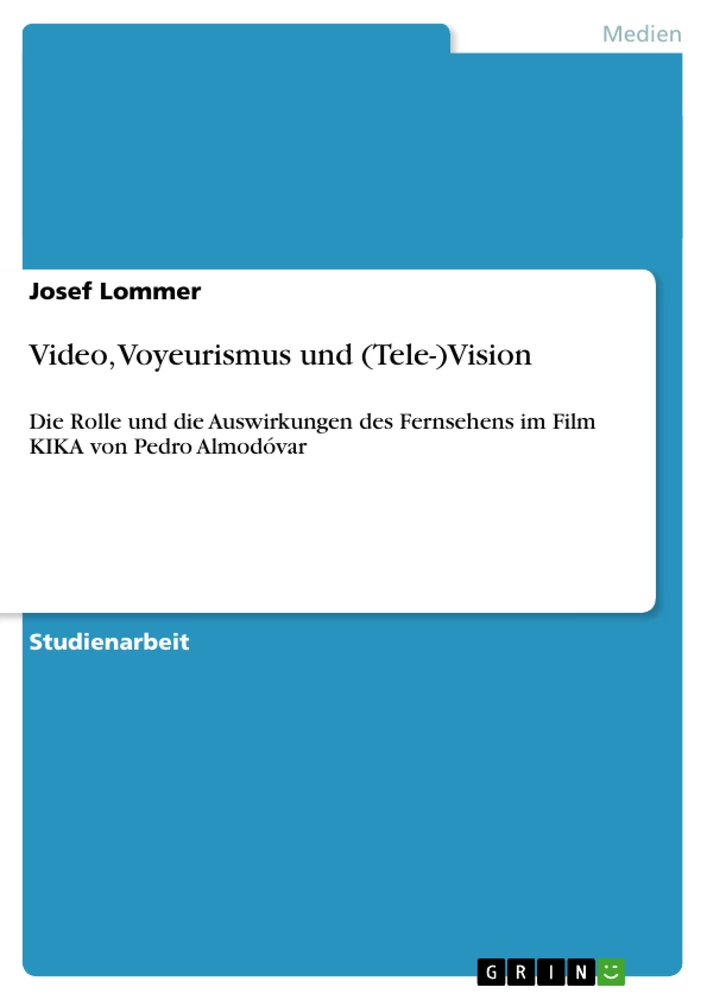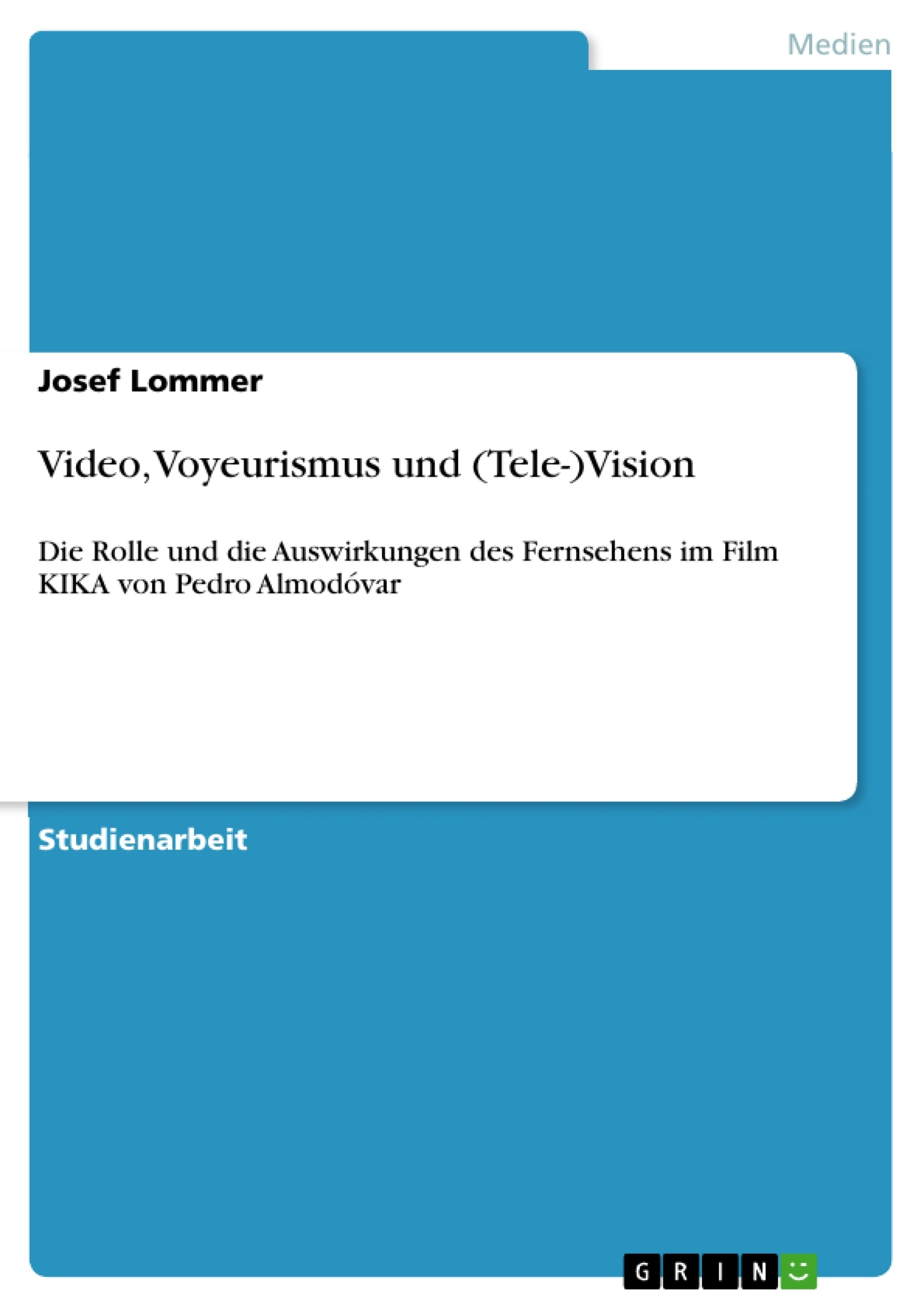Ziel dieser Seminararbeit ist es, anhand der Medientheorien von Paul Virilio und Jean Baudrillard die Rolle des Fernsehens im Film KIKA genauer zu untersuchen. Dabei soll vorrangig auf die Strukturen des Realitätsfernsehens und seine Folgen für die Figuren eingegangen werden. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf den Auswirkungen für Wahrnehmung und Körper liegen. Ergänzend dazu soll ein Überblick über das Werk des spanischen Regisseurs Pedro Almodóvar die nachfolgenden Untersuchungen in einen Kontext einbetten und zum besseren Verständnis beitragen.
Als Primärliteratur dienen hierfür die Werke „Die Sehmaschine“ von Paul Virilio, sowie „Videowelt und fraktales Subjekt“ von Jean Baudrillard. Sämtliche Timecode-Angaben beziehen sich auf die deutsche Synchronfassung von KIKA. Die zusätzlich verwendete Sekundärliteratur wird in der üblichen Zitationsweise des Lehrstuhls für Medienwissenschaft der Universität Regensburg per Fußnote in Kurzform und in der Bibliographie in Langform angegeben.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Videos, Voyeure und (Tele-)Vision: Almodóvars KIKA
- 1. Pedro Almodóvar und das Fernsehen
- 1.1 Televisuelle Strukturen in Almodóvars Gesamtwerk
- 1.2 Das televisuelle Labyrinth in KIKA
- 1.2.1 Die Symbolik der Formen
- 1.2.2 „Hay que leer mas“
- 1.2.3 „Lo peor del día“
- 2. Die Umkehrung der Wahrnehmung – Paul Virilio und KIKA
- 2.1 „Jetzt nehmen mich die Gegenstände wahr“ – Virilios Sehmaschinen
- 2.2 „Fusion/Konfusion“ in KIKA
- 2.2.1 Die „Fusion/Konfusion“ der Perspektive
- 2.2.2 Die „Fusion/Konfusion“ der Zeit und der Realität
- 3. Von Bildschirmen und Prothesen - Jean Baudrillard und KIKA
- 3.1 Körper und Maschine bei Baudrillard
- 3.2 Kika und ihre Videowelt
- 3.2.1 Der Maschinen-Mensch
- 3.2.2 Der Bildschirm und der fraktale Körper
- III. Schluss
- IV. Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Rolle des Fernsehens im Film KIKA von Pedro Almodóvar unter Verwendung der Medientheorien von Paul Virilio und Jean Baudrillard. Der Fokus liegt auf den Strukturen des Realitätsfernsehens, seinen Auswirkungen auf die Figuren des Films und den Folgen für Wahrnehmung und Körper. Die Arbeit bettet die Analyse in einen Überblick über Almodóvars Werk ein.
- Die Darstellung des Fernsehens und der Medien in Almodóvars Gesamtwerk.
- Analyse der „Fusion/Konfusion“ von Wahrnehmung und Realität im Film KIKA.
- Die Auswirkungen des Realitätsfernsehens auf die Figuren und deren Körper.
- Anwendung der Theorien von Virilio und Baudrillard auf die filmische Darstellung.
- Die kritische Betrachtung einer medialisierten Gesellschaft in KIKA.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung beginnt mit der Erwähnung des Films „Der Riese“, der Überwachungsvideos aus deutschen Städten zeigt und die Subjektivierung der Maschine thematisiert. Sie stellt den voyeuristischen Akt des Zuschauers in den Mittelpunkt und führt über den Vergleich mit Reality-TV zur zentralen Rolle des Fernsehens in Almodóvars Werk, insbesondere in KIKA, welches als eine satirische, kritische Betrachtung einer medialisierten Gesellschaft vorgestellt wird. Die Arbeit skizziert die Zielsetzung und Methodik, basierend auf den Theorien von Virilio und Baudrillard.
II. Videos, Voyeure und (Tele-)Vision: Almodóvars KIKA: Dieses Kapitel analysiert die Rolle des Fernsehens in Almodóvars Filmen im Allgemeinen und in KIKA im Besonderen. Es untersucht die televisuellen Strukturen in Almodóvars Gesamtwerk und beleuchtet die spezifischen televisuellen Elemente in KIKA. Die Arbeit analysiert die Umkehrung der Wahrnehmung nach Virilio und die „Fusion/Konfusion“ von Perspektive, Zeit und Realität im Film. Schließlich werden Baudrillards Theorien zu Körper und Maschine sowie deren Anwendung auf Kika und deren Videowelt erörtert.
Schlüsselwörter
Pedro Almodóvar, KIKA, Fernsehen, Medientheorien, Paul Virilio, Jean Baudrillard, Reality-TV, Voyeurismus, Wahrnehmung, Körper, Medien, Simulation, Medialisierung, Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen zu: Seminararbeit über Pedro Almodóvars KIKA
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert die Rolle des Fernsehens und der Medien im Film "KIKA" von Pedro Almodóvar. Der Fokus liegt dabei auf den Strukturen des Realitätsfernsehens, seinen Auswirkungen auf die Figuren und die Folgen für Wahrnehmung und Körper. Die Analyse wird mit Hilfe der Medientheorien von Paul Virilio und Jean Baudrillard durchgeführt.
Welche Theorien werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Medientheorien von Paul Virilio und Jean Baudrillard. Virilios Konzept der "Sehmaschinen" und die "Fusion/Konfusion" von Wahrnehmung und Realität werden ebenso angewendet wie Baudrillards Theorien zu Körper und Maschine in Bezug auf die medialisierte Welt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel ("Videos, Voyeure und (Tele-)Vision: Almodóvars KIKA"), einen Schlussteil und ein Quellenverzeichnis. Das Hauptkapitel untersucht die televisuellen Strukturen in Almodóvars Gesamtwerk, analysiert die spezifischen televisuellen Elemente in KIKA und wendet die Theorien von Virilio und Baudrillard auf den Film an.
Welche Aspekte von KIKA werden im Detail analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf die Darstellung des Fernsehens und der Medien in Almodóvars Gesamtwerk und insbesondere in KIKA. Es werden die "Fusion/Konfusion" von Wahrnehmung und Realität, die Auswirkungen des Realitätsfernsehens auf die Figuren und deren Körper sowie die kritische Betrachtung einer medialisierten Gesellschaft untersucht.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Pedro Almodóvar, KIKA, Fernsehen, Medientheorien, Paul Virilio, Jean Baudrillard, Reality-TV, Voyeurismus, Wahrnehmung, Körper, Medien, Simulation, Medialisierung, Gesellschaft.
Welche Kapitelzusammenfassung wird gegeben?
Die Einleitung stellt den Film "KIKA" als satirische, kritische Betrachtung einer medialisierten Gesellschaft vor und skizziert die Methodik. Das Hauptkapitel analysiert die Rolle des Fernsehens in Almodóvars Filmen im Allgemeinen und in KIKA im Besonderen, unter Anwendung der Theorien von Virilio und Baudrillard. Die Arbeit endet mit einem Schlussteil und einem Quellenverzeichnis.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Rolle des Fernsehens in Almodóvars Film KIKA zu untersuchen und die Auswirkungen des Realitätsfernsehens auf die Figuren und deren Wahrnehmung zu analysieren. Die Anwendung der Theorien von Virilio und Baudrillard dient dazu, eine kritische Betrachtung der medialisierten Gesellschaft im Film zu ermöglichen.
- Citar trabajo
- Josef Lommer (Autor), 2009, Video, Voyeurismus und (Tele-)Vision , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126488