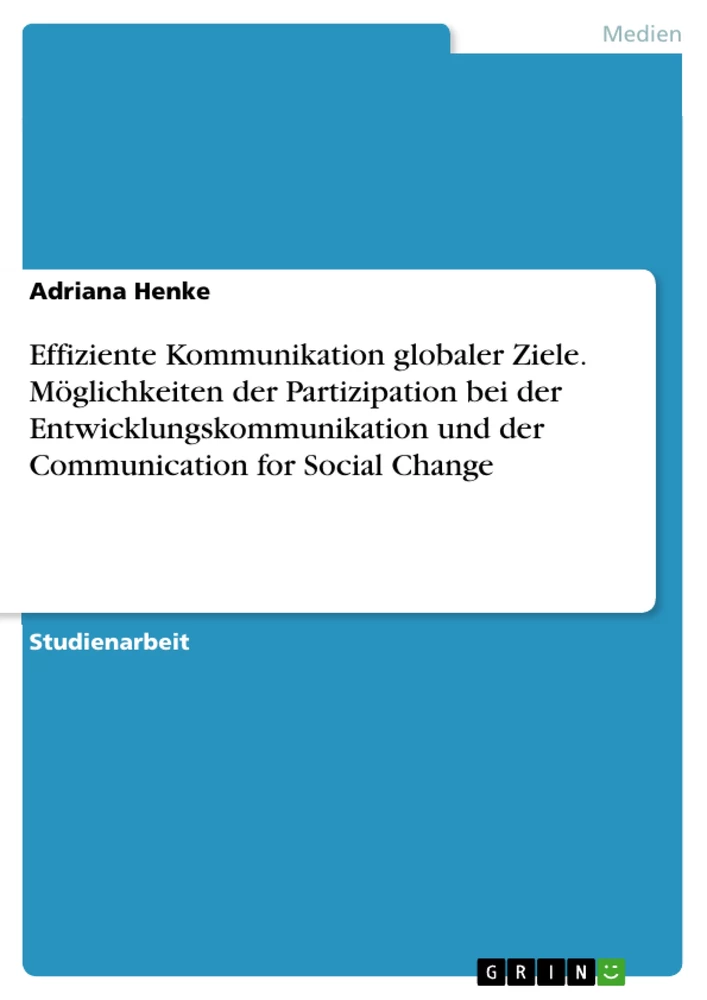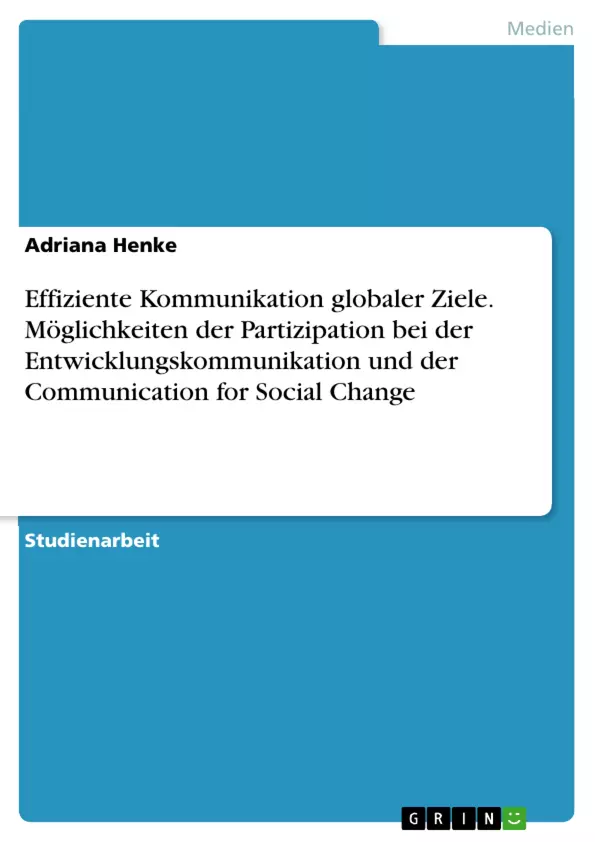Wie können globale Ziele effizient kommuniziert werden? Mit der Verabschiedung der Agenda 2030 am 25. September 2015 richten sich die 17 festgelegten Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen (UN) an alle Länder dieser Welt. Diese universelle Gültigkeit ruft die Frage nach der Umsetzung dieser Ziele hervor. Bereits seit den 1970er Jahren wird die Kommunikation für Entwicklungsthemen erforscht. Inwiefern also die Kernbotschaften der Agenda 2030 kommuniziert werden können, soll durch einen Vergleich der beiden Kommunikationsansätze Entwicklungskommunikation und Communication for Social Change herauskristallisiert werden.
Im Hinblick auf diese Herausforderung hat sich Communication for Social Change (C4SC) als Kommunikationsansatz etabliert. Dieser soll mit der vorliegenden Arbeit, genau wie Entwicklungskommunikation, im Detail betrachtet und diskutiert werden. Dabei stehen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Kommunikationsansätze im Fokus. Aufgrund der zunehmenden Bedeutung von Partizipation im Kontext der Kommunikations- und Medienwissenschaft soll der Fokus des Vergleichs vor allem auf der Partizipationsmöglichkeit liegen. So lautet die Fragestellung dieser Arbeit wie folgt: Inwiefern differenzieren sich Entwicklungskommunikation und Communication for Social Change hinsichtlich ihrer Partizipationsmöglichkeit?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Definition Entwicklungskommunikation
- Definition Communication for Social Change
- Definition Partizipation
- Gegenüberstellung der beiden Ansätze
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert und vergleicht die beiden Kommunikationsansätze Entwicklungskommunikation und Communication for Social Change hinsichtlich ihrer Partizipationsmöglichkeit. Der Fokus liegt auf der Frage, inwiefern sich die beiden Ansätze in Bezug auf die Einbeziehung von Akteuren und deren Mitgestaltung von Entwicklungsprozessen unterscheiden.
- Definition und historische Entwicklung der Entwicklungskommunikation
- Die Bedeutung von Partizipation im Kontext von Entwicklungskommunikation
- Definition und Charakteristika von Communication for Social Change
- Partizipationsmöglichkeiten im Rahmen von Communication for Social Change
- Vergleich und Gegenüberstellung der beiden Ansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der globalen Nachhaltigkeitsziele ein und erläutert die Relevanz des Vergleichs von Entwicklungskommunikation und Communication for Social Change. Die Fragestellung der Arbeit wird formuliert und die Vorgehensweise des Vergleichs skizziert.
Theoretische Grundlagen
Dieses Kapitel beleuchtet die Definitionen und theoretischen Grundlagen der Entwicklungskommunikation und Communication for Social Change sowie des Begriffs Partizipation. Die verschiedenen Ansätze und Modelle der Entwicklungskommunikation, wie die Modernisierungstheorie, das Diffusionsmodell und die Dependenztheorie, werden vorgestellt.
Schlüsselwörter
Entwicklungskommunikation, Communication for Social Change, Partizipation, Sustainable Development Goals (SDGs), Agenda 2030, Modernisierungstheorie, Diffusionsmodell, Dependenztheorie, Partizipatorische Ansätze, „Top-Down“-Perspektive, „Bottom-up“-Perspektive, Kommunikations- und Medienwissenschaft
Häufig gestellte Fragen
Wie können globale Ziele (SDGs) effizient kommuniziert werden?
Die Arbeit vergleicht hierzu die Ansätze der klassischen Entwicklungskommunikation mit dem Konzept der „Communication for Social Change“ (C4SC).
Was ist der Hauptunterschied zwischen den beiden Kommunikationsansätzen?
Der Hauptunterschied liegt in der Partizipationsmöglichkeit: Während Entwicklungskommunikation oft „Top-Down“ agiert, setzt C4SC auf „Bottom-Up“-Prozesse und Mitgestaltung.
Welche Rolle spielt die Agenda 2030 in dieser Arbeit?
Die Agenda 2030 und die 17 Sustainable Development Goals (SDGs) bilden den aktuellen Rahmen für die Notwendigkeit effizienter globaler Kommunikation.
Welche Theorien der Entwicklungskommunikation werden genannt?
Die Arbeit behandelt unter anderem die Modernisierungstheorie, das Diffusionsmodell und die Dependenztheorie.
Warum ist Partizipation so wichtig?
Partizipation ermöglicht es Akteuren, Entwicklungsprozesse aktiv mitzugestalten, was die Effizienz und Akzeptanz globaler Ziele erhöht.
- Citar trabajo
- Adriana Henke (Autor), 2020, Effiziente Kommunikation globaler Ziele. Möglichkeiten der Partizipation bei der Entwicklungskommunikation und der Communication for Social Change, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1265488